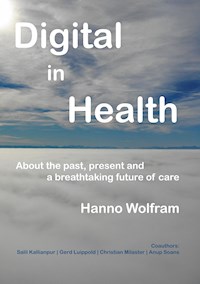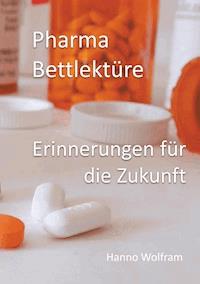
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Pharmaindustrie Wahrnehmung und Reputation der Pharmaindustrie entsprechen keinesfalls den Beiträgen, die diese Industrie für Lebensqualität, Lebenserwartung, Genesung oder Verbesserung von Gesundheit leistet. Ihre Reputation wird ihr nicht mal im Ansatz gerecht. Wer hat's gemacht? Die Pharmaindustrie selbst! 42 Jahre Pharmaindustrie, mit offenen Augen, in vielen Ländern und aus unterschiedlichen Perspektiven sind in "Pharma Bettlektüre - Erinnerungen für die Zukunft", verarbeitet. Wer sich mit dieser Industrie, ihren Gepflogenheiten, dem Verwöhntsein der handelnden Personen, den Gründen für die Veränderungssperren und ihrer Nicht-Differenzierung auf kurzweilige Art einlassen möchte, ist hier richtig. Selbst im Erscheinungsjahr gibt es noch immer eine Menge Lippenbekenntnisse der Pharmaindustrie, die vom Alltag Lügen gestraft werden. Viele Eintrittskarten sind zu buchen, mit denen sich Pharmaunternehmen differenzieren und im Gesundheitswesen unentbehrlich machen könnten. "Beyond the pill" ist zum Beispiel ein solches, bereits älteres Stichwort, das bis heute darauf wartet, mit Inhalten gefüllt zu werden. Wenn da nicht Bedenkenträger, Veränderungssperren und das Verstecken hinter regulatorischen Hemmnissen so zähe Begleiter wären. Pharma Bettlektüre ist ein Aufruf an die Pharmaindustrie, sich (endlich) aktiv in die Versorgung von Patienten einzubringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORAB
W
ARUM DIESES
B
UCH
?
F
ÜR WEN IST DIESES
B
UCH
?
E
RFAHRUNGEN
JA, FRÜHER
A
RZNEIMITTELMUSTER
P
HASE
IV-S
TUDIEN
P
HARMAREFERENT
:
EIN NEUER
B
ERUF
D
ER SOGENANNTE
P
HARMAMARKT
P
HARMAREFERENT ODER
P
HARMABERATER
: V
ERKÄUFER
?
D
AS
P
HARMA
-G
ESCHÄFTSMODELL
„KUNDE“ ARZT
I
NFORMATION VS
. P
ROMOTION
K
UNDE
:
EINE
D
EFINITION
D
ER
W
EG VOM
T
ARGET ZUM
K
UNDEN
SPANNENDE BEGRIFFE
B
EGRIFFSDEFINITION
„P
OTENZIAL
“
W
AS IST
M
ARKT
?
W
AS BEDEUTET EIGENTLICH
L
EISTUNG
?
DIGITALISIERUNG
D
IGITALISIERTES
L
EBEN
Z
WISCHENFAZIT
:
VERKAUFEN UND VERKÄUFER
D
IE GESETZLICHEN
A
UFGABEN DES
P
HARMABERATERS
U
MSATZ ALS
A
UßENDIENST
-Z
IEL
Z
IELE UND IHRE
V
EREINBARUNG
B
ONUS ODER
I
NCENTIVE
?
E
IN PRÄGENDES
E
RLEBNIS
B
ESUCHSFREQUENZ UND
A
BDECKUNG
K
ARRIEREN IM
A
UßENDIENST
B
USINESS IN
U
NITS
P
HARMA UND
K
UNDE
V
ERTRIEBSKANÄLE
AUSBLICK MIT EINBLICK
A
LTERNATIVE
1: D
ISRUPTION
A
LTERNATIVE
2: M
UTIGE
I
NNOVATION
M
EIN
D
ANK
L
ITERATURVERZEICHNIS
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
Z
UTATEN
-Z
ITATE
VORAB
Jedes gescheite Buch hat ein Vorwort. Dieses Buch hat nicht wirklich eines. Die Literatur ist voll von möglichen Vorwörtern und zum Vorwort prädestinierten Autoren. Um die Qual der Wahl überhaupt nicht erst aufkommen zu lassen, habe ich beim Fertigstellen dieses Buches auf ein Vorwort verzichtet.
Anstatt dessen versuche ich gleich zu Beginn zu vermitteln was mich bewegt hat dieses Buch zu schreiben und an wen und was ich beim Schreiben gedacht habe.
Ich hoffe, dass der Inhalt des Buches meine Intention und Motivation tatsächlich widerspiegelt und sich die richtigen Stakeholder davon angesprochen fühlen. Eigentlich ist die Zeit doch reif, dass die Pharmaindustrie die Rolle des Prügelknaben abgestreift.
In der Vergangenheit hat sie den Politikern reichlich Anlass geliefert, als der „locus minoris resistentiae“ zu gelten. Als politische Zielscheibe taugt sie allemal, dafür haben nicht nur die „Shkrelis“1 dieser Welt, sondern die eigene Preispolitik gesorgt. Vor allem die Prognosen zu Behandlungskosten mit biologischen Arzneimitteln haben die Politiker dieser Welt neuerlich aufgeschreckt und auf den Plan gerufen. Dass die Planungen für den eigenen Umsatz und damit die Kosten der Krankenversicherungen vielfach nicht eingetroffen sind, belegt dass die Zukunft im 21. Jahrhundert nur schwierig vorauszusagen ist. Dies gilt vor allem, wenn Zukunft mehr als ein Quartal entfernt liegt.
Wenn Sie an dem Buch wenig finden, sagen Sie es bitte mir ([email protected]). Wenn Sie das Buch gut finden, sagen Sie es gerne Anderen.
1https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Shkreli
WARUM DIESES BUCH?
Im Jahr 1975 habe ich im Außendienst eines Pharma-Unternehmens meinen Weg im Gesundheitswesen begonnen. Nach 20 Jahren Pharmaindustrie habe ich sie als Area Manager Europa verlassen. Der Grund dafür war persönlich: ich wollte unsere Kinder öfter als nur an Wochenenden sehen. Aus der Retrospektive war es ein großes Privileg, an vielen Stationen und Ländern diese Industrie intensiv kennengelernt zu haben. Es war ungeheuer spannend zu sehen, wie sich diese Industrie entwickelt, aber eben nicht wirklich verändert hat.
In den zwei Jahrzehnten seit meinem Weggang aus der Industrie habe ich sehr viele engagierte Menschen kennen gelernt und mit vielen gemeinsam gearbeitet. Workshops oder Beratungsprojekte mit Pharmaunternehmen, - nein, eigentlich nicht mit den Unternehmen, sondern mit den handelnden Akteuren, in mehr als 25 Ländern, haben mein Leben bereichert und mich persönlich beindruckt.
Ob es mein erstes Zusammentreffen mit gläubigen Muslimen in Jeddah oder der viertägige Workshop in Kunming, im Süden Chinas mit Pharma-Gebietsleitern aus Bangladesh oder die Woche in Singapur mit Führungskräften aus 16 asiatischen Ländern war: das gemeinsame Arbeiten, das Kennenlernen der Kultur und der Abgleich mit den mir bekannten Verhaltens- und Denkmustern, hat mir deutlich mehr gegeben, als jeglicher Touristen-Aufenthalt in einem dieser Länder.
Die Harbour-Bridge in Sydney war trotzdem eindrucksvoll, genau wie das Kempinski in Dubai oder das Café Puschkin in Moskau.
Das gemeinsame Ringen mit „Einheimischen“ um klare Einsichten in die vielen Sachverhalte und Details rund um das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie, war der absolute „Bringer“. Peter Drucker hatte recht, als er sagte: “No one learns as much about a subject as one who is forced to teach it.”
Festgefahrene Überzeugungen von in-sich-ruhenden, mit Tunnelblick ausgestatteten und ihrem Tun überzeugten Pharmamanagern waren gleichermaßen beeindruckend. Viele meiner Erlebnisse und Erfahrungen haben mich sehr nachdenklich hinterlassen.
Vielleicht gelingt es mir mit diesem Buch, einige dieser Erfahrungen mit Ihnen, meinen Leserinnen und Lesern, zu teilen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass irgendwann in der Zukunft die Pharmaindustrie den Platz einnimmt und ausfüllt, der ihr im Grundsatz zusteht.
FÜR WEN IST DIESES BUCH?
Wenn Sie
Ausreichend neugierig sind und etwas mehr über Marketing und Vertrieb, die Entwicklung der Pharmaindustrie und deren „Nicht-Veränderung“ in den letzten Jahrzehnten erfahren möchten,
Grundsätzlich an dieser wertvollen Industrie Interesse haben,
Vielleicht sogar dort tätig sind, in dieser Industrie eine gestaltende Rolle bekleiden, oder
Schon immer mal etwas zu diesen Themen lesen wollten,
dann sind Sie die richtige Leserin oder der richtige Leser für dieses Buch.
Lesen muss man nicht in einem Rutsch, sondern das geht auch seitenoder kapitelweise: Bettlektüre eben.
Wer Kontakt mit dem Autor aufnehmen möchte: [email protected]
Das Buch dreht sich um ein großes Problem, das mich schon lange beschäftigt:
Wahrnehmung und Reputation der Pharmaindustrie entsprechen nicht den Beiträgen, die diese Industrie für Lebensqualität, Lebenserwartung, Genesung und Verbesserung von Gesundheit leistet.
„Wenn das Gesundheitswesen eine Familie wäre, welche Rolle spielte darin die Pharmaindustrie?“ war einmal eine sehr spannende Frage in Fokusgruppen-Interviews. Die meistgeäußerte Antwort war für den Auftraggeber und alle Beteiligten gleichermaßen aufrüttelnd:
Im Gesundheitswesen spielt die Pharmaindustrie die Rolle der „bösen Stiefmutter“.
In Märchen ist die Stiefmutter meist diejenige, die Mitglieder der Stief-Familie eben stiefmütterlich behandelt. Sie ist nur lieb und nett zu den eigenen Nachkommen. Bei den anderen gilt sie als böse, unberechenbar, intrigant und selbstsüchtig.
Vielleicht liegt hierin bereits eine Begründung dafür, dass die Einkommen, die man in der Pharmaindustrie erzielen kann, statistisch an dritter Stelle rangieren. Nur Banken- und Finanzindustrie bezahlen ihren eigenen Mitarbeitern noch mehr. (Stepstone, 2016).
Vielleicht schafft es eines Tages diese Industrie, sich so zu verändern, dass für alle Beteiligten erkennbar wird, wie sehr sie daran beteiligt ist, dass wir heute in Deutschland von einer Lebenserwartung von statistisch 80,8 Jahren (OECD, 2015) sprechen können.
Für diesen langen und beschwerlichen Weg kann dieses Buch vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben. Wer weiß?
Gender-Correctness: Die in diesem Buch meist verwendete männliche Sprachform dient ausschließlich der einfacheren Schreibe.
ERFAHRUNGEN
Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag zeigen eine Tendenz Killerargumente zu werden. Die Herkunft vieler Erfahrungen von Pharmamanagern ist so fragwürdig, wie deren Zeugen. „Ich hatte mal einen Onkel…“ oder „Ich kenne da einen Arzt, der …“ reicht als erfahrungsprägend manchmal aus, um die Entstehung neuer oder anderer Einsichten auszuschließen.
Tragisch wird es, wenn Berufserfahrung als zentrales Kriterium für den nächsten Karriereschritt angesehen oder vorausgesetzt wird.
Es nimmt deswegen nicht wunder, dass auch im 21. Jahrhundert Pharma-Manager nach dem Motto entscheiden: „Was Jahrzehnte richtig war, kann heute nicht falsch sein.“
Es ist dies kein alleiniges Privileg deutscher Pharmaunternehmen. Obgleich man uns zugestehen muss, dass eine der wesentlichen Gaben deutscher Landeskultur den Namen Beharrungsvermögen trägt. Nachdem auch international die Pharmaindustrie von Beratern ständig an den sogenannten Best Practices ausgerichtet wird, ist sichergestellt, dass sich der fehlende Wille zur Veränderung wie ein multiresistentes Bakterium in der gesamten Branche und in praktisch allen Ländern ausgebreitet hat.
Solchermaßen einschränkende Erfahrungen betreffen eine große Zahl von Bereichen, in denen die Pharmaindustrie aktiv ist. Meiner beruflichen Herkunft entsprechend liegt mein besonderes Interesse in dem Bereich, der mit Pharma-Marketing und Pharma-Vertrieb am besten umschrieben ist.
Der Bereich Marketing ist in vielen Unternehmen eine gesonderte Abteilung, die neben der Abteilung Außendienst im Organigramm geführt wird. Was dort wie getan wird, entspringt der Weitergabe von Erfahrungen aus der Vergangenheit und dem Recycling alter Stellen- und Aufgabenbeschreibungen.
Durch die Verwendung des Wortes „Abteilung“ ist in aller Regel sichergestellt, dass Marketing und Außendienst sich „abteilen“. Das gemeinsame Arbeiten für ein gemeinsames Ziel ist strukturell ausgeschlossen, unwahrscheinlich oder bedarf ganz besonderer individueller Anstrengungen.
Erfahrung bedeutet eben auch, dass die Beteiligten über Begriffe wie das Wort Abteilung, nicht (mehr) nachdenken und es als gegeben hinnehmen. Es erscheint dennoch wichtig und wertvoll zu respektieren, dass das Wort „Abteilung“ etymologisch von abteilen hergeleitet wird und bis heute nichts mit Zusammenarbeit zu tun hat.
Als dann eines Tages die eine mit der anderen Abteilung zusammengelegt und zur Business Unit erklärt wurde, glaubte man, dass damit Zusammenarbeit hergestellt werden kann. Manche haben sich aber lediglich verwundert die Augen gerieben und über neue Anglizismen geärgert. Der Rest blieb wie früher.
Das Gerangel um die Vorherrschaft im Unternehmen besteht noch immer. Entweder die Produktmanager haben das Sagen, weil sie auf den Budgets sitzen oder der Außendienst ist der Chef von allem, weil hier „die meisten Leute“ arbeiten.
Apropos „die meisten Leute“: Ich erinnere mich an Zeiten, da hat Erfahrung dazu geführt, dass das eigene Unternehmen es grundsätzlich anderen gleichtun musste. Das kostspieligste Beispiel war: je mehr Außendienstmitarbeiter, umso erfolgreicher. Erfolg wurde zu diesen Zeiten in Umsatz gemessen. Kosten spielten keine Rolle, denn bei chemischen Arzneimitteln sind die Herstellkosten (cost of goods) gering und betragen in der Regel weniger als 10 % vom Preis.
Eine dieser alten Erfahrungen hat die Außendienstleiter dieser Welt gelehrt, dass man bei seiner Zielgruppe möglichst viele Besuche in möglichst kurzer Abfolge mit möglichst der gleichen Botschaft abliefern muss. Damit treibt man den Umsatz des besprochenen Produktes in die Höhe, sagt die Erfahrung.
Bis in das Jahr 2016 hatte es sich noch nicht herumgesprochen, dass diese traditionelle Gleichung heute nicht mehr gelten kann. Trotzdem macht der Senior Vice President, Technology Solutions, IMS Health, diese Aussage:
„Heute ist die Rolle des Außendienstes ziemlich klar: Entsprechend des Besuchsplans besucht er den Arzt, liefert seine Nachricht ab und berichtet es zurück. Danach geht er zum nächsten Arzt und wiederholt es.“ (Craig Sharp, 2016).
Doch dazu später mehr.
JA, FRÜHER …
Der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, als niedergelassene Ärzte beim Besuch eines Pharmaberaters gesagt haben: „Kommen Sie rein, Herr Kollege! Mögen Sie einen Kaffee?“ Diese Erlebnisse gab es vergleichsweise oft in den späten 70er und frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Unterschiedlich waren die Begriffe für Menschen, die von Pharma-Unternehmen angestellt wurden, um niedergelassene und andere Ärzte therapeutisch zu beraten. Es gab noch keine geschützte Berufsbezeichnung. Sie hießen Pharmaberater, Pharmaassistenten oder so ähnlich.
Die wichtigsten Auswahlkriterien waren Seriosität und Seniorität. Viele waren selbst Apotheker, Ärzte oder Angehörige verwandter akademischer Berufe. Zu Beginn war es ziemlich klar, dass Menschen die sich mit Ärzten auseinandersetzen und ihnen therapeutische Ratschläge geben wollten, selbst eine akademische Ausbildung haben sollten. Es war ihre zentrale Aufgabe, ihr Unternehmen zu vertreten und alles daran zu setzen, dass die Ärzte ihren Patienten eine möglichst optimale Therapie zukommen ließen.
Ja, das war damals wirklich wichtig.
Es ging nicht darum, mit den eigenen Produkten möglichst viel Umsatz zu machen. Noch wurde niemand wirklich am Umsatz gemessen. Es gab zwar auch 1975 bereits Umsatzdaten, aber sie erreichten die handelnden Akteure frühestens sechs Wochen nach Ende eines Quartals. Da sie auf riesigen Papierbergen gedruckt waren, waren auch der Auswertung deutliche Grenzen gesetzt.
Das zentrale Messkriterium für die Beurteilungen durch Vorgesetzte war die Zufriedenheit der Ärzte mit ihrem Ansprechpartner und vor allem der erkennbare persönliche Konnex, den man miteinander hatte. Die einschlägigen Rückmeldungen von Ärzten wurden regelmäßig vom Gebiets- oder Regionalleiter bei gemeinsamen Besuchen erfragt und erfühlt.
Das gab es damals auch: man wurde von der „Sprechstundenhilfe“ angerufen und gefragt, ob man mal wieder Zeit habe, vorbei zu kommen und den Arzt zu besuchen.
Wenn Ärzte spezielle therapeutische Fragen hatten, wandten sie sich oft an ihre persönlich bekannten Pharmareferenten, denn sie waren eine kompetente Quelle, auch für aktuelle Informationen.
Zum Beispiel bei bakteriellen oder viralen Endemien, konnte ein Pharmareferent an einem Tag 8-10 Ärzte fragen: „Wie behandeln Sie denn Ihre aktuellen Erkältungspatienten?“ Mit diesem Wissen oder einem Substrat daraus, wurden die anderen niedergelassenen Ärzte in der Umgebung sachgerecht informiert und es wurde mit ihnen therapeutisch diskutiert.
Lange vor der Erfindung des Berufsbildes Pharmareferenten waren die Gesprächspartner von niedergelassenen oder Klinikärzten gut ausgebildet, hatten detailreiches Wissen und einen weitreichenden Überblick zur Therapie mit Arzneimitteln.
ARZNEIMITTELMUSTER
Arzneimittelmustermuster gab es früher in fast beliebiger Menge.
Wir hatten Muster der Besprechungspräparate zuhause und im Auto. Die Menge war fast beliebig. Dies galt sowohl für die Anforderung beim Arbeitgeber als auch bei der Abgabe an Ärzte. Wir wurden lediglich ermahnt und gelegentlich daran erinnert, dass es nicht Aufgabe eines Musters war, Verordnungen zu ersetzen. Sie sollten es einem Arzt ermöglichen, sich mit Patienten ein eigenes Bild von Haupt- und Nebenwirkungen zu machen. Musterabgaben zu aktuellen Produkten fanden meist in verblisterten Stangen zu zehn OPs statt.
Regelmäßig erfüllt wurden Arztbitten nach Mustern eines bestimmten, meist älteren Medikamentes „ad usum proprium“ – für den eigenen Gebrauch. Solche Muster gab es, mit der entsprechenden Begründung, außerhalb des normalen Musterkontingents. Sie förderten die Bindung damaliger Therapieentscheider an seinen Pharmareferenten und bildeten gleichzeitig das, was heute als „Markenbild“ bezeichnet wird.
PHASE IV-STUDIEN
Eine sehr spannende Entwicklung nahmen die sogenannten Anwendungsbeobachtungen, Phase IV-Studien, post-marketing-surveys (PMS) oder wie man sie sonst noch nennen mag.
Die erste Phase IV-Studie, an die ich mich erinnere, war ein ausführlicher Fragebogen, den ein Arzt ausfüllen musste, nachdem er dem Patienten ein Analgetikum mitgegeben, ihn nach einer Woche nach dem therapeutischen Ergebnis befragt und eine Anzahl Laborparameter erhoben hatte.
Der Arzt erhielt nicht nur die entsprechende Anzahl (offener) Muster, sondern ebenfalls ein Honorar. Das Honorar für seine aktive Teilnahme an dieser Untersuchung mit der Eintragung verschiedener verschlüsselter Patientendaten und dreier unterschiedlicher Laborwerte im Abstand einer Woche, betrug fünf (5 DM) Deutsche Mark. Die maximale Anzahl von Patienten, die in einer Praxis in eine solche Studie eingeschlossen werden sollte, war zehn Teilnehmer.
Ich denke, jeder Insider wird sich zur Entwicklung dieser Studien über die Zeit eine eigene Meinung gebildet haben. Viele dieser, im Grundsatz wertvollen und teilweise sogar wissenschaftlich geprägten Ansätze, scheinen über die Jahre der „Gier nach Geld und Umsatz“ zum Opfer gefallen und zum Verordnungstrigger verkommen zu sein.
Es ist das Ziel, das den Unterschied macht.
PHARMAREFERENT: EIN NEUER BERUF
Als Berufsbild wurde der geprüfte Pharmareferent 1978 erfunden. Ein umfangreiches Ausbildungs-Curriculum entstand unter anderem, um den fachlichen Anspruch von forschungsgetriebenen Arbeitgebern zu erhalten. Bereits 1978 ging es darum, dass Unternehmen berechtigte Sorge hatten, dass ihre Mitarbeiter von Ärzten nicht mehr empfangen und weniger auf Augenhöhe wahrgenommen wurden. Dies lag vor allen Dingen darin begründet, dass immer weniger Pharmaberater tatsächlich Ärzte oder Apotheker waren.
Die meisten Ärzte, denen sich nach dem Krieg noch keine freie Niederlassungsmöglichkeit bot geboten hatte, fanden wieder eigene Praxen. Für diese Ärzte waren die Pharmaindustrie und die Arbeit als „Pharmavertreter“ nur ein berufliches Intermezzo, bevor es wieder möglich war, sich als Arzt niederzulassen. Meist verbrachten sie die weiteren Jahre ihres Berufslebens als niedergelassener Arzt in eigener Praxis.
Auch Apothekern ging es ähnlich, gab es doch zunehmend Neugründungen von Apotheken. Im Unterschied zu Kassenärzten, wurde die Niederlassungsfreiheit von Apothekern aber bereits im Jahr 1958 eingeführt.
Erschwerend für die Pharmaindustrie kam hinzu, dass Einkommen, wie sie von niedergelassenen Ärzten und Apothekern in den 1970er Jahren erzielt wurden, von der Pharmaindustrie nicht mehr geleistet werden konnten. Mir sind Sätze in Erinnerung, wie dieser: „Es kann ja wohl nicht sein, dass ein Mitarbeiter im Außendienst mehr verdient als ein Abteilungsleiter?!“
Die Reputation der Pharmaberater bei ihrer Klientel war hoch und ihr Ansehen war in den meisten Fällen von großem Respekt geprägt, denn sie hatten Ahnung und waren Gesprächspartner auf Augenhöhe. Sie leisteten werthaltige Beiträge für den Praxisalltag. Es gab auch nette Anekdoten.
Ich habe nie vergessen, als ein erkennbar angetrunkener Arzt mich in seinem Sprechzimmer empfing. Unser Gespräch drehte sich ausnahmsweise nicht um Arzneimittel, sondern um des Arztes persönliches Wohlbefinden.
Kurz bevor er mit dem Kopf auf die Tischplatte schlug und einschlief, bat er mich noch sehr jovial: „Mach du mal hier weiter!“
Gemeinsam mit seiner resoluten Sprechstundenhilfe (damals hatten viele Hausärzte nur eine Arzthelferin) haben wir den Doktor dann in seine Privatgemächer im ersten Stock zum Ausnüchtern gebracht. Die Patienten wurden wegen Unpässlichkeit Ihres Hausarztes auf den nächsten Tag vertröstet und nach Hause geschickt.
Die Ausbildungsdauer zum geprüften Pharmareferenten betrug sechs Monate. Die ersten drei Monate wurden für die Vermittlung von Grundlagenkenntnissen in vielen Fächern aufgewendet. Danach fanden drei Monate Präparateausbildung mit allen notwendigen Details statt.
In den ersten drei Monaten wurde z.B. die „Allgemeine Pharmakologie“, mit Pharmakokinetik und Pharmakodynamik gelehrt, um in den zweiten drei Monaten produktbezogen vertieft zu werden. Damals spielten Invasions- und Eliminationshalbwertszeiten, Ausscheidungswege und Metabolismus im Arztgespräch noch eine wichtige Rolle. Zwischen den Wettbewerbern entspann sich oftmals die Diskussion um die Wirkung aktiver Metaboliten. Es ging weder um Generika und schon gar nicht um Preise.
In der „Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Pharmareferent/Geprüfte Pharmareferentin“ von 2007 2 sind vier Qualifikationsbereiche im Detail nachlesbar:
Naturwissenschaftliche und medizinische Grundlagen.
Pharmakologie, Pharmakotherapie und Krankheitsbilder.
Arzneimittelrecht, Gesundheitsmanagement und -ökonomie.
Kommunikation, Pharmamarkt, Pharmamarketing.
Heute noch zehren viele von dem, was sie damals an profunden medizinischen, pharmakologischen, galenischen, juristischen und anderen Sachverhalten gelernt haben.
ABBILDUNG 1: PRÜFUNG BESTANDEN
2 Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Pharmareferent/Geprüfte Pharmareferentin vom 26. Juni 2007 (BGBl. I S. 1192)