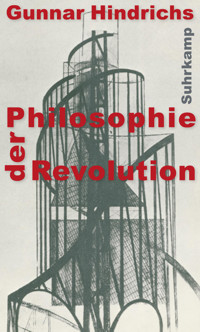
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Oktoberrevolution war nicht irgendein Ereignis. Sie hat das 20. Jahrhundert tiefgreifend geprägt. Und auch unsere eigene Zeit, die mit dem Ende des Ost-West-Konflikts aus dem Schatten des Roten Oktobers herausgetreten ist, bleibt unterschwellig auf sie bezogen. Die Alternativlosigkeit der Gegenwart wirkt wie der Nachhall der untergegangenen Alternative – und verweist damit auf 1917. In seinem luziden Buch widmet sich Gunnar Hindrichs der philosophischen Deutung der Revolution im Gesamthorizont europäischer Revolutionen.
Er vertritt die These, dass die Revolution die Regeln unseres Handelns neu setzt und dadurch den Unterschied zwischen Natur und Handeln markiert. Um diese These zu begründen, werden rechtsphilosophische, handlungstheoretische, ästhetische und theologische Konzeptionen des revolutionären Denkens untersucht, von den Schriften Sorels, Lenins und Trotzkis, dem Futurismus Chlebnikovs und Tretjakows bis zu Prophetentum und Apokalyptik. Auf diesem Weg gewinnt Hindrichs vier Explikate, die die Revolution verständlich werden lassen: ihr Recht, ihre Macht, ihre Schönheit und ihr Gott.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
3Gunnar Hindrichs
Philosophie der Revolution
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Hauptteil
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Vorwort
Erstes Kapitel Das Recht der Revolution
Recht auf Revolution
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Legalität, Illegalität, Legitimität
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Negation
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Zweites Kapitel Die Macht der Revolution
Gewalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Miteinanderhandeln
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Revolutionäre Topik
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Drittes Kapitel Die Schönheit der Revolution
Schrecklich, erhaben, schön
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Revolutionäre Kunstreligion
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Vorschein
I
II
III
IV
V
VI
VII
Viertes Kapitel Der Gott der Revolution
Exodus
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Propheten
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Die letzten Dinge
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Nachwort
Namenregister
Anmerkungen
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
383
384
385
386
387
388
389
390
391
393
394
395
396
7Vorwort
Die Revolution markiert den Unterschied zwischen Natur und Handeln. Einem alten Gedanken zufolge sind die Bedingungen, unter denen wir handeln, von Menschen gesetzt (θέσει) statt von Natur aus gegeben (φύσει). Hiernach bestimmt sich Handeln im Abstand zum Natürlichen. Das vorliegende Buch führt diesen Gedanken weiter und gibt das Kennzeichen des Abstandes an: die Revolution.
Ihm liegt die folgende Erwägung zugrunde. Eine Minimalbestimmung des Handelns lautet, Handeln sei Regelfolgen. Von ihr geht das Buch aus. Regelfolgen darf nicht mit Regelmäßigkeit verwechselt werden. Das läßt sich an dem jeweiligen Gegenbegriff einsehen. Der Gegenbegriff zur Regelmäßigkeit ist der Begriff der Regelabweichung, der Gegenbegriff zum Regelfolgen ist der Begriff des Regelbruchs. Eine Regel brechen bedeutet etwas anderes als von einer Regel abweichen, weil mit jenem die Beziehung auf einen Anspruch verbunden ist, während dieses sich auf einen Vergleichswert bezieht. Regelfolgen und Regelmäßigkeit sind daher zweierlei. Entsprechend ist ein Grund anzugeben, durch den das Handeln, dessen Minimalbestimmung das Regelfolgen darstellt, sich von der bloßen Regelmäßigkeit unterscheidet. Dieser Grund besteht darin, daß Regeln keine Gegebenheiten darstellen, sondern Einrichtungen. Als Gegebenheiten wären sie Vergleichswerte, von denen man abweichen kann; als Einrichtungen erheben sie Ansprüche, die man brechen kann. Für die Minimalbestimmung des Handelns bedeutet das: es ist im Rahmen von Einrichtungen und nicht von Gegebenheiten zu verstehen.
8Man bedarf deshalb eines Begriffes, der den Einrichtungscharakter der Regeln markiert und sie vom Gegebenen abgrenzt. Hierfür ist eine Diskontinuität von Regeln anzusetzen. Erfolgte die Einrichtung der Handlungsregeln kontinuierlich, so ließen sich diese Regeln auf Funktionen von Stetigkeit bringen. Als solche Funktionen von Stetigkeit hätte man sie als Regelmäßigkeiten zu verstehen, die man nicht brechen könnte, sondern von denen man abwiche. Entsprechend wäre der Unterschied zwischen Regelmäßigkeit und Regelfolgen nicht artikulierbar, und die Einrichtung von Regeln wäre auf die Gegebenheit von Vergleichswerten reduzierbar. Um der Artikulation dieses Unterschiedes willen hat daher an die Stelle einer stetigen Evolution von Regeln deren Revolution zu treten. Sie bezeichnet das Diskontinuum der Regeln und markiert deren Einrichtungscharakter. Auf das Handeln bezogen bedeutet das: da Handeln ein Regelfolgen und keine Regelmäßigkeit darstellt, läßt es sich nur dann begreifen, wenn der Unterschied zwischen dem Einrichtungscharakter von Regeln und ihrem Gegebenheitscharakter markiert werden kann, was in der Revolution erfolgt, die die stetige Evolution von Regeln unterbricht. Anders gesagt: handeln selber findet sein Kennzeichen in der Revolution.
Auf der Grundlage dieser Erwägung läßt sich der alte Gedanke, die Bedingungen des Handelns seien von Menschen gesetzt statt von Natur aus gegeben, regeltheoretisch umformulieren. Wären die Bedingungen des Handelns von Natur gegeben, so müßte die Revolution der Handlungsregeln ein natürlicher Vorgang sein. Wäre wiederum die Revolution der Handlungsregeln ein natürlicher Vorgang, so stünde sie unter den übergreifenden Gesetzen der Natur. Aber das Diskontinuum der Regeln erfordert die Selbstgesetzlichkeit des Handelns. Es beinhaltet die Möglichkeit, Regeln von selbst neu zu setzen, und etwas von selbst setzen können erfordert die Autonomie der Setzung. 9Diese Autonomie kann von Naturgesetzen nicht erklärt werden. Denn ein jedes Naturgesetz würde die autonome Regelsetzung zum Fall eines übergreifenden Gesetzes machen. Sie wäre innerhalb natürlicher Zusammenhänge als eine Unstetigkeitsstelle bestimmt, die einen Vergleichswert umfassender Strukturen darstellt. Als solch ein Vergleichswert unterläge sie dem übergreifenden Gesetz. Sie wäre heteronom. Das bedeutet: die Autonomie der Setzung gelangt in natürlichen Erklärungen nicht in den Blick. Sosehr das Diskontinuum des Handelns unter dem Gesichtspunkt von Naturgesetzen als Unstetigkeitsstelle bestimmt werden kann, so wenig kann es auf diese Weise als die Möglichkeit bestimmt werden, Regeln von selbst neu zu setzen. An die Stelle seiner naturgesetzlichen Erklärung hat daher seine Erklärung aus der Selbstgesetzlichkeit des Handelns zu treten. Mit ihr grenzt sich das Diskontinuum des Handelns gegen die Gesetze der Natur ab.
Somit lautet die Begründungsreihe wie folgt: die Diskontinuität der Handlungsregeln erfordert die Autonomie des Handelns; die Autonomie des Handelns beinhaltet die Unzulänglichkeit ihrer natürlichen Erklärung; also weist die Diskontinuität der Handlungsregeln ihre Erklärung durch Naturgegebenheiten zurück. Auf diese Weise markiert das Diskontinuum der Revolution den Abstand zum Natürlichen. Hierin besteht der sachliche Grund dafür, daß das revolutionäre Denken immer wieder gegen die Naturalisierung der Gesellschaft kämpfte. Im Vorspruch zu Brechts Die Ausnahme und die Regel heißt es:
Wir bitten euch ausdrücklich, findet
Das immerfort Vorkommende nicht natürlich!
Denn nichts werde natürlich genannt
In solchen Zeiten blutiger Verwirrung
Verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür
10Entmenschter Menschheit, damit nichts
Unveränderlich gelte.
Vor dem oben Dargelegten läßt sich der Skopus dieser Verse so verstehen: die Naturalisierung der Gesellschaft macht diese stetig. Sofern Gesellschaft als Natur begriffen wird, und zwar ganz gleich, ob als erste oder als zweite Natur, schließt sich das Diskontinuum, das der revolutionäre Sprung erfordert, zum Kontinuum zusammen. Mit der Revolution hingegen bricht es auf, und der autonome Einrichtungscharakter von Handlungsregeln wird gegen die natürliche Heteronomie begründet. In dieser Überlegung liegt der Gedanke beschlossen, daß in der Revolution die Gesellschaft sich als Gesellschaft und nicht als Natur zeigt. Die Revolution ist etwas Unnatürliches. Allerdings ist sie es nur insoweit, als auch das Handeln etwas Unnatürliches ist: nicht etwas, das der Natur zuwiderläuft, sondern etwas, das sich mit den Gesetzen der Natur nicht erfassen läßt. Man muß daher besser sagen, die Revolution mache den Eigensinn des Handelns geltend. Sie stellt das dar, was unsere Praxis den natürlichen Erklärungen entzieht. Dadurch tritt die Gesellschaft als Gesellschaft ins Licht. Sie kommt zu sich selber.
Hier wird allerdings ein Problem sichtbar. Wenn die Revolution das Diskontinuum des Handelns darstellt, dann kann ihr Regelsetzen nicht als Regelfolgen verstanden werden. Vielmehr unterbricht sie das Weiterhandeln unter gegebenen Regeln. Das Regelfolgen aber war als eine Minimalbestimmung des Handelns eingeführt worden. Entsprechend wäre die Revolution in Wahrheit kein Handeln. Aber die Revolution stellt den Vollzug eines Handelns dar. Wie kann sie dann noch als Regeldiskontinuum begriffen werden? Ersichtlich vermag das Problem nicht dadurch gelöst zu werden, daß man die Revolution der Handlungsregeln in das sie umgebende Regelkontinuum einbettet. Diesem Lösungsversuch zufolge unterbräche die Revolution 11das Weiterhandeln unter bestimmten gegebenen Regeln, indem sie anderen Regeln gemäß weiterhandelte, die in Geltung blieben. Eine solche Abmilderung der Regelunterbrechung verfehlt den Sachverhalt. Zwar richtet sich keine Revolution auf die Gesamtheit aller Handlungsregeln; aber sie ist nur dann eine Revolution, wenn sie das Weiterhandeln, auf das es ankommt, in der Tat unterbricht, ohne auf andere Regeln, die in Geltung bleiben, zurückgreifen zu können. Die Lösung des Problems muß daher ohne ein Netz anderwärts verbindlicher Regeln auskommen. Sie besteht darin, daß das revolutionäre Handeln den Regeln folgt, die es im Diskontinuum des Handelns selber setzt. Regelsetzen und Regelfolgen schließen sich in seinem Fall zusammen. Das heißt: revolutionäres Handeln besitzt seine Bestimmtheit darin, seine Regeln zugleich zu setzen als auch zu befolgen.
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Bedingung von Bedeutung. Die eingeführte Gleichzeitigkeit von Regelsetzen und Regelfolgen muß im Rahmen eines Handelns vieler Handelnder zu erklären sein. Denn Revolutionen erfolgen im Miteinanderhandeln. Dieses Miteinanderhandeln wiederum muß in dem Diskontinuum geschehen, das die Revolution markiert. Es geht in Revolutionen also darum, in der Unterbrechung des Weiterhandelns miteinander zu handeln. Hieraus folgt die Grundforderung der Revolutionsbestimmung: ein Verständnis davon zu entwickeln, wie man miteinander Handlungsregeln zugleich zu setzen und zu befolgen vermag und dadurch die Geltung bestehender Regeln aufhebt. Weil der Eigensinn unseres Handelns von der Revolution geltend gemacht wird, betrifft diese Grundforderung die Handlungstheorie selbst. Ohne einen Begriff vom Miteinanderhandeln in der Gleichzeitigkeit von Regelsetzen und Regelfolgen steht Handeln immer unter dem Vorbehalt, die Funktion eines übergeordneten Nichthandelns zu sein.
12Ein solcher Begriff ist das Ziel des Buches. Sein Anlaß ist der hundertste Jahrestag der Oktoberrevolution. Die Oktoberrevolution war nicht irgendein Ereignis. Zwar kann man die Bedeutung der zehn Tage, die die Welt erschütterten, in ihrem historischen Kontext relativieren; leugnen kann man sie nicht. Das kurze zwanzigste Jahrhundert besitzt in ihnen einen maßgeblichen Bestimmungsgrund. Und auch unsere eigene Zeit, die mit dem Ende der sozialistischen Staaten aus dem Schatten des Roten Oktobers herausgetreten ist, bleibt unterschwellig auf ihn bezogen. Ihre Verhärtungen und ihre Möglichkeiten ringen mit einer Krise, deren Entscheidungsresistenz mit dem Gespenst der vergangenen revolutionären Welt verbunden scheint. Die Alternativlosigkeit, deren einzige Alternative politische Destruktion zu heißen scheint, wirkt wie der Nachhall der untergegangenen Alternative — und verweist damit auf deren Beginn 1917.
Dieser Beginn darf nicht für sich genommen werden. Sosehr die Oktoberrevolution ihre Gestalt — im Guten wie im Schlechten — den besonderen Umständen Rußlands schuldete, so sehr verstand sie sich selber aus der kommunistischen Tradition der europäischen Arbeiterbewegung. Diese wiederum wußte sich als Weiterführung einer unterlegenen Richtung der Französischen Revolution, die dort zuletzt in Babeufs Verschwörung der Gleichen zum Ausdruck gelangte, sowie als Einlösung der unverwirklichten Ansprüche von 1789, sodann außerdem als Aufgriff gewisser Forderungen der Revolutionen von 1830 und 1848. In dieser Linie tritt die Pariser Kommune von 1871 als der erste Versuch einer Arbeiterrevolution in Erscheinung. Zumal Marx und Engels haben das immer wieder betont. Als der bolschewistische Flügel der russischen Sozialdemokratie 1917 die Zarenherrschaft stürzte, begriff er sich in Fortsetzung der skizzierten Linie. Einerseits sah er sich als die Erfüllung dessen, was seit der Großen Revolution der Franzo13sen immer wieder verlangt worden war. Anderseits hatte er die Schrecken der Niederlage vor Augen: nach dem Ende der Pariser Kommune wurden rund 30 000 Menschen von den Regierungstruppen ermordet und 40 000 eingekerkert. Man wußte, was beim Scheitern der Revolution droht. Neben dieses Selbstverständnis der Russischen Revolution tritt ihre Auslegung als Wiederaufführung der Französischen Revolution. Für Albert Mathiez etwa wurde 1789 im Spiegel von 1917 zum Paradigma der Moderne, und seine Lesart hat die Revolutionsgeschichtsschreibung noch im Widerspruch gegen sie geprägt.
Aus beiden Blickwinkeln wird deutlich: begreifen läßt sich die Oktoberrevolution nur im Gesamthorizont europäischer Revolutionen. Deren Bogen ist vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts zu schlagen, um den Bestimmungsgrund des zwanzigsten Jahrhunderts nicht zu verfehlen. So bringt der hundertste Jahrestag der Oktoberrevolution den europäischen Gedanken der Revolution insgesamt zur Erinnerung. Er soll in seiner Fülle, auch in seinen bedenklichsten Seiten, zum Thema werden. Eine Begrenzung muß freilich eingestanden werden: die Früchte, die der Rote Oktober außerhalb Europas trug, gelangen nur am Rande zur Sprache. Das hat seinen Grund darin, daß in ihnen Faktoren wirksam wurden, deren Untersuchung den Rahmen des Buches sprengen würde. Über diesen blinden Fleck darf man nicht hinweggehen. Allerdings widmet sich das Buch einer philosophischen Deutung der Revolution, im Unterschied zur geschichtlichen oder politischen Deutung. Es sieht daher ohnehin von vielem ab, was ein volles Verständnis von Revolutionen beinhalten müßte. Im Gegenzug wird dadurch die Artikulation eines Begriffes gewonnen. Einem solchen Begriff geht das Buch in der Hoffnung nach, daß er auch für die Sachverhalte erschließend sein möge, von deren dichter Beschreibung er um seiner Konstruktion willen absehen muß.
Zur philosophischen Deutung der Revolution kann sich das 14Buch auf vorliegende Selbstverständnisse und Interpretationen stützen, muß diese aber in einen eigenständigen Gedankengang integrieren. Die Selbstverständnisse und Interpretationen werden zu Modellen, die die Schritte des Gedankenganges bilden. Entsprechend stehen sie nicht in geschichtlicher Reihenfolge, sondern in argumentativer Ordnung. Von Bedeutung sind hier zumal Fragestellungen, die spätestens mit den verfassungsgebenden Versammlungen von Philadelphia und Paris im achtzehnten Jahrhundert in die Wirklichkeit eingriffen und von der Oktoberrevolution in eine neue Gestalt gebracht wurden. Sie kreisen um das Recht und um die Macht. Allerdings kann sich die Deutung auf diese Fragen nicht beschränken. Über sie hinaus muß sie ästhetische und theologische Ausmaße untersuchen, die der Revolutionsbegriff besitzt. Ästhetische Fragen der Moderne sind so sehr mit der gesellschaftlichen Revolution verbunden, daß diese als die »Tochter der ästhetischen Revolution« (Jacques Rancière) bezeichnet wurde. Das ist übertrieben; dennoch bleiben die Fragen einer Ästhetik der Revolution nicht zuletzt im Blick auf das Konzept der Avantgarde drängend. Eine ähnlich enge Verbindung gibt es zwischen Theologie und Revolution. Auffassungen wie die, daß Revolutionen ein säkularisiertes Heilsgeschehen oder Momente politischer Religionen darstellten, verfehlen das Verhältnis von Theologie und Politik ebenso sehr, wie sie seine Bedeutung bezeugen. Insbesondere die eschatologische Geschichtsdeutung verschmilzt die Revolution der Gesellschaft mit der Ankunft des Gottesreiches, und der Auszug aus Ägypten wie die prophetischen Verkündigungen weisen auf Wurzeln des Revolutionsbegriffes zurück, die dessen Modernität übersteigen. Auch sie sind philosophisch zu begreifen. Folglich lauten die Explikate der Revolution: ihr Recht, ihre Macht, ihre Schönheit, ihr Gott.
Erstes Kapitel
15Das Recht der Revolution
Als Ausgang hat sich der Sachverhalt ergeben, daß das revolutionäre Handeln den Regeln folgt, die es im Diskontinuum der Handlungsregeln selber setzt. Anders gesagt: im revolutionären Handeln schließen sich Regelsetzen und Regelfolgen zusammen. Um diesen Sachverhalt zu verstehen, ist die deutlichste Artikulation von Handlungsregeln zu betrachten. Sie erlaubt den geradlinigen Zugang zur Fragestellung. Eine solche Artikulation liegt in den Regeln des Handelns vor, die eine ausdrückliche Formulierung erfahren haben: die Regeln des Rechts. Wie kann innerhalb ihres Kreises die Gleichzeitigkeit von Regelsetzen und Regelfolgen gedacht werden?
Recht auf Revolution
I
Die nächstliegende Antwort besteht darin, ein besonderes Recht auf Revolution zu formulieren. Es würde im Kreis des Rechts die Unterbrechung seiner Regeln erlauben oder sogar erfordern. Insbesondere die bürgerlichen Revolutionen von Philadelphia 1776 und Paris 1789 verstanden sich innerhalb dieses Kreises. »Revolutionen sind weniger ein Zwischenfall von Waffen (un accident des armes) als ein Zwischenfall von Gesetzen (un accident des lois)«, meinte Saint-Just.[1]
16Begründet wurde die Diskontinuität der Rechtsregeln aus der Diskontinuität der Rechtsstiftung. Die Pariser Versammlung fand hierfür den Begriff: konstituierende Gewalt (pouvoir constituant).[2] Der Begriff der konstituierenden Gewalt ist ein verfassungsrechtlicher Grenzbegriff.[3] Er bezeichnet den — tatsächlichen und normativen — Ursprung der Verfassung: die zentrale Ordnung des Rechts erfolgt aus verfassungsgebender Gewalt und ist durch sie gerechtfertigt. Von den aus der Verfassungsgebung entstehenden Gewalten (pouvoirs constitués) unterscheidet sie sich wie der Grund vom Begründeten. Daher kann sie niemals unter einer rechtmäßigen Regierung wirksam werden. Rechtmäßige Regierungen sind stets verfaßte Gewalten, denn ihre Rechtfertigung steht im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung eines Gemeinwesens. Da hingegen die verfassungsgebende Gewalt den Ursprung der verfaßten Gewalten darstellt, muß sie ihre Wirkung bereits getan haben, wenn eine rechtmäßige Regierung ihr Amt ausübt. Sie darf daher mit den verfassungsändernden Gewalten, die innerhalb der konstituierten Rechtsordnung als verfaßte Gewalten ihren Ort besitzen, nicht verwechselt werden. Wird sie manifest, muß sie das verfaßte Recht sprengen, um ein neues einzurichten. Dadurch aber schränkt sie die Dauer der Verfassung ein und führt zur konstitutionellen Diskontinuität. Anders gesagt: die Wirkung der verfassungsgebenden Gewalt erfolgt als Revolution.
Neben die Diskontinuität der Rechtsstiftung tritt ein Recht 17auf sie. Es gründet in den unveräußerlichen Rechten des Menschen. Der Bezug auf sie, den die amerikanische Unabhängigkeitserklärung oder die Erklärungen des französischen Konvents dokumentieren, zeigt: aus den Menschenrechten gewinnen die verfassungsgebenden Versammlungen eine Verbotsregel für die Regierungen, sie zu verletzen, und eine Erlaubnisregel sowie sogar eine Gebotsregel für die Regierten, bei Verletzung der Menschenrechte die Regierung zu stürzen. So bewegt sich das revolutionäre Selbstverständnis von der Bindung der Herrschaft an unveräußerliche Rechte über das Recht auf den Umsturz ungerechter Herrschaft bis zur Verpflichtung auf ihn. Rechtssubjekt ist in den Dokumenten jeweils »das Volk«. Dessen Unterbrechung der geltenden Rechtsregeln und seine Einrichtung neuer Rechtsregeln werden durch eine Rechtsregel, die die Verletzung höherer Rechtsregeln betrifft, ins Recht gesetzt. Auf diese Weise bleibt die Diskontinuität der Rechtsstiftung ein Rechtsakt.
II
Um diese Struktur zu erfassen, ist eine Konzeption nötig, die einerseits das Diskontinuum, anderseits die unveräußerlichen Rechte zu erklären vermag. Das Modell hierfür bietet Rousseau. Um sich ihm zu nähern, sind zunächst die Grundzüge seiner politischen Philosophie zu erinnern.
Rousseau führt als Rechtsgrund aller Regierungen den Gesellschaftsvertrag an. Eine Gesellschaft regieren ist etwas anderes als eine Masse unterwerfen. Im ersten Fall besteht ein Verhältnis zwischen Volk und Oberhaupt, das durch den Zusammenschluß der Menschen zum Zweck ihres gemeinsamen Wohls zustande kommt. Im zweiten Fall besteht ein Verhältnis zwischen Sklaven und Herrn, das aus der Anhäufung von Einzel18nen zum Zweck ihres Privatinteresses erfolgt. Warum aber die Vergesellschaftung überhaupt eingehen? Jener Zusammenschluß bildet eine Summe von Kräften und Freiheiten, die stärker ist als die Widerfahrnisse des Naturzustandes, in dem jeder Mensch in Sorge nur um sich selbst lebt. Das heißt: der Gesellschaftszustand bietet die Erfüllung der menschlichen Selbstsorge gerade dadurch, daß man sich nicht mehr nur um sich selber sorgt, sondern in Sorge um die Gemeinschaft zusammenschließt. Entsprechend beruht die Regierung einer Gesellschaft auf einem Zusammenschluß von Menschen zum Zweck ihres Gemeinwohls, der die Selbsterhaltung der natürlichen Kraft und Freiheit besser zu gewähren vermag als ihre bloße Anhäufung im Verhältnis von Sklaven und ihrem Herrn.
Hieraus ergibt sich die Aufgabe des Gesellschaftsvertrages. Sie lautet: »Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ganzer gemeinsamer Kraft die Person und das Gut jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die jeder, indem er sich mit allen vereinigt, trotzdem niemandem als sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor.«[4] Die Lösung dieser Aufgabe besteht in der Idee des Gemeinwillens (volonté générale). Die Menschen müssen sich so zusammenschließen, daß sich jeder unter das Maß des auf das Gemeinwohl gerichteten Willens stellt. Dann bilden sie einen Körper, dessen Glieder sie sind. Ihre Freiheit bleibt bewahrt, weil sie weiterhin nur sich selbst gehorchen: sie sind ja nichts anderes als ein Glied des Körpers, der ihr gemeinsames Ich (moi commun) darstellt. Die Sorge um ihn ist die Sorge um sich selbst.
Freilich verändert sich die Freiheit der Menschen im Gesellschaftszustand grundlegend.[5] Im Naturzustand stellt sie die Freiheit des Selbstinteresses dar. Hier erlangt der Mensch nur 19eine verkürzte Freiheit, weil er den Antrieben seiner Begierden, Wünsche und Regungsherde unterworfen bleibt. Seine Freiheit ist die Freiheit, seine Unfreiheit zu leben. Eine Freiheit hingegen, die den Menschen zum Herrn seiner selbst macht, müßte in einer Regelung seiner Selbstinteressen bestehen. Mit anderen Worten: sie bestünde in seiner Eigenregelung. Diese verwirklicht sich in der Befolgung selbstgegebener Regeln. Solche Befolgung wäre demnach die Freiheit, seine Freiheit zu leben. Nichts anderes als Gesetze, die sich die Menschen selber geben, sind aber die Äußerungen des gesellschaftlichen Gemeinwillens. Man darf sie nicht mit den Äußerungen eines Gesamtwillens (volonté de tous) verwechseln.[6] Ein Gesamtwille wäre die Summe von Sonderwillen aus Einzelinteressen. Von ihr abweichende Sonderwillen haben dasselbe Recht wie jene Summe: die einen Sonderwillen stehen gegen die anderen. Im Gemeinwillen aber summieren sich die Sonderwillen nicht. Vielmehr werden sie in ihm verwandelt, indem sie die Perspektive auf das individuelle Selbst in eine Perspektive auf das gesellschaftliche Selbst überführen. Abweichende Sonderwillen stehen daher nicht gegen andere Sonderwillen, sondern gegen eine übersubjektive Subjektivitätsstruktur, deren Momente sie darstellen. Entsprechend haben sie nicht das gleiche Recht wie der Gemeinwille. Sonderwille und Gemeinwille gehören unterschiedlichen Kategorien an. Wenn aber der Gemeinwille die Grundlage der Gesellschaft bildet, dann muß der Sonderwille, dessen Selbstsorge der Gesellschaftszustand durch deren Aufhebung ja erfüllt, vor dem Gemeinwillen zurückstehen. Im Gesellschaftszustand tritt an die Stelle der natürlichen Freiheit des Selbstinteresses die bürgerliche Freiheit gemeinsamer Sittlichkeit. Sie überwindet den Widerstreit der Einzelwünsche zugunsten des 20Gemeinwohls, in dem ein jeder Bürger sich wiederzuerkennen vermag.
Ersichtlich kennt eine solche Gesellschaft nur eine Gestalt der Souveränität: die Ausübung des Gemeinwillens. Und da der Gemeinwille die Form des Zusammenschlusses von Menschen zum Gesellschaftskörper darstellt, ist der Zusammenschluß der Souverän selber. Die Akte der Souveränität erfolgen somit nicht als Akte eines Überlegenen gegenüber einem Unterlegenen. Sie erfolgen als Übereinkunft eines Körpers mit seinen Gliedern.[7] Nun heißt die Gesamtkörperschaft »Volk«, und der Teilhabende an ihrer Souveränität »Bürger«.[8] Entsprechend verwirklicht sich die bürgerliche Freiheit gemeinsamer Sittlichkeit in der Republik eines souveränen Volkes. Hierin liegt eine weitreichende Folge beschlossen. Sobald es einen Herrn gibt, gibt es keinen Souverän mehr. Denn dort, wo es einen Herrn gibt, tritt an die Stelle eines Zusammenschlusses von Bürgern die Anhäufung von Einzelinteressen. Die Anhäufung von Einzelinteressen wiederum vermag niemals zu etwas anderem zu gelangen als zu einem Gesamtwillen. Dadurch verdrängt dieser den Gemeinwillen, und der politische Körper zerfällt. Das bedeutet: das Volk löst sich auf.[9] Die Volkssouveränität widerspricht somit bereits der bloßen Existenz eines Herrn. Da sie den Rechtsgrund der Regierung abgibt, ist die Regierung eines Herrn grundlos.
21III
Rousseaus Konzeption stellt keine Theorie der Revolution dar. Aber sie kann direkt in eine solche überführt werden. Das zeigt Robespierre in seiner Rede für die Hinrichtung des Königs.[10] Er legt dar, daß das ancien régime nur einen Herrn kennt. Dadurch verletzt es die Souveränität des Gemeinwillens. Anders gesagt: es kündigt den Gesellschaftsvertrag auf. Entsprechend verfügt seine Regierung über keinen Rechtsgrund, und das Verhältnis des Volkes zu ihr ist kein gesellschaftliches Rechtsverhältnis. Ein König steht bereits als König außerhalb des Rechts. Deshalb darf, ja deshalb muß man ihn auch ohne Betracht der üblichen Rechtsverfahren behandeln. Die Revolution hingegen ist rechtstiftend. Indem sie den Souverän, das Volk, wieder einsetzt, gibt sie den gesellschaftlichen Gesetzen ihren Grund. Als derart konstituierende Gewalt muß sie nur den Gesetzen des Naturzustandes folgen. Diese lauten auf den Zusammenschluß von Menschen zum Zweck ihres Gemeinwohls, das ihre natürliche Freiheit erfüllt. Im Gemeinwohl des souveränen Volkes, das den Inhalt der volonté générale bildet, begründet sich somit die Revolution. Es ist ihr Rechtsgrund. Robespierre warnt daher die Abgeordneten des Konvents — »Citoyens, prenez-y garde« — davor, die revolutionäre Situation mit der Normallage zu verwechseln: eine Nation, die einen Staatsbeamten bestraft, während sie die Regierungsform beibehält, ist etwas anderes als eine Nation, die die Regierung selbst stürzt. Die Erhebung ist das Gerichtsverfahren selbst. Entsprechend ruft Robespierre aus: »Aber das Volk! Was für ein anderes Gesetz kann es befol22gen, als die Gerechtigkeit und die Vernunft, gestützt von seiner Allmacht? […] [W]ir prunken mit einer falschen Menschenliebe, weil das Gefühl der wahren Menschlichkeit uns fremd ist; wir verehren den Schatten eines Königs, weil wir das Volk nicht zu respektieren wissen.«[11]
IV
Die Struktur eines Gemeinwillens und seine unveräußerliche Souveränität haben seit jeher Fragen aufgeworfen. Es handelt sich um die Übertragung einer ursprünglich Gott zugeschriebenen Willensallgemeinheit ins Politische.[12] Hegel sah in ihr den Grund für die Schreckensherrschaft; zugleich bekannte er sich zu Rousseaus Unterscheidung zwischen Gemeinwille und Gesamtwille.[13] Aber nicht diese Fragen sind in unserem Zusammenhang leitend. Statt dessen ist der Blick auf das rechtstiftende Subjekt zu richten, das Rousseau ohne Ausweichen untersucht: das Volk.
Der Bestand des Volkes ist an den Vollzug des Gemeinwillens gebunden. Entsprechend besteht das Volk nicht vor dem Gesellschaftsvertrag, sondern bildet sich erst, indem es den Gesellschaftsvertrag eingeht, dessen Form die volonté général darstellt. Rousseau nennt diesen Vorgang den »Akt, durch den ein Volk ein Volk ist« (l'acte par lequel un peuple est un peu23ple).[14] Das ist ein eigentümlicher Akt.[15] In ihm erfolgt ein Sprung aus dem Naturzustand der Einzelnen in den Gesellschaftszustand ihres Zusammenschlusses. Das Volk von Bürgern existiert weder von Natur aus, noch entsteht es aus dem Rechtsleben. Denn im Naturzustand gibt es keinen Gemeinwillen, nur die Selbstsorge der Einzelwillen. Das gesellschaftliche Rechtsleben wiederum wird vom Gemeinwillen erst erschaffen. So fallen beide Möglichkeiten aus, das Volk im Rahmen der Frage nach dem Rechtsgrund der Regierung aus einem vorangehenden Zustand herzuleiten. Statt dessen begeht das Volk einen Akt, durch den es überhaupt erst zum Volk wird. Das gemeinsame Ich setzt sich selbst. Das bedeutet zum einen, daß das Volk kein historisches Gebilde darstellt, sondern in seiner Selbstsetzung jäh da ist. Und es bedeutet zum andern, daß es kein zufälliges Faktum darstellt, sondern ein autonomes Selbstverhältnis. Rousseau schreibt: »Dieser Akt des Zusammenschlusses schafft augenblicklich anstelle der Einzelperson jedes Vertragspartners einen sittlichen und kollektiven Körper.«[16] Wenn die Menschen einen Gemeinwillen bilden, dann vermitteln sie sich unvermittelt miteinander.
Entsprechend muß aber auch die Revolution, die die Souveränität des Volkes als den Rechtsgrund der Regierung verwirklicht, einen Akt darstellen, durch den ein Volk zum Volk wird. Das heißt: die Revolution ist dessen Selbstsetzung. In diesem Gedanken findet die begriffliche Struktur, die das revolutionäre Diskontinuum der Handlungsregeln erfordert, ihren Aus24druck. Die Struktur besagt: wenn es ein Recht auf Revolution gibt, dann muß es ein Recht im Diskontinuum des Rechts sein. Dieses Recht hat sich als das Recht der verfassungsgebenden Gewalt erwiesen, die im Bezug auf die unveräußerlichen Rechte der Menschen wirksam wird. In der Tat wirkt die verfassungsgebende Gewalt im Diskontinuum des Rechts, indem ihre Rechtseinrichtung alles bereits eingerichtete Recht prinzipiell für ungültig erklärt. Zugleich begründet sie sich im Rückgriff auf unveräußerliche Rechte des Menschen. Sie erfolgt, weil sie deren Geltung zur Wirklichkeit bringt. Damit ist eine Gegenstrebe verbunden. Einerseits gelangen die Menschenrechte erst im Diskontinuum der eingerichteten Rechtsregeln in Kraft. Anderseits wäre die verfassungsgebende Gewalt der Revolution ohne sie ein bloßes Ereignis. Der doppelte Boden der Menschenrechte schützt die revolutionäre Entsetzung des Rechts vor dem freien Fall in die Rechtsgrundlosigkeit. Umgekehrt kann die Geltung der Menschenrechte allein keine Revolution begründen. Die Menschenrechte gelten kontinuierlich. Entsprechend können alle Veränderungen des Rechts, die unter ihrer Richtschnur erfolgen, als Anpassungen des Bestehenden an das eigentlich Geltende aufgefaßt werden. Hier gibt es kein Diskontinuum, sondern eine kontinuierliche Annäherung an den Grenzwert der Menschenrechte. Werden hingegen die Menschenrechte von der verfassungsgebenden Gewalt bemüht, dann geht ihre kontinuierliche Geltung in deren Diskontinuum ein, das sie allererst in Kraft setzt. Das Recht auf Revolution benötigt daher beides: Menschenrechte und pouvoir constituant.
Ebendeshalb muß auch das revolutionäre Rechtssubjekt in doppelter Hinsicht verstanden werden. Einerseits hat es ein Subjekt im Diskontinuum zu sein. Anderseits darf es kein bloßes Faktum oder Ereignis darstellen. Beides erfüllt Rousseaus Begriff des Volkes. Wenn das Volk nur durch den Akt seiner 25Selbstsetzung ein Volk ist, dann steht es im Diskontinuum sowohl des Naturzustandes, aus dem es herausspringt, als auch des Rechtslebens, das es begründet. Gleichzeitig bleibt es an die unveräußerlichen Rechte der Menschen gebunden. Deren Zusammenschluß zum Volk erfolgt ja um der Erfüllung ihrer natürlichen Selbstsorge willen und darf die mit ihr verbundene Freiheit und Güter nicht verletzen. Das souveräne Volk, das sich mit der Bildung eines Gemeinwillens selber setzt, ist somit die Größe, die das revolutionäre Diskontinuum unter dem Gesichtspunkt des Rechts benötigt. Es ist das Subjekt, dem das Recht auf Revolution zukommen kann.
Doch sosehr Rousseaus Begriff des Volkes die formalen Anforderungen an das revolutionäre Rechtssubjekt erfüllt, so wenig vermag er sie inhaltlich zu füllen. Denn die Frage danach, wie eine allgemeine Selbstsetzung sinnvoll zu denken sei, beantwortet er nicht. Der Begriff bietet zwei mögliche Ausgangspunkte einer Selbstsetzung des Volkes: die Menge der Sonderwillen und den Gemeinwillen. Um eine Aushandlung von Sonderwillen darf es sich nicht handeln. Hier würden sich Menschen so miteinander vermitteln, daß sie eine gewichtete Summe von Sonderwillen erzeugten. Dann entstünde zwar ein Gesamtwille, aber kein Gemeinwille: eine Anhäufung von Menschen unter einem Herrn, aber kein Zusammenschluß von freien Bürgern. Folglich erfolgt die Selbstsetzung des Volkes nicht als Ordnung der Sonderwillen. Aus dem Gemeinwillen kann die Selbstsetzung aber auch nicht erfolgen, weil sie ja gar nichts anderes ist als die Bildung eines Gemeinwillens. Weder von den besonderen Willen noch vom Gemeinwillen kann daher der Akt, durch den ein Volk ein Volk ist, seinen Ausgang nehmen. Man könnte als Ausweg erwägen, ob das gemeinsame Ich vor der Vergesellschaftung vielleicht implizit existierte. Seine Selbstsetzung machte es dann nur explizit. Das ließe sich so durchführen, daß jeder Sonderwille die Unerfüllbarkeit seiner 26Selbstsorge im Naturzustand erkennt und daher zur Sorge um das Gemeinwohl übergeht. Hier wäre im Sonderwillen der Gemeinwille implizit: als die Erfüllung des Anspruchs auf Selbstsorge, den jener erhebt, ohne ihn selber erfüllen zu können. Die Selbstsetzung des Volkes würde diese Implikation des Gemeinwillens im Sonderwillen ausdrücklich machen. Aber diese Erwägung würde nichts erklären. Denn ausdrücklich würde der Gemeinwille nur im Akt allgemeiner Selbstsetzung. Entsprechend erfolgte dieser Akt nicht aus dem Gemeinwillen, sondern aus einer Reflexion auf dessen Implikation in den Sonderwillen. Woher aber diese Reflexion rührt, vermögen weder der implizite Gemeinwille noch die expliziten Sonderwillen zu begründen. Folglich wird der Akt, durch den ein Volk ein Volk ist, nicht erklärt. Der Sinn einer allgemeinen Selbstsetzung bleibt dunkel.
V
In der Dunkelheit der allgemeinen Selbstsetzung geht das revolutionäre Rechtssubjekt verloren. Anders könnten die Dinge indessen liegen, wenn die allgemeine Selbstsetzung eine innere Selbstsetzung des Handelnden darstellte. Dessen Wille könnte dann den Ausgang des Aktes bilden, durch den das revolutionäre Rechtssubjekt ein revolutionäres Rechtssubjekt ist. Ein solcher Wille hätte zwei Forderungen zu erfüllen. Erstens müßte er sich als Selbstsetzung des Ichs vollziehen. Dadurch wäre er im Diskontinuum augenblicklich da. Zweitens müßte im Handelnden selber die rechtstiftende Vergesellschaftung, eine Allgemeinheit, zur Geltung kommen. Dadurch wäre im individuellen Willen die verfassungsgebende Gewalt vereinzelt, die mit dem Recht auf Revolution verbunden ist. Ließe sich diese Struktur gewinnen, so wiche die Dunkelheit einer allgemeinen 27Selbstsetzung dem Licht individuellen Selbstbewußtseins. Es würde sich seines Eigenrechts auf Revolution inne.
Tatsächlich ermöglicht den Ansatz zu einer solchen Struktur eine Weiterführung von Kants praktischer Philosophie. Denn deren kategorischer Imperativ — »Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne«[17] — verinnerlicht Rousseaus Gemeinwillen. Das erfolgt über eine Strukturähnlichkeit.[18] Rousseaus Gemeinwille erweist die rechtmäßigen Regeln der Gesellschaft als Äußerungen einer allgemeinen Gesetzgebung, die im vergesellschafteten Willen der Menschen gründet. Kants kategorischer Imperativ erweist die rechtmäßigen Regeln des Handelns als Äußerungen einer allgemeinen Gesetzgebung, die im reinen Willen des Menschen gründet. In beiden Fällen sind die Regeln des Handelns Willensgebilde, und in beiden Fällen weisen sie sich als Momente einer allgemeinen Gesetzgebung aus. Rechtlich gesprochen, ist der Wille die konstituierende Gewalt, der sich zur universalen Legislative entfaltet. Während indessen Rousseau die konstituierende Gewalt als den Gemeinwillen versteht, versteht Kant sie als den individuellen Willen eines Individuums. Dadurch nimmt er die Verinnerlichung des Gesellschaftsvertrags vor.
Mit der Verinnerlichung ist verbunden, daß im kategorischen Imperativ eine abstrakte Gesellschaftlichkeit wirkt, die der Faktor »allgemeine Gesetzgebung« beinhaltet. Dieser Faktor erhebt den einzelnen Handelnden zur Allgemeinheit. Die Allgemeinheit ist hier nicht das Erzeugnis einer allgemeinen 28Selbstsetzung. Vielmehr stellt sie das Implikat einer Grundnorm dar, die in der Autonomie des Individuums steckt. Dem kategorischen Imperativ folgen heißt: sich das Gesetz des Handelns selbst zu geben. Denn er ist das Ergebnis einer zunehmenden Häutung des handelnden Subjekts. Dessen äußerste Schicht besteht in den Besonderheiten, die dem Subjekt in der natürlichen Welt zukommen, seine Regungsherde, Wünsche und Interessen. Diese Besonderheiten stehen, wie alle Sachverhalte der natürlichen Welt, unter allgemeinen Naturgesetzen. Entsprechend ist die äußerste Schicht des Handelnden heteronom. Gelingt es ihm hingegen, aus seiner Besonderheit zu strenger Allgemeinheit überzugehen, dann tritt er aus der Heteronomie der Naturgesetze heraus. Eine strenge Allgemeinheit kann nicht material sein, weil die Materialität des Menschen seine natürliche Beschaffenheit ausmacht. Sie muß eine formale Allgemeinheit sein. Formale Allgemeinheit trägt aber die Struktur eines universalen Gesetzes. Von der Heteronomie zur Autonomie zu gelangen bedeutet demnach, seine materialen Handlungsbestimmungen auf die Struktur eines universalen Gesetzes zu bringen. Nichts anderes verlangt der kategorische Imperativ: handle so, daß die Maxime deines Handelns als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann. Indem man das vollzieht, verläßt man den Naturzustand, wo einen seine besonderen Regungsherde, Wünsche und Interessen beherrschen, und tritt in den sittlichen Zustand ein, in dem man sie unter der Richtschnur einer allgemeinen Stimme selber beherrscht. Auf diese Weise beinhaltet der Einzelwille selber Gesellschaftlichkeit. Der kategorische Imperativ läßt sich demnach wie folgt umformulieren: handle so, daß deine praktische Selbstbestimmung zur allgemeinen Selbstbestimmung taugt.
Angesichts dieser Strukturähnlichkeit liegt es nun nahe, die revolutionären Schlußfolgerungen, die man aus Rousseaus Prin29zip ziehen konnte, ebenfalls in die sittliche Einsicht des Handelnden zu verlegen. Das Argument hat folgenden Umriß. Im kategorischen Imperativ vereinzelt sich die Vergesellschaftung zur Selbstbestimmung des Individuums. Dessen Wille bildet sich als Gemeinwille: seine Maxime muß zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung taugen. Entsprechend macht sich die sittliche Einsicht als der Rechtsgrund der Gesellschaft geltend. Weil sie gar nichts anderes ist als die Einsicht in den Gemeinwillen, stellt sie die konstituierende Gewalt aller Regierung dar, vor der diese sich sittlich zu verantworten hat. Wirksam wird sie als konstituierende Gewalt aber — wie gesehen — in Form der Revolution. Folglich führt die sittliche Einsicht dann, wenn sie sich gezwungen sieht, ihre konstituierende Gewalt gegenüber der Regierung auszuüben, zur Revolution.
VI
Es war Fichte, der diesen Schluß aus Kants praktischer Philosophie zog. Kant überlegt: »Eine Verfassung von der größten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, daß jedes Freiheit mit der andern ihrer zusammen bestehen kann […], ist doch wenigstens eine notwendige Idee, die man nicht bloß im ersten Entwurfe einer Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zum Grunde legen muß.«[19] An diese Idee anzuknüpfen begeistert Fichte.[20] Durchgeführt wird es in seinem Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution. Hierzu verankert Fichte die politische Idee in der ethischen Selbstbestimmung. Die Autonomie des 30Individuums, seine Freiheit, gerät zur Grundlage der Rechtsverfassung, weil sie gar nichts anderes ist als der Vollzug des kategorischen Imperativs, dessen unbedingtes Gebot Recht und Verfassung umfassen muß. Zugleich darf sie die Autonomie anderer Individuen nicht beeinträchtigen, da das Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung die Selbstbestimmung aller Menschen beinhalten muß. Entsprechend lautet die politische Grundnorm: »Hemme niemandes Freiheit, insofern sie die deinige nicht hemmt.«[21] Kant hatte ähnlich gesprochen.[22] Fichte greift das auf und gewinnt daraus, anders als Kant, ein Recht auf Revolution.
Fichtes Überlegung beginnt mit einer Theorie subjektiver Rechte. Aus der Bindung der politischen Grundnorm an die ethische Grundnorm ergeben sich drei Grundrechte jedes Einzelnen. Erstens hat er ein Recht auf alle Handlungen, die die sittliche Einsicht ihm gebietet oder denen gegenüber sie gleichgültig ist. Dieses Recht ist unveräußerlich, da es nichts anderes als seine Selbstbestimmung aussagt. Zweitens hat der Einzelne auf die erlaubten, aber nicht gebotenen Handlungsentscheidungen veräußerliche Rechte. Zwar dürfen diese Rechte ihm nicht gegen seinen Willen genommen werden, da dann seine Selbstbestimmung eingeschränkt würde. Aber er selber kann diese Rechte aus freiem Willen veräußern. Das geschieht bindend in Verträgen mit anderen Menschen, die zugunsten einer gemeinsamen Absicht ebenfalls auf gewisse Rechte verzichten. Schließlich hat der Einzelne, drittens, ein unveräußerliches Recht auf Vertragsauflösung.[23] Denn wenn ein Vertrag nur auf 31der Grundlage veräußerlicher Rechte gilt, dann verliert er seine Geltung, sobald er unveräußerliche Rechte verletzt. Gegenüber der sittlichen Einsicht gilt er somit nur nachrangig.
Der Gesellschaftsvertrag ist ein Vertrag. In ihm verzichten Menschen auf veräußerliche Rechte, um ein Gemeinwesen zu bilden. Hieraus folgt, daß die Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen von der Selbstbestimmung des Einzelnen abhängt. Es folgt weiter, daß ein Gesellschaftsvertrag, der die unveräußerlichen Rechte des Einzelnen beeinträchtigt, nichtig wird. Und es folgt zuletzt, daß aufgrund des dritten Grundrechts ein unveräußerliches Recht auf seine Auflösung besteht. Der Gesellschaftsvertrag kann dann, wenn er die unveräußerlichen Rechte des Einzelnen verletzt, gekündigt werden. Da dieses Recht in der sittlichen Grundnorm begründet liegt, hat es nichts mit den Umständen der natürlichen Welt zu tun, sondern macht sich ausschließlich als Gebot geltend. Die Auflösung des Gesellschaftsvertrages bleibt gleichmütig gegenüber faktischen Gegebenheiten. Das bedeutet zumal, daß sie sich unabhängig von einem Herrschaftsgebiet vollzieht. Der Vertrag kann für den Einzelnen nichtig werden, ohne daß dieser das Territorium verlassen müßte. Entsprechend hat die Regierung dieses Territoriums kein Recht, ihn zur Befolgung des Gesellschaftsvertrages zu zwingen, nur weil er sich auf ihrem Gebiet befindet. Im Gegenteil setzt ihn sein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung gemäß sittlicher Einsicht ins Recht, den Vertrag mit ihr auf ihrem Territorium zu kündigen.
Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zum Recht auf Revolution. Deren Definition läßt sich so formulieren: eine Revolution besteht in der Auflösung des Gesellschaftsvertrages durch eine Gruppe von Menschen, die auf dem Regierungsgebiet jenes Vertrages einen neuen Gesellschaftsvertrag abschließen. Dieser neue Gesellschaftsvertrag versetzt die Regierung des alten Vertrages außerhalb seiner Geltung, obgleich er auf dem32selben Landstrich eingegangen wurde. Auf einen solchen Vorgang haben Menschen dann ein Recht, wenn sie ihr Recht auf die Auflösung eines Gesellschaftsvertrages wahrnehmen, der ihre Selbstbestimmung aus sittlicher Einsicht verletzt. Mit anderen Worten: es ist begründet in der Mißachtung der unveräußerlichen Menschenrechte, die mit dieser Selbstbestimmung zusammenhängen. Das Recht auf Vertragsauflösung enthält wiederum das Recht auf einen neuen Vertrag, der zur Sicherung der Menschenrechte dient. Dadurch wird jenes Recht zum Recht auf konstitutive Gewalt. Und noch eine letzte Bestimmung ist von Bedeutung. Die sittliche Einsicht gewinnt menschliche Wirklichkeit in Form des individuellen Gewissens. Entsprechend ist es das Gewissen der Einzelnen, in dem die Grundnorm vertragsauflösend und vertragsstiftend wird. Das heißt: das Recht auf Revolution ist das Recht auf gewissenhaftes Handeln — gerade auch dort, wo das Gemeinwesen ihm entgegensteht und es daher die Einrichtung eines neuen Gemeinwesens verlangt. Das Recht auf Revolution wird nur im Gewissen des Handelnden entschieden. An eine äußere Institution abgegeben werden kann es nicht.
VII
Mit der Verankerung der Revolution im Gewissen ist die Verankerung des revolutionären Rechtssubjekts in der inneren Selbstsetzung verbunden. Ein Jahr nach seinem Buch über die Revolution beglaubigt Fichte die Grundlage seines Denkens in der ersten Version der Wissenschaftslehre. Dort argumentiert er für die Selbstsetzung des Ichs. Sie ergibt sich aus der Selbstzuschreibung von Bewußtseinsinhalten.
Jeder deskriptive Gehalt meines Bewußtseins kann als der meine gekennzeichnet werden. Diese Kennzeichnung aber ist 33selber deskriptiv leer: sie beschreibt nichts, sondern bezieht einen beschreibbaren Gehalt auf mich, der ich ihn habe. In der Selbstzuschreibung von Bewußtseinsinhalten erfolgt daher eine gehaltlose Selbstbezüglichkeit, die sich nicht auf Gehalte zurückführen läßt, sondern spontan erfolgt. Fichte nennt diese spontane Selbstbezüglichkeit eine »Thathandlung […], die […] allem Bewusstseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht«.[24] Ihre Eigentümlichkeit formuliert er in der Begrifflichkeit von Setzen und Selbstsetzen.[25] In meinem Bewußtsein setze ich einen gewissen Inhalt. Dieses Setzen ist kein Inhalt, sondern ein Setzen des Inhalts: meine Tätigkeit. Ich wiederum bin nur der, der ich mir meine Bewußtseinsinhalte zuschreibe. Außerhalb dieser Tätigkeit der Selbstzuschreibung bin ich nichts. Das heißt, ich bin im Setzen dieser Inhalte dort also ebenso gesetzt wie diese. Zugleich bin ich nicht einer dieser Inhalte, sondern setze die Inhalte. Ich bin demnach gesetzt als ein Setzender. Und weil das Setzen meiner Bewußtseinsinhalte mein Setzen darstellt, setze ich mich selbst als das Setzen von Bewußtseinsinhalten, also als einen Nicht-Inhalt. Ich setze mich als das gehaltlose Setzen von Bewußtseinsgehalten.
Dieses Argument betrifft das absolute Ich. Absolut ist das gehaltlose Setzen, weil es durch keinen bestimmten Gehalt bedingt wird. Auf dieser Ebene gibt es keine Vereinzelung. Denn um von einem einzelnen Ich sprechen zu können, ist eine Mehrzahl anzusetzen. Es gibt aber keine vielen Absolute: Pluralität würde sie relativieren. Auf der Ebene des Absoluten kann das Ich indessen nicht stehenbleiben. Seine deskriptive Leere erfordert den Übergang in das praktische Selbstbewußt34sein.[26] Das praktische Selbstbewußtsein besteht in der Selbstbestimmung zu Handlungen. Hier will das Subjekt »etwas«, und es sucht sein Wollen in der Welt zu verwirklichen. Dadurch bestimmt es sich als gegenständliches Wollen im Bezug auf einen Bereich, der ihm entgegengesetzt ist (Nicht-Ich). Fichte bringt diese inhaltliche Konkretion des Ichs zum »etwas wollen« auf die Begriffe des Triebes und der Handlung.[27] Der Trieb ist das sich selbst erzeugende Streben des Ichs, aus sich hinauszugehen. Die Handlung ist dieser Ausgang. Insofern beides aus dem absoluten Ich erfolgt, muß der Trieb ein absoluter Trieb sein, und die Handlung eine absolute Handlung. Entsprechend ist die Regel des Handelns eine absolute Regel. Eine absolute Handlungsregel aber ist das unbedingte Gebot des kategorischen Imperativs. Die Konkretion des Ichs erfolgt darum als Zusammenspiel von kategorischem Imperativ und Handlung in der Welt. In der Welt handeln bleibt eine Selbstbestimmung des Ichs, wenn das Ich in jener Wirkung sein eigenes Streben danach, aus sich herauszugehen, wiederzuerkennen vermag. Das ermöglicht der kategorische Imperativ als die normative Gestalt dieses absoluten Strebens.
Mit diesem spekulativen Zug hat Fichte das revolutionäre Subjekt neu bestimmt. Die Schritte sind die folgenden. Gewissenhaftes Handeln ist ein Handeln gemäß dem kategorischen Imperativ. Der kategorische Imperativ wiederum drückt das absolute Streben des Ichs aus, in der Welt zu wirken. In der 35Welt wirken wiederum nimmt die inhaltliche Selbstbestimmung des sich selbst setzenden Ichs vor. Das sich selbst setzende Ich wiederum ist gar nichts anderes als der Vollzug einer spontanen Tathandlung. Wenn nun die Revolution nichts anderes ist als die Aufkündigung des Gesellschaftsvertrages aus gewissenhaftem Handeln, dann gehört sie zur inhaltlichen Konkretion jener Tathandlung. Mit anderen Worten: als revolutionäres Subjekt konkretisiert sich das sich selbst setzende Ich.[28] Da mit der sittlichen Einsicht zudem unveräußerliche Rechte verbunden sind, deren eines die Vertragsauflösung betrifft, geht die inhaltliche Selbstbestimmung des sich selbst setzenden Ichs mit der Geltung jener Rechte einher. Folglich gibt es ein Recht auf Revolution deshalb, weil das sich selbst setzende Subjekt im gewissenhaften Handeln seine Selbstbestimmung gewinnt, bei deren Verletzung es bestehende Gesellschaftsverträge kündigen kann. Die Revolution ist im absoluten Ich absolut verankert.
Diese Bestimmung des revolutionären Subjekts scheint die Bedingungen des revolutionären Handelns zu erfüllen. Die Diskontinuität des Handelns ist durch den Sachverhalt gewährt, daß ein sich selbst setzendes Ich den letzten Grund der Revolution abgibt. Selbstsetzung zersprengt jedes Kontinuum. Hier besteht sie nicht in der unerklärlichen Selbstsetzung eines Kollektivs, sondern in der individuellen Selbstsetzung, die am Grunde allen Bewußtseins liegt: dem die spontane Tathandlung ausdrückenden »Ich bin«. Sie begründet das praktische Selbstbewußtsein, das die Revolution durchführt. Zugleich löst das Diskontinuum den Rechtskreis nicht auf. Vielmehr ent36springen aus der Selbstsetzung unveräußerliche Rechte, die ebenso absolut gelten wie das Sittengesetz, unter dem die Selbstbestimmung im Handeln erfolgt. Das Diskontinuum der Rechtsregeln ist so der Ort, an dem sich höhere Rechtsregeln geltend machen, die aus der diskontinuierenden Selbstsetzung folgen.
VIII
Wenn man Fichtes spekulative Grundlegung bejaht, scheint sein Argument eine schlüssige Version eines revolutionären Rechtssubjekts zu bieten. Doch der Schein trügt. Ein Einwand, der unmittelbar gegen Fichtes Revolutionstheorie erhoben wurde, lautet auf deren Verkürzung der praktischen Reichweite. Erhoben wurde er von Johann Benjamin Erhard, einem Kantianer mit jakobinischen Überzeugungen.
Erhard stand im Austausch mit den führenden Köpfen seiner Zeit: Schiller, Reinhold, Niethammer, Fichte, nicht zuletzt Kant selbst.[29] Seine Schriften gehören zu den wichtigsten Auseinandersetzungen mit der Französischen Revolution. Die Rezension von Fichtes Revolutionsbuch trifft zielsicher den entscheidenden Punkt: Fichtes Argument nimmt nur die Revolutionäre in Blick, nicht jedoch die, deren Gemeinwesen ohne ihr Zutun revolutioniert wird. Erhard bemerkt eine Zweideutigkeit in dem Ausdruck »eine Revolution bewirken«.[30] Der Ausdruck bedeutet einerseits: Menschen verändern ihre Regie37rung. Er bedeutet aber anderseits: Menschen verändern die ihnen mit anderen gemeinschaftliche Regierung. Im ersten Fall ist die Frage nach einem Recht auf Revolution sinnlos. Da es sich um nur ihre eigene Regierung handelt, haben die Menschen fraglos ein Recht auf deren Änderung, und die einzige sinnvolle Frage lautet: ist diese Änderung gut? Im zweiten Fall hingegen macht sich die Frage nach einem Recht auf Revolution geltend. Auch er ist nicht eindeutig. Sofern die Änderung der gemeinschaftlichen Regierung sich nur auf mich bezieht und keinen Einfluß auf andere hat, läuft dieser Fall auf meine Trennung vom Staat hinaus. Die Frage nach einem Recht auf Revolution fragt dann nach dem Recht auf Trennung des Einzelnen vom Staat. Sofern aber die Erhebung der geänderten Regierung zur neuen gemeinschaftlichen Regierung gemeint ist, geht es nicht mehr nur um meine Trennung vom Staat. Es geht auch um die Lebensweise anderer Menschen. Dann aber muß man die Folgen und Nebenumstände der Änderung der Regierung betrachten. Denn, so Erhard, »wenn ich für einen anderen handle, ohne daß er mit bestimmten Auftrag gibt, so verbürge ich ihm, daß die Folgen für ihn gut sein sollen.« Entsprechend lautet die Frage hier nicht nur, ob die Revolution recht, sondern auch, ob sie gut sei.
Diese Erwägung unterscheidet zwei Revolutionen: eine intransitive und eine transitive.[31] Die intransitive Revolution setzt den Satz »Ich mache eine Revolution« gleich dem Satz »Ich ändere die Grundsätze der Verfassung für mich um«. Das Recht auf sie ist das Recht des aktiven Teils, der die Revolution bewirkt. Die transitive Revolution wiederum setzt den Satz »Ich mache eine Revolution« gleich dem Satz »Ich ändere die Grundsätze der Verfassung für alle um«. Das Recht auf sie hat das Schicksal des passiven Teils, der die Revolution erleidet, 38zu berücksichtigen. Aus der Verwechslung der beiden Revolutionen entspringt ein unlösbarer Streit über das Recht auf Revolution. Wer auf die intransitive Revolution reflektiert, sucht das unveräußerliche Recht zu beweisen, nach sittlicher Einsicht zu handeln, und folgert aus ihm erfahrungsunabhängig das Recht auf Revolution. Wer hingegen die transitive Revolution bedenkt, sucht das Recht zu widerlegen, über andere etwas zu verfügen, zu dem sie nicht verpflichtet sind, und beweist hieraus und mittels der Erfahrung das Unrecht der Revolution. Da die Streitparteien von unterschiedlichen Sachen handeln, kann eine Einigung zwischen ihnen nicht erfolgen. Um das Recht auf Revolution zu entscheiden, ist daher zuerst ein angemessenes Verständnis der Revolution zu gewinnen, um die es geht.
Fichte aber kümmert sich genau darum nicht. Er betrachtet einseitig nur den aktiven Teil und setzt damit einfach voraus, daß die Revolution intransitiv sei. Erhard bindet dieses Vorgehen an die Perspektive der ersten Person Singular. Solange das »Ich« unser politisches Denken leitet, sind meine Rechte und Pflichten allein durch die vernünftige Reflexion bestimmbar. Sobald aber das »Wir« maßgeblich wird, muß der Revolutionär dessen sicher sein, daß er tatsächlich im Namen der anderen handelt. Das erfordert Kenntnis nicht nur »des Menschen«, dessen Begriff sich vernünftig entwickeln läßt. Es erfordert auch Kenntnis »der Menschen« — also Erfahrung ihrer tatsächlichen Beschaffenheit. Wie die Wissenschaftslehre zeigt, bildet den Grund von Fichtes Argument in der Tat das Ich. Es verbleibt daher notwendigerweise im Rahmen der intransitiven Revolution. Die Große Revolution in Frankreich aber war ersichtlich mehr als die Trennung eines Einzelnen vom Staat. Sie war eine transitive Revolution. Angesichts ihrer muß Fichtes Gedankengang fehlgehen. Keine transitive Revolution darf unternommen werden ohne empirische Kenntnis des Volkes, 39zu dessen Gunsten sie unternommen wird. Argumente a priori reichen hier nicht mehr aus. Sie müssen durch Argumente a posteriori flankiert werden. In Erhards auf Fichte bezogenen Worten: zur Rechtmäßigkeit der Revolution muß ihre Weisheit treten.[32]
Neben den Perspektivenwechsel vom »Ich« zum »Wir« und der damit verbundenen Erweiterung der erfahrungsunabhängigen Rechtmäßigkeit um die Weisheit der Erfahrung tritt ein zweiter Punkt. Fichtes Theorie beruht auf der Lehre vom Gesellschaftsvertrag. Erhard erweist diese Lehre als sinnlos. Ein Vertrag ist nur innerhalb eines Rechtszustandes denkbar, nicht außerhalb des Rechtszustandes zu dessen Einrichtung. Man hat daher die Lehre vom Gesellschaftsvertrag zu verabschieden. Für das Recht auf Revolution bedeutet das: es hat nichts mit dem Recht auf Vertragsauflösung zu tun. »Ist die bürgerliche Gesellschaft auf keinen Vertrag gegründet, so folgt, auch aus der Lehre der Verträge gar nicht, was sie für Rechte auf mich und ich auf sie habe.«[33] Statt dessen hängt das Recht auf Revolution allein an der Frage, ob das Gemeinwesen seine Bestimmung erfüllt. Diese Bestimmung sieht Erhard darin liegen, das Sittengesetz mittels positiver Gesetze in der Erfahrungswelt wirksam werden zu lassen.[34] Im Hintergrund steht die Kantische Theorie, daß der kategorische Imperativ ein von aller empirischen Materialität unabhängiges Gebot darstellt. Wie sein Gebot dann aber innerhalb der Erfahrungswelt wirksam zu werden vermag, bleibt unklar. Seine Wirklichkeit besitzt es im Gewissen, nicht aber in äußeren Handlungen. Um die Wirksamkeit des kategorischen Imperativs zu gewährleisten, bedarf es daher einer Normativität, die in die Erfahrungswelt sel40ber eingelassen ist. Eine solche Normativität errichten die positiven Gesetze des Gemeinwesens. Wenn sie im Bezug auf den kategorischen Imperativ stehen, dann wird folglich auch er in der Empirie verwirklicht. Und da der kategorische Imperativ ein unbedingtes Gebot ausspricht, besitzen die Gesetze zu seiner Verwirklichung unbestreitbare Geltung. Hiernach gründet sich die Rechtmäßigkeit des Gemeinwesens nicht auf einen Gesellschaftsvertrag, sondern auf seine Bestimmung, der ethischen Grundnorm eine empirische Gestalt zu verleihen.
Diese Bestimmung des Gemeinwesens versteht Erhard als ein Ideal in Kantischem Sinne. Für Kant stellt ein Ideal etwas Unbedingtes dar, dem kein Gegenstand in der Erfahrung zu entsprechen vermag. Unter praktischem Gesichtspunkt dient es zum Fluchtpunkt unseres Handelns.[35] Das Gemeinwesen, das die ethische Grundnorm zu empirischer Wirksamkeit bringt, stellt ein solches Ideal dar, weil jeder tatsächliche Staat hinter der Verwirklichung des kategorischen Imperativs zurückbleiben muß. Dessen unbedingtes Gebot vermag von den empirischen Bedingtheiten nie ganz verkörpert zu werden. Weil das Ideal aber zum Fluchtpunkt unseres Handelns dient, bildet es auch das Ziel unserer Vergesellschaftung. Um seinetwillen nehmen wir an der tatsächlichen Gesellschaft teil, um uns in seine Richtung zu bewegen. Daraus folgt ein entscheidender Grundsatz. Er ist etwas paradox formuliert und lautet: »Ich darf mich von der wirklichen bürgerlichen Gesellschaft nicht hindern lassen, mich zu einem Mitgliede der bürgerlichen Gesellschaft im Ideale auszubilden.«[36] Mich zu einem Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft im Ideal ausbilden: das bedeutet, daß ich deren Bestimmung zum Fluchtpunkt meines Handelns nehme. Die Bestimmung der bürgerlichen Gesellschaft besteht 41wiederum darin, die Grundnorm zur empirischen Wirklichkeit zu bringen. An solcher Verwirklichung darf mich keine tatsächliche Gesellschaft hindern. Deshalb gilt: »Handelt ein Staat dieser Bedingung zuwider, […] so ist er gar nicht mehr Staat, er ist eine Hölle, aus der sich die Menschen retten und sie zerstören sollen.«[37]
IX
Das hier angesprochene Recht auf Revolution begründet Erhard in einer eigenen Schrift. Deren Titel Über das Recht des Volks zu einer Revolution beinhaltet bereits die Lösung für das Problem einer transitiven Revolution. Sie lautet: das rechte Handeln des Volkes ist auch im Bezug auf andere Gruppen des Gemeinwesens recht, obwohl die Revolution eine Handlung darstellt, die ihre Folgen niemals überblicken kann. Der Gedankengang — entwickelt anhand Erhards eigener Methodologie, die hier außen vor bleiben muß[38] — verläuft wie folgt. Es gibt drei Klassen unveräußerlicher Menschenrechte: Rechte der Freiheit, Rechte der Gleichheit und Rechte der Selbständigkeit.[39]42Das befindet sich ganz im Einklang mit Kant, dessen politisches Denken ebenfalls auf Freiheit, Gleichheit, Selbständigkeit zielt.[40] Eine Revolution erfolgt nun mit Recht, wenn sie die Prinzipien der Regierung deshalb ändert, weil sie der Freiheit, Gleichheit, Selbständigkeit der Menschen zuwiderlaufen. Ja, in diesem Fall gibt es sogar eine Pflicht zur Revolution; denn es ist ein Gebot des kategorischen Imperativs, die Menschenrechte zu achten. Da die Rechte der Menschen nicht von einer bestimmten Gruppe verwaltet werden, hat ein jeder dieses Recht und diese Pflicht zur Revolution, sofern sein Gewissen ihm die staatliche Verletzung der Menschenrechte anzeigt. Im Rückblick auf die Rezension von Fichtes Revolutionstheorie und auf die Apologie des Teufels läßt sich das auch so sagen: ein Gemeinwesen, das zum Ideal der Bosheit neigt und dadurch die Menschenrechte verletzt, verfehlt seine Bestimmung, die Grundnorm zu verwirklichen, und darf daher von jedem Menschen ausgehend eine Revolution erleiden. So weit, so vertraut.
Diese Auffassung wird indessen um eine Analyse dessen erweitert, worin die Verletzung der Menschenrechte besteht. Hierzu unterscheidet Erhard zwei Begriffe des Volkes. »Volk« ist zum einen eine Menge von Menschen, die sich durch ihre Sitten von anderen Mengen sondert. »Volk« ist aber auch zum andern eine Gruppe von Menschen innerhalb des Gemeinwesens dieser Menschenmenge: die Gruppe, die von der Gruppe der Vornehmen (Gebietende, Priester, Gelehrte) als unmündig betrachtet und daher regiert wird.[41] Der zweite Begriff vom Volk bildet den Ansatz des Argumentes. Unmündigkeit ist ein Rechtsverhältnis, in dem das Mündel bestimmte Rechte nicht 43wahrnehmen kann. Entsprechend dient die Unmündigkeit des Volkes zum Rechtsgrund, den Regierten bestimmte Rechte zu verweigern. Sie stellt darum die entscheidende Verweigerung von Menschenrechten dar. Deren Verletzung ohne Rechtsgrund ist ein offenkundiges Unrecht. Beansprucht die Regierung hingegen ein Recht auf Verweigerung der Menschenrechte, etwa weil sie wirkungsvoller, kenntnisreicher oder verantwortungsvoller als die Regierten zu handeln vermag, so betrachtet sie diese als ihr Mündel. Mit Recht verweigert den Menschen ihre Rechte nur ihr Vormund.
Allerdings hängt das Rechtsverhältnis der Unmündigkeit vom Grad der geistigen Bildung ab. Ein Mensch, der zur Wahrnehmung seiner Rechte noch nicht geeignet ist, etwa ein Kind, bedarf eines Vormundes, der für ihn seine Rechte wahrnimmt. Hiermit hängen zwei Forderungen an den Vormund zusammen. Erstens darf er die Rechte des Mündels nicht verletzen, und zweitens muß er die geistige Bildung des Mündels zur Aneignung seiner Rechte befördern. Der Vorgang der Mündigung besteht dann darin, daß das Mündel Kenntnis über seine Rechte gewinnt und mit ihnen umgehen kann. Wenn nun dieses Rechtsverhältnis auf das Volk und die Vornehmen übertragen wird, dann treten auch die beiden Forderungen in Kraft. Das wiederum bedeutet, daß die Regierung die Menschenrechte der Freiheit, Gleichheit, Selbständigkeit für das Volk wahrnimmt, solange es noch nicht gebildet genug ist, und darum diese Rechte beachten sowie auf die Mündigung des Volkes abzielen muß. Entsprechend aber begeht eine Regierung, die es auf die fortdauernde Unmündigkeit des Volkes anlegt, »Hochverrath an der Menschheit«. Und es gilt: »Dem Volk bleibt […] das Recht nach der Mündigkeit zu streben, und seine Mündigkeit zu beweisen.« [42] Eben dieses Recht ist sein Recht auf Revo44lution. Wenn die Regierung die Unmündigkeit des Volkes dauerhaft zu erhalten strebt, dann hat dieses das Recht und die Pflicht zum Umsturz. Die Revolution ist somit nichts anderes als die Änderung der Verfassung des Gemeinwesens durch Gewalt, mit der sich das Volk in die Rechte der Mündigkeit einsetzt und das rechtliche Verhältnis zwischen sich und den Vornehmen aufhebt.[43] Hiermit erfahren alle entscheidenden Faktoren ihre Bestimmung im Kreis des Rechts. Die Verweigerung der Menschrechte durch die Regierung führt einen Rechtsgrund für sich an, und die Aneignung der Menschenrechte durch das Volk führt einen Rechtsgrund für sich an: das Verhältnis der Unmündigkeit. Dessen Analyse setzt das Recht der Regierung außer Geltung und das Recht des Volkes auf Revolution in Kraft, wenn jene dessen Unmündigkeit zu erhalten sucht.
Ein Gemeinwesen, zu dem eine Revolution des Volkes führt, kennt nur noch ein Volk im ersten Sinn: eine Menge von Menschen, die sich durch ihre Sitten von anderen Mengen sondert. Das Volk im zweiten Sinn, das Mündel regierender Vormünder, hingegen hat sich in ihm aufgehoben. Auf diese Weise erhält der »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«[44], von dem Kant spricht, eine neue Wendung. Kant beschränkt ihn auf die öffentliche Debatte der Gelehrten und sagt vom bürgerlichen Amt: »Hier ist es nun freilich nicht erlaubt, zu räsonniren; sondern man muß gehorchen«,[45] hoffend, daß die öffentliche Debatte das gehorchende Volk zum freien Handeln fähiger macht. Erhard hingegen schaut sich das Rechtsverhältnis der Unmündigkeit genauer an. Sobald 45





























