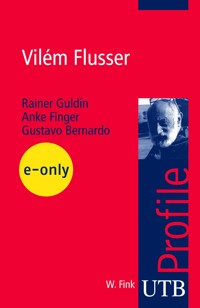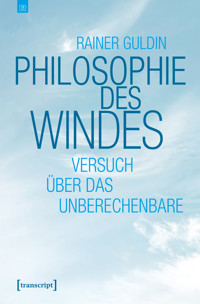
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition transcript
- Sprache: Deutsch
Der Wind ist fast immer und überall in irgendeiner Form anwesend, er umspielt und umfasst uns von allen Seiten und versetzt unsere Welt in stetigen Austausch. Rainer Guldin wirft einen philosophischen Blick auf das Phänomen Wind und zeigt, wie eng unsere körperliche und emotionale Eingebundenheit in die uns umgebende Wetterwelt eigentlich ist. Der Wind ermöglicht eine Erweiterung und Reorientierung unserer Wahrnehmung auf das Ungreifbare und Fluide, aber auch das Grenzüberwindende hin: So entsteht eine Erkenntnistheorie der Unberechenbarkeit und Verbundenheit, die Dualismen zu überwinden versucht. Das Buch spricht nicht nur Philosoph*innen an, sondern auch Laien und Forschende verschiedenster Disziplinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rainer Guldin
Philosophie des Windes
Versuch über das Unberechenbare
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 transcript Verlag, Bielefeld
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Umschlagabbildung: Stefan Schweihofer / Pixabay
Korrektorat: Antonia Wind, Freiburg
Print-ISBN 978-3-8376-6843-8
PDF-ISBN 978-3-8394-6843-2
EPUB-ISBN 978-3-7328-6843-8
https://doi.org/10.14361/9783839468432
Buchreihen-ISSN: 2626-580X
Buchreihen-eISSN: 2702-9077
Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de
Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Einführung
1. Meteore: Figuren der Ambivalenz
2. Vom Wind und den Winden: Einzahl und Vielzahl
3. Windpersonifizierungen: Engel und Dämonen
4. Luftmeer: Flüsse und Strömungen
5. Von Winden und Wolken: Himmelsschlacht und Möglichkeitsfeld
6. Die Sprachen des Windes: Übertragung und Übersetzung
7. Der Atem der Welt: Wind und Körper
8. Der Wind des Wahnsinns: Plötzlichkeit und Exzess
9. Der Wind des Nomadischen: Politik und Kommunikation
10. Windanmut: Klima und Kultur
Schlusswort
Literaturverzeichnis
Film- und Abbildungsverzeichnis
»Anemophile (griech. anemos – ›Wind‹, phileo –, ›ich liebe‹) […]. Die A. ziehen den Wind stets seiner Abwesenheit vor, selbst wenn es sich um den stärksten Sturm handelt. […] ›Als Anemophiler gilt ein Mensch, der unabhängig von Alter, Geschlecht, Denkart oder sozialer Stellung sein Leben ändern möchte, ohne daß ihn die Bedingungen der Vergangenheit bedrücken und der sich gleichstellt mit dem Wind, der immer Veränderungen mit sich bringt.‹«
Ivetta Gerasimchuk, Wörterbuch der Winde
Einführung
»How easily the weather lends itself to metaphorical interpretations.«
Arden Reed, Romantic Weather
Der Wind ist fast immer und überall in irgendeiner Form anwesend, umspielt und umfasst uns1 von allen Seiten. Dennoch nehmen wir ihn nur noch selten bewusst wahr. Er kommt meist erst dann in unser Blickfeld, wenn er stört oder seine Stärke ein gewisses Niveau überschreitet. Eine Beschäftigung mit dem Wind zeigt, wie eng unsere körperliche und emotionale Eingebundenheit, in die uns umgebende Wetterwelt eigentlich ist. Denn jedes Mal, wenn wir Ein- oder Ausatmen, durchbrechen wir die Grenze zwischen dem Körper und der Welt und diejenige zwischen Himmel und Erde. Eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Wind ermöglicht darüber hinaus eine Erweiterung und Reorientierung unserer Wahrnehmung vom Visuellen und der Welt der soliden Gegenstände auf das Ungreifbare und Unsichtbare hin, auf das Stille oder kaum Hörbare, aber stets Gegenwärtige. Der Wind hat mit dem Geistigen und Spirituellen zu tun. Das Irritierende und zugleich Inspirierende des Windes liegt darin, dass er sich dem Körper zwar aufdrängt, dem Be-greifen aber entzieht. Winde sind grundsätzlich unberechenbar. In ihrer programmatischen Einführung zu einem interkulturellen und interdisziplinären philosophisch orientierten Studium des Windes schreiben dazu Chris Low und Elisabeth Hsu: »Wind is both felt and tangible, and thus physical and elusive, as is the spiritual. It comes as no surprise, therefore, that ideas of wind persistently overlap with notions of spirit, divinity, breath, smell, and shadow. These concepts work together in a family of resemblances to inform ontology and epistemology.« Eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Wind führt zu den zentralen Fragen der Philosophie zurück, »the big questions of life that have occupied philosophers since the earliest documented records.«2
Aufgrund der vom Menschen verursachten Klimaveränderungen, deren destruktive Auswirkungen sich in den letzten Jahren immer deutlicher spürbar gemacht haben, hat der Wind in der öffentlichen Wahrnehmung eine zunehmend existenzgefährdende Gestalt angenommen. Stürme brechen Äste ab, entwurzeln Bäume, fegen mit hoher Geschwindigkeit über Wälder und Felder hinweg und hinterlassen Schneisen der Verwüstung. Orkane zerfetzen Segel, peitschen die Meereswogen hoch und bringen Schiffe zum Kentern. Die Sogwirkung des Windes führt dazu, dass abgedeckte Dachziegel und wegfliegende Gegenstände durch die Luft wirbeln. Das destruktive Verhalten des Windes, das sich wegen seiner Unberechenbarkeit noch verstörender gestaltet, und die davon ausgehende Bedrohung für Leib und Leben haben dazu geführt, dass – wie bei Wetterphänomenen im Allgemeinen – auf Metaphorisierungen zurückgegriffen wurde. Die zwei folgenden Beispiele beschreiben den Wind in den verwandten Metaphern der zerstörerischen Wut und der entfesselten Wildheit.
In L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement beschreibt Bachelard den Wind aus der personifizierenden Perspektive des Zorns. Der Wind ist eine agierende Person, mit einem eigenen geheimnisvollen unerklärlichen Willen. »Man könnte sagen, dass der wütende Wind das Symbol der reinen Wut ist, einer Wut ohne Objekt, ohne Vorwand […]. Der Wind ist in seinem Übermaß ein Zorn, der überall und nirgends ist, aus sich selbst geboren und wiedergeboren wird […].«3 Die Gegenstands- und Grundlosigkeit des Windes steht hier zugleich für dessen Ungreifbarkeit und Unvorhersehbarkeit.
Hunt beschreibt in seinem Reisebericht Where the Wild Winds Are. Walking Europe’s Winds from the Pennines to Provence einige der bekannteren europäischen Winde: den Helm, den Mistral, den Föhn und die Bora. Der Helm, der einzige Wind in England, der einen Namen trägt, weht von Osten nach Westen über das 400 km lange Mittelgebirge der Pennines hinweg, das in Cumbria, im Nordwesten des Landes, an der Grenze zu Schottland liegt. Es ist ein heftiger, oft tagelang wehender Wind, der manchmal wie ein Schnellzug vorbeirauscht und von der Formation einer dichten länglichen Wolkenkappe, der Helm Bar, begleitet wird. Hunt verbindet die Wildheit des Windes mit der rauen dünnbesiedelten Landschaft und den über die Grenze hinweg operierenden reivers, die bis ins 17. Jahrhundert plündernd und brandschatzend über die Gegend und ihre Einwohner herfielen. »This was my first intimation of what would become a strong theme on these walks: highlands have always been the home of wild winds and wild people.«4In dieser Beschreibung wird dem Wind ein anarchisches Potential attestiert, das mit einer bestimmten Landschaft und Menschengruppe verbunden wird. Im Gegensatz zu Bachelard, der das Beunruhigende und Unergründbare des Windes hervorhebt, geht es hier auch um ein implizites Versprechen von Freiheit. Die beiden Metaphorisierungen verdeutlichen das breite Spektrum der möglichen Verwendungsweisen des Windes als Metapher und weisen zugleich auf etwas Grundlegenderes und Verbindendes hin.
Winde sind für Wetterumschwünge verantwortlich. Sie können einen wolkenverhangenen Himmel leerfegen und eine neue Wolkenfront vor sich hertreiben, für weniger Luftfeuchtigkeit sorgen und einen Temperatursturz herbeiführen. Der Wind ist in diesem Sinne ein vielfaches Prinzip der Verwandlung und Veränderung, wie Ivetta Gerasimchuk im Motto festhält, das diesem Buch vorangestellt worden ist. Diese Vorstellung, die transkulturelle und transhistorische Bedeutung besitzt, hat auch den Umgang mit dem Wind in der chinesischen Kultur entscheidend geprägt. »To ponder winds«, schreibt dazu Shigehisa Kuriyama, »was to contemplate the mystery of change. This is the theme that runs throughout the history of the Chinese imagination of wind. Winds foreshadow change, cause change, exemplify change, are change. ›Wind is movement‹.«5 Veränderungen gehen auch in der chinesischen Kultur mit einem Moment des Chaotischen und nicht Voraussehbaren einher: »[…] the character of all winds, inner or outer, was that they always retained some chaotic contingency, the possibility of suddenly blowing in new and unexpected directions.«6
Obwohl der Wind eine destruktive, unkontrollierbare Kraft darstellt, ist es immer wieder gelungen, seine Energie erfolgreich zu zähmen und nutzbar zu machen. So versetzen Winde Mühlenflügel in Bewegung und treiben Segelschiffe über den Ozean. In diesem Sinne stellen in der gegenwärtigen Wahrnehmung des Windes die Windenergieanlagen eine bedeutungsvolle Gegenposition zur entfesselten Destruktivität der Winde dar. Man findet sie in ausgedehnten Landflächen mit geringen Höhenunterschieden, in unmittelbarer Küstennähe oder in erheblichem Abstand davon, wo sie emsig und lautlos dafür sorgen, dass der Wind eingefangen und verwertbar gemacht wird. Auch hier stößt man auf Metaphorisierungen. Die alternativen Bezeichnungen ›Windpark‹ und ›Windfarm‹ deuten auf die architektonische und landwirtschaftliche Bedeutung des Vorganges hin. ›Gewachsene‹ Windparks entstanden durch die räumliche Nähe nacheinander errichteter Anlagen. Die einzelnen Windräder stehen dabei nebeneinander wie in regelmäßigen Abständen hingepflanzte Bäume in einem Obstgarten. Der Wind wird eingesammelt und eingefahren, als ob es um eine Ernte ginge. Damit ist auch die radikale, unlösbare Ambivalenz des Windes benannt, die nicht nur für die westliche Kultur von Anfang an bestimmend war: Winde können verheerend sein oder nützliche Dienste erbringen. Winde befruchten oder sind Boten des Todes.
Diese dichotomische Wahrnehmung des Windes, die zwischen Anemophilie und Anemophobie oszilliert, überspielt eine ganze Reihe von feineren Zwischentönen, denen in diesem Buch nachgespürt werden soll. Das Manifestationsspektrum reicht von Windstille und Flaute, über zögerliche Luftbewegungen, zu Durchzug und Zugluft, sanften Brisen, stärkeren Luftströmungen und steifen Brisen, bis hin zu Sturmböen, Wirbelstürmen, Blizzards, Orkanen, Taifunen und Zyklonen. Ebenso vielfältig ist das Bedeutungsspektrum des Windes, das je nach Epoche und Kultur nicht nur meteorologische Prozesse im modernen Sinne des Wortes, sondern auch Erdbeben und Atmungsvorgänge umfasste. Wie die folgenden Kapitel zeigen sollen, hat diese kontinuierlich changierende Mannigfaltigkeit, zusammen mit seiner Unsichtbarkeit und Ungreifbarkeit, den Wind zu einer radikalen Herausforderung an das Denken gemacht, was zu unterschiedlichen theoretischen Zähmungsversuchen und vielfachen Formen der Metaphorisierung geführt hat. Aber nicht nur der Wind selbst, sondern auch der Umgang damit, kann zur Metapher werden.
Wind und Metapher
In Platons Phaidon (99e4-100a3) ist die Rede von der zweitbesten Fahrt (deuteros plous, δεύτερος πλοῦς), ein Begriff aus der Seefahrt, wenn der Wind versagt und man gezwungen ist zu rudern. Nach dem Wind zu segeln, ist schneller und weniger mühevoll, die zweitbeste Fahrt dagegen langsamer und anstrengender. Von den Seeleuten verlangt sie jedoch, dass sie sich tapfer ins Zeug legen. Das verfolgte Ziel bleibt in beiden Fällen dasselbe, aber die eingesetzten Mittel auf dem Weg dorthin sind grundsätzlich verschieden. Diese Gegenüberstellung dient als eine doppelte Metapher für den Prozess der Erkenntnis. Der erste Weg ist zwar der einfachere und direktere, aber er birgt auch Gefahren in sich. Wenn man allein mit Hilfe der Sinne die Wahrheit der Dinge zu erfassen versucht, kann das unter Umständen zur Blindheit der Seele und zur vollständigen Unwissenheit führen. Der zweitbeste Weg dagegen ist zwar schwieriger, mühseliger und indirekter, aber dadurch auch sicherer. Man gelangt ans Ziel in einem Zustand gesteigerter Wachsamkeit. Dieser Weg vermeidet die direkte sinnliche Wahrnehmung und vertraut auf die logoi, die Gedanken, die Begriffe. Die vorsokratischen Naturphilosophen haben den ersten Weg ausgewählt, und die Rhetoriker und die Sophisten, die sich von ihren Geschichten treiben lassen, sind ihnen auf diesem Weg gefolgt. Wer auf der zweitbesten Fahrt unterwegs ist, lässt sich nicht von täuschenden Bildern, von Tropen und Metaphern verführen, sondern vertraut auf klare Begriffe. Die fleißig rudernden Philosophen leisten mühsame Arbeit am Begriff. Wer segelt, statt zu rudern, hingegen, baut auf den unberechenbaren Wind und ist ihm dadurch auch ausgeliefert. Ein Segelschiff lässt sich zwar steuern, der Wind aber kann plötzlich umschlagen, den Seeleuten ins Gesicht blasen, sich in Sturm verwandeln oder abrupt aussetzen. Winde sind unvorhersehbar. Die Griechen zur Zeit Platons beherrschten noch nicht die Kunst, gegen den Wind zu kreuzen, was wohl die Vorstellung des Ausgeliefertseins zusätzlich verstärkt hat.
Dieses Beispiel zeugt von der frühen Verbindung zwischen Wind und bildhaftem Denken und dem Windhaften von Metaphern im Allgemeinen. Der Wind kann daher auch als eine Metapher für die Metapher benutzt werden. Wenn man in Metaphern denkt, so läuft die Überlegung in Platons Phaidon, verliert man zum Teil die Kontrolle über die eigene Wahrnehmung. Metaphern wuchern hemmungslos und schießen ins Kraut. Das Denken beschleunigt sich und die Evidenz des Bildhaften nimmt überhand. Metaphern beflügeln das Denken und die Fantasie, sie inspirieren, so wie der Wind die Segel eines Schiffes bläht, aber sie verführen auch zu voreiligen Verkürzungen und Übertreibungen. Metaphern haben etwas Windiges, Flüchtiges, sie sind ephemer und eigenwillig wie Böen. Das Denken kommt in der Metapher nur scheinbar zur Ruh, tatsächlich überschießt es dauernd sein Ziel. Der Begriff verlangsamt und zwingt zum Nachdenken. Der Wettercharakter von Metaphern verweist dabei auf ein viel grundlegenderes Problem. Es verdeutlich die Tücken des Terminologischen und die definitorischen Schwierigkeiten, denen man begegnet, wenn es darum geht, schwer begreifbare Phänomene, die den Netzen des begrifflichen Denkens zu entschlüpfen drohen, in Worte zu fassen. So wie der Wind einem durch die Finger gleitet, wenn man ihn zu ergreifen versucht, entziehen sich auch Metaphern einer eindeutigen Bestimmung.
In der europäischen Tradition wird die Metapher bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als sekundär und ornamental betrachtet. Es wird ihr eine untergeordnete Rolle im Verhältnis zum begrifflichen wissenschaftlichen Denken zugewiesen. Der Gebrauch von Metaphern wird in diesem Sinne als charakteristisch für eine noch vorwissenschaftliche Position bestimmt. Metaphern können bereits klar formulierte oder in wissenschaftliche Erkenntnisse überführbare Vorstellungen vereinfacht und verdichtet anschaulich wiedergeben. Sie können helfen, das zu erklären, was noch nicht klar, schwer zu erklären oder nur intuitiv wahrgenommen wird. Als vorwissenschaftliche Bilder können sie zum Nachdenken anregen, ihre diskursive Relevanz bleibt aber letztlich hinter dem Begrifflichen zurück.
Diese Vorstellung wurde von Max Black, George Lakoff, Mark Johnson und Hans Blumenberg in Frage gestellt. Diese Autoren haben gezeigt, dass Metaphern nach systematischen Kriterien operieren, ein heuristisches Potential besitzen und sich nicht einfach dem Begrifflichen gegenüberstellen und unterordnen lassen. Metaphern beleben und dynamisieren das begriffliche Denken. Selbst Platon, der dem bildhaften Denken und der Metapher eine Absage erteilt, greift immer wieder darauf zurück, wenn das begriffliche Denken ins Stocken gerät. Metaphern haben grundlegend Modellcharakter. Sie aktivieren einen Erkenntnisprozess, der Ähnlichkeiten erzeugt, ein Beziehungsnetz entwirft und dadurch auch völlig neue Einsichten ermöglicht. Wie Max Black festhält: »Every metaphor is the tip of a submerged model.«7Metaphern zeichnen nicht nur vorhandene Beziehungen nach, sondern generieren neue Perspektiven. In diesem Sinne verfügen sie über ein innovatives und kreatives epistemologisches Potential. Metaphern kommen besonders dann zum Einsatz, wenn ein Phänomen – wie z. B. der Wind – wegen seiner Unvorhersehbarkeit und Ungreifbarkeit schwer erfassbar und einem Verständnis nicht unmittelbar zugänglich ist. Metaphern können abstrakte Realitätssauschnitte veranschaulichen.
Traditionell wurden Metaphern als simple statische Entsprechung zwischen zwei Begriffen behandelt. Ein klassisches Beispiel aus der antiken Rhetorik ist die lachende Wiese Quintilians. Hier wird die Frische der Wiese im Bild eines lachenden Gesichts eingefangen. Diese punktuelle Deutung von Wort zu Wort aufgrund einer einzigen Verbindung geht jedoch am Ziel vorbei und reduziert die Komplexität des Phänomens. Black spricht daher von einem »system of associated commonplaces«, einem »implicative complex«, bei dem die beiden Begriffe – in Lakoff und Johnsons Terminologie die source domain und die target domain – zu einem vielschichtigen reziproken Beziehungssystem verbunden werden. Dabei wird eine Reihe von Attributen aus der source domain auf die target domain übertragen. Lakoff und Johnson nennen diesen Vorgang des Projizierens mapping, was das Dynamische des Prozesses betont. Die beiden Autoren unterscheiden zudem zwischen einer internal und einer external systematicity. Im ersten Falle geht es um die innere Kohärenz einzelner Metaphern und im zweiten um die Kohärenz miteinander verbundener Metaphern, die in einem Cluster zusammenfinden. In beiden Fällen gibt es eine innere Ordnung, die den Vorwurf des Beliebigen und Unkontrollierten widerlegt. Wie beim Wind geht es auch hier nicht einfach um Unordnung und Beliebigkeit, sondern um eine andere Form der Komplexität. Metaphorisierungsprozesse sind zudem grundlegend reversibel. So können die dem Wind metaphorisch zugeschriebenen Attribute, seine Geschwindigkeit, Leichtigkeit und Wildheit, seine Ungreifbarkeit und Unvorhersehbarkeit, ihrerseits wieder als Metaphern verwendet werden. In diesem Sinne ist der Wind eine Metapher für Wahrnehmungs- und Denkprozesse, für Veränderungen und Bewegungsabläufe, für Gefühl und Wahnsinn sowie für politische Freiheit und Vorgänge der Kommunikation.
Wind und Wetter
Eine Philosophie des Windes ist auch eine Philosophie des Wetters. Die alliterierende Doppelformel ›Wind und Wetter‹ ist eine Gesamtbezeichnung für alle Wettervorgänge. ›Wetter‹ kommt vom Mittelhochdeutschen wetar und hat dieselbe indogermanische Wurzel wie ›wehen‹ und ›Wind‹. Der Wind wird oft als Synekdoche des Wetters betrachtet, er verkörpert dessen wesentliche Aspekte und dies deutlicher als andere Wetterphänomene wie z. B. Regen, Schnee oder Wolken. Das hat seine Gründe. Schon in Aristoteles’ Meteorologie stellen die Winde das Kernstück dar, von dem aus die anderen Wetterphänomene angegangen werden. Dasselbe gilt auch für Lukrez’ De rerum natura und Senecas Naturales quaestiones, die dem Wind und den damit assoziierten Phänomenen eigenständige Kapitel widmen. Reine Windtrakte gibt es bis ins 17. Jahrhundert hinein, zum Beispiel Francis Bacons The Natural and Experimental History of the Winds. Selbst in Jean-Baptiste de Lamarcks Annuaires Météorologiques aus dem frühen 19. Jahrhundert wird dem Wind die zentrale Rolle als Wettermacher zugeschrieben.
Wie Wetterphänomene im Allgemeinen sind auch Winde unbeständig, veränderbar und ephemer. Winde blasen kontinuierlich oder diskontinuierlich, nehmen an Stärke zu oder lassen nach und ändern abrupt ihre Richtung. Ein plötzlicher unerwarteter Windstoß kann alles durcheinanderbringen. Der Wind ist nicht nur überall, er kann, wie Wasser, überall hingelangen, alles berühren und miteinander in Verbindung bringen. Winde können einander verstärken oder sich gegenseitig in die Haare geraten. Darüber hinaus ist der Wind unsichtbar und ungreifbar, ein zwischen Himmel und Erde angesiedeltes Phänomen, ein hybrides Gemisch und Gemenge wie alle anderen Wetterphänomene auch.
Die Erscheinungen der Atmosphäre stellen einen besonderen Bereich der Natur dar, der nur in Ausschnitten und nur unvollständig erfassbar ist. Wetterphänomene tauchen darüber hinaus nicht allein, sondern zusammen auf, durchdringen und bedingen sich gegenseitig. Das Wetter im Allgemeinen und der Wind im Besonderen stellen in dieser Hinsicht in vielfacher Art und Weise eine Herausforderung an das Denken dar. Hier geht es nicht nur darum, etwas Abstraktes und schwer Überschaubares zu veranschaulichen und dadurch dem Verständnis näher zu bringen, sondern auch darum, das Unsichtbare zuerst einmal in eine gewisse Sichtbarkeit zu überführen. Der Wind stellt wie die spirituelle Welt, mit der er signifikanterweise in eins gesehen wurde, eine Extremposition für Prozesse der Metaphorisierung dar. Durch seine Unsichtbarkeit, Un(be)greifbarkeit und diffuse ephemere Natur spottet er jeder klaren Einteilung und Kategorisierung. Die Metaphern, die für den Wind verwendet worden sind, stellen nicht nur einen Spezialfall für Metaphorisierungsprozesse dar, sondern führen diese auch an ihre terminologischen Grenzen. Wie Arden Reed im vorangestellten Motto festhält, ist bei der Beschreibung von Wind und Wetter immer wieder fast gezwungenermaßen auf Metaphern zurückgegriffen worden, auch weil die beiden Bereiche zahlreiche Affinitäten aufweisen. Michel Serres geht sogar von einer grundsätzlichen strukturellen Ähnlichkeit zwischen Wetterphänomenen und Metaphern aus. Aber davon mehr in Kapitel eins.
Eine Philosophie des Windes
Dies ist weder eine Kulturgeschichte des Windes noch eine umfassende historische Wetterkunde. Es ist auch keine systematische Untersuchung der Art und Weise, wie der Wind im Laufe der Geschichte in der Literatur, der bildenden Kunst, der Fotografie und dem Film dargestellt wurde, auch wenn im Folgenden auf diese Bereiche mehrfach zurückgegriffen wird. Eine metaphorisch ausgerichtete Philosophie des Windes ist vielmehr der Versuch, die Denk(un)möglichkeiten zu erkunden, zu denen dieses Phänomen Anlass gibt. Welches ist die erkenntnistheoretische Relevanz der Metapher des Windes? Was sagt der Wind über uns und unser Verhältnis zur Welt aus? Welche Realitätsbereiche können anhand der Metapher des Windes anders oder neu gedacht werden? Lässt sich damit so etwas wie eine zusammenhängende Philosophie des Windes herausarbeiten?8
Vier Momente, deren Verhältnis sich im Laufe der Zeit verschoben hat, sind für die gesamte hier untersuchte philosophische Tradition des Westens von Bedeutung: der Wind als empirisches Phänomen, die Metaphorisierungen des Windes, die Verbindung der Metapher des Windes zu anderen Wettermetaphern und zu verwandten, teilweise gegenläufigen Metaphern, und schließlich der Gebrauch des Windes als Metapher. Dies impliziert eine Reihe von Fragen: Wie entwickelt sich das empirische Verständnis des Windes? Welche Metaphern werden verwendet, um des unsichtbaren ungreifbaren Windes habhaft zu werden? Welche Beziehung besteht zwischen der Metapher des Windes und anderen Wettermetaphern, zum Beispiel der Metapher der Wolke? Wie verhält sich der Wind zu anderen Metaphern der Philosophie aus dem Bereich der Natur, z. B. das Meer oder die Metapher des Fließens? In welchen Bereichen wird die Metapher des Windes eingesetzt und zu welchen Zwecken? Und schließlich: Was sagt die Metapher des Windes über Prozesse der Metaphorisierung im Allgemeinen aus? Was ist am Phänomen Wind besonders spannend für eine Theorie der Metapher? Kann man die Metapher des Windes (und des Wetters ganz allgemein) als eine mögliche Metapher für Metaphern verstehen?
Diese Philosophie des Windes ist ein Versuch, die Überlegungen von fünf Autoren zu Wind und Wetter zusammenzuführen, um zwischen ihnen einen theoretischen Dialog zu eröffnen. Zu den schon erwähnten Arden Reed und Michel Serres kommen noch Tim Ingold, Vilém Flusser und Ryōsuke Ōhashi hinzu. Die fünf Autoren nehmen keinen expliziten Bezug aufeinander. Die einzige Ausnahme stellt dabei Arden Reed dar, dessen umfassende Meteorologisierung von Literatur und Sprache auf Serres’ naturwissenschaftlich inspirierte Philosophie der Gemenge und Gemische zurückgeht. Trotzdem bestehen zwischen dem Denken der einzelnen Autoren vielfältige Beziehungen. Ihr Werk wird durch einen gemeinsamen vielgestaltigen Lufthauch animiert. So findet sich Ingolds dynamische weather-world, die sich einem dualen Verständnis der Welt als Gegensatz von Boden und Luft, Himmel und Erde widersetzt, wenn auch in abgewandelter Form, in Flussers kommunikationstheoretischer und anthropologischer Vision einer neuen nomadischen Bodenlosigkeit wieder. Die interkulturelle Perspektive des japanischen Philosophen Ryōsuke Ōhashi, die westliche und fernöstliche Philosophie zusammenbringt, fügt dem Denken der anderen vier Autoren eine ergänzende außereuropäische Perspektive hinzu. Ein interkulturelles Interesse ist auch in den Texten Ingolds festzustellen, der anthropologische und ethnologische Quellen einsetzt, um den spezifisch europäischen Umgang mit Wind und Wetter zu hinterfragen.
Serres’ Philosophie der Meteore, die er vor allem im Laufe der 1970er Jahre entwickelte, geht von einer meteorologisch inspirierten Neudefinition der Beziehung von Chaos und Ordnung aus und entwickelt anhand von Wind und Wetter eine alternative Vorstellung von Raum und Zeit und eine damit verbundene Philosophie der Flüsse und Turbulenzen. Reed untersucht die Bedeutung des Wetters im Werk von Coleridge und Baudelaire. Er benutzt das Klima als Metapher für den Text, die Identität eines Autors, den Schreibprozess und die Deutungsarbeit des Literaturkritikers: »[…] my topic cannot be confined to the weather in the text, because the text itself may be already a kind of weather.«9 Sein Interesse gilt dabei vor allem der Metapher des Dunstes, die mit Flussers und Serres’ Gebrauch der Wolken-Metapher verwandt ist.
Ingolds phänomenologischer und anthropologischer Ansatz stellt das körperliche Erlebnis in den Mittelpunkt. Sein Begriff des Mediums ist mit Serres’ globalen Flüssen und Flussers Begriff der Bodenlosigkeit verwandt. Wie Serres verwendet auch Flusser Wind und Wolke als Metaphern für die Lebenswelt der Gegenwart. Die Wolke steht dabei für die neue Instabilität und Fluidität des Subjekts und des Objekts und der Wind für eine neue nomadische Existenzweise im Zeitalter der digitalen Informations- und Kommunikationstheorie. Seine Gegenüberstellung von sesshaften und nomadischen Lebensformen wiederum erinnert an Ingolds animistisch inspirierten Unterschied zwischen exhabitant und inhabitant. Ōhashi untersucht den Wind-Begriff in der japanischen Kultur und vergleicht diesen mit der Windvorstellung in der westlichen Tradition. Alle fünf Autoren benutzen das Meteorologische als Grundlage für eine Denkweise, die nicht trennt und ausgrenzt, sondern mehrfach verbindet und vermischt.
Über den Wind schreiben
Wind-Monographien sind auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema und den damit verbundenen Darstellungsschwierigkeiten umgegangen. So finden sich neben linear und kumulativ strukturierten Texten auch solche, die durch Einschübe und Abschweifungen der Unvorhersehbarkeit des Windes Rechnung tragen.
Das 1940 publizierte L’homme et le vent10des in Lausanne geborenen Geographen und Geologen Edgar Aubert de la Rüe betont zu Beginn die unlösbare Ambivalenz des Phänomens. Der Wind ist eine beachtliche unberechenbare natürliche Kraft, vor der man sich schützen muss, die man aber auch zu eigenen Zwecken nutzen kann. Dies bedingt auch die Gesamtstruktur des Buches. Der Wind ist eine wichtige Energiequelle für Windmühlen, Segelschiffe und die Luftfahrt. Die ersten Kapitel entwickeln eine Windtypologie aus geographischer und meteorologischer Sicht. Es folgen Kapitel über den physikalischen Einfluss des Windes auf das Klima und die Physiologie des Menschen. Der Wind hat unterschiedliche Wohnformen und Strategien, um Felder und Wälder zu schützen, hervorgebracht und ist ein wichtiger Transfer-Agent. Das vorletzte Kapitel fasst Vor- und Nachteile des Windes noch einmal zusammen und das letzte trägt auf knapp vier Seiten unterschiedliche Mythen und Legenden aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen.
Xan Fieldings Aeolus displayed - a Book of Winds und Lyall Watsons Heaven’s Breath. A Natural History of the Wind, das 2019 neu aufgelegt wurde mit einem Vorwort von Nick Hunt, auf den ich in dieser Einführung schon hingewiesen habe, sowie Jan DeBlieus Wind. How the Flow of Air Has Shaped Life, Myth & the Land11, gehören inzwischen zur Standardliteratur, besonders die letzten zwei. Fielding, der sich vor allem mit den mythischen Dimensionen des Windes aus der griechischen und römischen Antike beschäftigt, stellt diese den exakten Erkenntnissen der modernen Meteorologie gegenüber. Abergläubische Windbeschwörungen und die obsessive Suche nach Zeichen und Omen stehen hier in ihrer angeblichen Naivität den Gewissheiten der Gegenwart gegenüber und dies, obwohl die verwendeten Metaphern oft von verborgenen Kontinuitäten zeugen. Fielding beschreibt sein Werk als eine »Pilgerreise« die vom »Eifer eines Alchemisten auf der Suche nach dem Stein der Weisen«12 angetrieben wird. Die einzelnen Kapitel reihen sich lose und oft unverbunden aneinander und das zusammengetragene Material folgt weitgehend einer kumulativen Logik.
Hunt beschreibt Watsons Buch in der Einführung als einen Windschlauch. Äolus, »the Keeper of the Winds«, hatte dem Odysseus auf seiner Heimfahrt nach Ithaka die in einem Sack gefangenen Winde mitgegeben mit dem strikten Hinweis, diesen unter keinen Umständen zu öffnen, sondern sich für die Rückreise allein auf die sanft wehende günstige westliche Brise zu verlassen. Als die Matrosen diesem Gebot zuwiderhandelten, drangen die entfesselten Winde hervor und trieben die Schiffe kurz vor der Ankunft wieder zu Äolus’ Insel zurück, worauf zehn Jahre der Irrfahrt folgten. Hunt deutet diese Warnung, die mit der zutiefst beängstigenden Natur des Windes zusammenhängt, in einem positiven Sinne um. »The book in your hands is that oxhide sack. All the winds of the world are inside. If you open it, you will be blown to places you never expected. […] We are blown from the macro to the micro, often in the space of a single page […] for wind has always blown inside the human imagination […] invisible yet tangible.«13Der Leser soll durch eine »sinuous journey«, einen verschlungenen Pfad, durch das Buch geführt werden. Hunt spricht in diesem Zusammenhang auch von Watsons »delight in the meander.«14
Wie der Titel schon präzisiert, geht es dem aus Südafrika stammenden Watson vor allem um die Bedeutung des Windes in den Naturwissenschaften, von der Physik und der Geographie, über die Biologie, die Botanik und die Zoologie, hin zu Physiologie, Chemie und Philosophie. Watson definiert Menschen verkürzend als »essentially tropical animals«.15 »As a species, we seem to have a high awareness and surprisingly low tolerance of the wind.«16Im Gegensatz zu Hunts Metapher weist das Buch eine deutlich artikulierte strenge Struktur auf, deren Gesamtnarrativ von einer kosmischen zu einer anthropologischen Perspektive hinführt. Der Wind, so Watson, »is far from hollow. It is the most vital of metaphors.«17Diese Behauptung bleibt leider aber weitgehend Programm. So schließt das Buch mit einer »Philosophy of the Wind«, die wie schon bei Aubert de la Rüe verschiedene Mythologeme aus unterschiedlichen Kulturkreisen lose versammelt, ohne auf deren gemeinsamen metaphorischen Gehalt einzugehen.
Jan DeBlieu, die sich auf Fielding und Watson bezieht, hat eine hybride Textform gewählt, die persönliche Erfahrungen und beschreibende Passagen miteinander verwebt. Im Gegensatz zu den anderen hier diskutierten Texten löst sie damit eine der zentralen Forderungen Serres’ und Ingolds ein, die, wie noch zu zeigen sein wird, die körperliche Erfahrung des Windes mit der theoretischen Vision zu verbinden versuchen. Die amerikanische Autorin DeBlieu lebt auf den Outer Banks, eine schmale 280 Kilometer lange Inselkette im Atlantik vor der Küste North Carolinas, ein Ort, wo Winde den Alltag besonders stark bestimmen. Die einzelnen Kapitel, die meist mit einem persönlichen Erlebnis einsetzen, haben oft keinen gradlinigen Aufbau und führen mehrere thematische Schwerpunkte zusammen.
Alessandro Novas Das Buch des Windes. Das Unsichtbare sichtbar machen18 und Stephan Cartiers Der Wind oder Das himmlische Kind. Eine Kulturgeschichte19, die beiden letzten Bücher, auf die ich hier eingehen will, verfolgen eine ganz andere Richtung. Der italienische Kunsthistoriker hat ein kompaktes faszinierendes reich bebildertes Werk vorgelegt, eine Ikonographie des Windes, die von der Antike über die christliche und mittelalterliche Welt und die Neuzeit bis in die Gegenwart hinein reicht und im Zeichen der Unsichtbarkeit des Windes und deren Repräsentationen in der Kunst steht. Dadurch ergibt sich zwar eine weitgehend chronologische Struktur, diese wird aber durch unterschiedliche Formen der Winddarstellung in der bildenden Kunst, von der Personifikation, über die Allegorie und die Metapher bis hin zum Zeichen, unterbrochen.
Stephan Cartier hat sich für einen besonders originellen Aufbauplan entschieden, der von Beauforts Windskala ausgeht. Die Beaufortskala der Windstärke besteht aus insgesamt 13 Stärkebereichen, die von der Windstille (0) bis zum Orkan (12) reichen. Dementsprechend besteht das Buch aus dreizehn Kapiteln neben einem Vor- und einem Nachspiel. Cartiers kulturgeschichtlicher Ansatz vereint Überlegungen zu Windvorstellungen aus der griechischen Antike mit dem Verhältnis von Atem und Wind, der Geschichte des Wetterhahns, der Entdeckung des Luftdrucks, der Bedeutung von Windmühlen, Windkugeln und Windkanälen und endet mit der globalen Windzirkulation, einer Vision des Windes als allumfassendes Förderband der Lüfte. Die Metapher der Windskala greift nur zum Teil, da die Kapitelnummerierung mit ihrer Vorstellung einer zunehmenden Entfesselung des Windes nicht durchgehend mit dem Inhalt der einzelnen Kapitel übereinstimmt.
Zum Aufbau des Buches
Im Anhang von Peter Greenaways Drehbuch zum FilmPROSPERO’S BOOKS findet sich eine Liste von Büchern, die buchstäblich die Welt bedeuten. Im Zusammenhang mit einer Philosophie des Windes ist besonders das ›Buch der Bewegung‹ relevant. Dieses beschreibt auf der einfachsten Ebene, »wie die Vögel fliegen und wie die Wogen rollen, wie sich Wolken bilden […].« Es beschreibt auf der komplexesten Ebene aber auch, »wie im Gedächtnis sich Ideen jagen und wohin ein Gedanke geht, wenn er ausgedacht ist.« Das Buch ist mit »zähem blauen Leder überzogen, und weil es aus eigenem Antrieb immer aufspringt, wurden zwei Lederriemen darum herumgeschlungen und am Buchrücken mit Schnallen festgemacht. Nachts trommelt es gegen das Bücherregal und muss mit einem Messinggewicht niedergehalten werden.«20 Obwohl der Wind hier nicht explizit erwähnt wird, gemahnt Prosperos Lederband an Aölus’ Windschlauch, an die Höhlen und Käfige, in denen die tobenden Winde gefangen gehalten wurden, und an Hunts Metapher für Watsons Buch. Ein solches Windbuch kommt auch im Film THE ADDAMS FAMILY aus dem Jahr 1991 vor. Es genügt, den Buchdeckel zu öffnen und ein mächtiger Hurrikan strömt hervor, der alles mit sich reißt und durch die Luft schleudert. Dieser heftige Strom versiegt, sobald man das Buch wieder schließt.
Obwohl man solchen Metaphern eine gewisse Faszination nicht absprechen kann, ist die deutliche dichotomische Gegenüberstellung von Unordnung und Ordnung, von hoffnungslos chaotischen Winden und zähmender ordnender diskursiver Begrenzung letztlich eine theoretische Vereinfachung. Serres’ Ansatz, der unter anderem auf die Chaostheorie zurückgeht, beruht auf einer Durchdringung der beiden Momente: In der Ordnung schleicht sich unablässig Unordnung ein und in der Unordnung findet man geordnete Strukturen vor. In diesem Sinne habe ich mich für einen Aufbau entschieden, der dieser simplen Dualität entgeht und weder kumulativ noch rein linear ist, sondern ganz im Sinne Serres’ nacheinander verschiedene Stationen anläuft, die zwar voneinander abweichen, aber vielfach miteinander verbunden sind. Serres benutzt für dieses Narrativ die Metapher der randonnée. Dabei geht es weniger um eine Wanderung oder Tour als um ein Flanieren und Umherschlendern. Serres verwendet für diese nichtlineare Vorgehensweise auch die Metapher einer hin und her fliegenden Wespe, die immer wieder an einer anderen Stelle auf dieselbe Fensterscheibe trifft. Die sich daraus ergebende Synthese hängt nicht von einer einzigen Erklärung ab, sondern entsteht aus einem vielfältigen Bezugsystem, sie ist »ein stark differenziertes, aber organisiertes Ensemble von Relationen.«21 Diese Fortbewegungsweisen sind Formen des Umherschweifens.
Das Klima dieses Buches, um es mit Reeds Metapher zu sagen, ist durch eine Mischung aus Linearität und Abschweifung charakterisiert, es lebt von Exkursen und thematischen Echos. Dazu möchte ich ein kurzes Zitat aus Flussers Essaysammlung Vogelflüge anfügen, in dem das Verstörende des Windes als Metapher für die Struktur der einzelnen Texte verwendet wird. »Der Anfang der Essays scheint diszipliniert und diskursiv an einer Wäscheleine zu hängen und das Ende des Essays unordentlich in dem Wind, der von den hartnäckigen, unbändigen Erfahrungen der Essays bläst, zu schaukeln.«22 Auch die einzelnen Kapitel dieses Buches schaukeln im Wind, sowohl was ihre Position im Ganzen wie auch ihr eigenes Narrativ angeht.
Die komplementäre Methodologie von Blumenbergs Metaphorologie beruht auf der Unterscheidung zwischen historischen Längsschnitten und synchronen Querschnitten. Längsschnitte bestehen aus einer Reihe von Punkten, durch die eine Kurve gezogen werden kann. Ein Querschnitt hingegen verfolgt »eine Interpretation aus dem gedanklichen Zusammenhang, innerhalb dessen e[r] steht und seine Konturen wie sein Kolorit empfängt.« Querschnitte dienen dazu, »faßbar zu machen, was die herangezogenen Metaphern jeweils bedeuten.«23 In diesem Sinne ziehen die einzelnen Kapitel und das Buch als Ganzes verschiedene Kurven, die historisch gesehen bei den Texten der Naturphilosophen der Antike ansetzen und bis in die Gegenwart hineinreichen. Was Blumenbergs Querschnitte angeht, so wurde eine Kontextualisierung insbesondere bei Serres und Flusser angestrebt, in deren Philosophie das Meteorologische eine Schlüsselstelle einnimmt, von der aus das Gesamtwerk in den Blick gerät. In den anderen Fällen ging es darum, die theoretischen Implikationen der unterschiedlichen Metaphern des Windes im Werk eines bestimmten Autors herauszuarbeiten und in Bezug zur gesamten historischen Entwicklung zu setzen.
In der Nachfolge Serres’ und seines meteorologisch ausgerichteten Ansatzes wird die Entwicklung des Wetterwissens von den Traktaten der Antike bis zur modernen Meteorologie nicht im Sinne eines einseitigen wissenschaftlichen Fortschrittes und einer rein linearen Logik gelesen, sondern sowohl auf Diskontinuitäten und Rupturen wie auch auf Kontinuitäten und Wiederholungen untersucht. So ist beispielsweise die Kriegsmetapher des Wetters, die schon in der Antike eine Rolle spielte, auch in der Meteorologie der Bergener-Schule, die sich zur Zeit des Ersten Weltkrieges herausbildete, nachzuweisen (Kapitel fünf). Die Vorstellung des Windes als ein pfeilartig sich bewegender Strom, die mit Aristoteles’ Meteorologie einsetzt und über das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein von Bedeutung ist, taucht auch in den bildhaften Notationen der gegenwärtigen Meteorologie auf (Kapitel vier).
Obwohl die zehn Kapitel ein Gebiet abstecken, das sich stets erweitert, können sie unabhängig voneinander, als eine Reihe von unterschiedlichen, miteinander verwandten Perspektiven auf den Wind gelesen werden. Die einzelnen Kapitel verfolgen jeweils ein spezifisches Narrativ, das in einigen Fällen einer geschichtlichen, in anderen einer eher formalen Anordnung folgt. So untersucht Kapitel vier die Metapher des Luftmeers und die hydrologische Analogie von Wind und Fluss von den Texten der antiken Naturphilosophen bis zur gegenwärtigen Meteorologie, die von einem globalen zusammenhängenden Zirkulationssystem der Meeresströmungen und der Windflüsse ausgeht. Kapitel acht hingegen untersucht die Verwendung des Windes als eine Metapher der Plötzlichkeit und des Exzesses ausgehend von Momenten der intimen Inspiration bis hin zum Wahnsinn.
Die zehn Kapitel sind thematisch mehrfach miteinander verbunden. So wird das Verhältnis von Engel und Wind aus unterschiedlichen Perspektiven im dritten, sechsten und neunten Kapitel auf Verschiebungen, Erweiterungen und Umdeutungen hin untersucht. In den ersten Kapiteln des Buches geht es vor allem um unterschiedliche Metaphorisierungen des Windes, während im zweiten Teil der Wind als Metapher im Mittelpunkt steht. Die Metaphorisierungen des Windes und der Gebrauch des Windes als Metapher lassen sich dabei aber nicht deutlich voneinander trennen. Eine wichtige Rolle spielt auch der Sprachvergleich. Die verschiedenen Sprachen sprechen auf unterschiedliche und zugleich verwandte Art und Weise über den Wind.
Das erste Kapitel »Meteore: Figuren der Ambivalenz« beschäftigt sich mit der vielfältigen Ambivalenz des Begriffs ›Meteor‹ und dessen metaphorischem Potential, das sich im Lauf der Jahrhunderte stark verändert hat. Ursprünglich war ›Meteor‹ ein Sammelbegriff für eine Gruppe von Phänomenen – Sternschnuppen, Erdbeben und Atemvorgänge –, die im damaligen Verständnis zu einer einzigen zusammenhängenden Welt gehörten, aus heutiger Sicht aber widersprüchlich und beliebig erscheinen müssen. In der Folge wurde der Begriff sukzessive eingeschränkt und umfasste bald nur noch die Wetterphänomene im modernen Sinne.
Das zweite Kapitel »Vom Wind und den Winden: Einzahl und Vielzahl« untersucht die schon in der Antike diskutierte Frage, ob der Wind als singuläres Phänomen zu betrachten ist oder in verschiedene Winde zerfällt. Neben dem Verhältnis von Luft und Wind und der damit zusammenhängenden Frage, wann ein Wind eigentlich ein Wind ist, geht es hier auch um die theoretische Diskussion unterschiedlicher Windarten und deren jeweilige Ursache oder Ursachen. Dabei sollen Wind-Traktate untersucht werden, die von den Vorsokratikern, Aristoteles und Theophrastos, über Lukrez, Seneca und Plinius bis hin zu Francis Bacon, René Descartes und Jean-Baptiste de Lamarck reichen.
Im dritten Kapitel »Windpersonifizierungen: Engel und Dämonen« geht es um Personifikationen und Allegorisierungen des Windes. In der Antike, im Mittelalter und bis in die Frühe Neuzeit hinein wurden Winde als bärtige Götter mit wehenden Haaren, blasende Köpfe und engelshafte oder dämonische Flügelwesen, aber auch als Tiere dargestellt, die in ein System der geographischen Zuordnung – Windrosen und Winddiagramme – eingebunden waren. Die anthropomorphen Darstellungen wurden von einem abstrakten Notationssystem begleitet, das Ströme, Strahlen, Linien, Striche und befiederte Pfeile umfasste.
Das vierte Kapitel »Luftmeer: Flüsse und Strömungen« ist einer besonders folgereichen Metaphorisierung des Windes gewidmet, die von Aristoteles’ Meteorologie ausgehend bis in die Gegenwart hineingewirkt hat. Die hydrologische Analogie geht davon aus, dass die einzelnen Winde Flüssen vergleichbar sind und der Himmel ein grenzenloses Meer ist. In der gegenwärtigen Meteorologie ist ebenfalls die Rede von einem globalen zusammenhängenden Zirkulationssystem der Meeresströmungen und der Windflüsse.
Im fünften Kapitel »Von Winden und Wolken: Himmelsschlacht und Möglichkeitsfeld« geht es um das Verhältnis der beiden Meteore im Zeichen der Metaphern des Windschlauchs und der Himmelsschlacht, die schon in frühen mythologischen Vorstellungen eine zentrale Rolle in der Beschreibung von Wolken und Wind spielen. Darüber hinaus wird das erkenntnistheoretische Potential von Wind und Wolke im Werk Serres’, Flussers und Reeds untersucht.
Das sechste Kapitel »Die Sprachen des Windes: Übertragung und Übersetzung« thematisiert den Wind im Zeichen der Übertragung und des Transports. Winde verbinden unterschiedliche Realitätsbereiche miteinander und vermitteln zwischen verschiedenen Wahrnehmungsformen. Darüber hinaus sind sie selbst Übersetzer über Zeit und Raum hinweg.
Das siebte Kapitel »Der Atem der Welt: Wind und Körper« beschäftigt sich mit dem Verhältnis von äußeren und inneren Winden und dessen historische Entwicklung. Von der Antike bis in die Frühe Neuzeit wurden Wind und Atem als die beiden Seiten eines einzigen pneumatischen Prozesses betrachtet. Diese Vorstellung wurde in der Folge weitgehend aufgegeben, aber in der Romantik im Sinne einer Gefühlsmetapher wiederentdeckt. Ingold und Serres kommen von unterschiedlichen Standpunkten aus auf diese frühere einheitliche Vision zurück.
Ausgehend von der Vorstellung des Windes als einer anarchischen chaotischen Kraft und einer Verkörperung des Wahnsinns behandelt das achte Kapitel »Der Wind des Wahnsinns: Plötzlichkeit und Exzess« unterschiedliche Deutungen des Verhältnisses von Ordnung und Chaos in Literatur, Film und Philosophie. Im Gegensatz zum siebten Kapitel geht es hier um die dunkleren beängstigenden Seiten des Windes als Gefühls- und Weltmetapher. Das Spektrum reicht von der Windstille der Seele bis hin zu den bedrohlichen und zum Wahnsinn treibenden Manifestationen des Windes in Victor Sjöströms Verfilmung von Dorothy Scarboroughs Roman The Wind.
Das neunte Kapitel »Der Wind des Nomadischen: Politik und Kommunikation« untersucht die Ambivalenz des Windes in Hinblick auf Politik und Kommunikation. In der Politik benutzt Aristoteles die Winde als Metaphern unterschiedlicher politischer Verfassungen. Der Wind ist immer wieder, besonders ab der Romantik als eine Metapher der Freiheit und Entgrenzung gedeutet worden. Flusser verwendet ihn als eine Metapher der digitalen Kommunikationsrevolution und der sich daraus ergebenden bodenlosen nomadischen Existenz der Gegenwart. Serres entwickelt aus der Metapher des Windengels eine umfassende ökologische Vision unserer gegenwärtigen Lage.
Im zehnten Kapitel »Windanmut: Klima und Kultur« stehen Deutungen des Windes im Mittelpunkt, die das europäische Verständnis von Natur und Kultur grundsätzlich in Fragen stellen. Watsuji Tetsurô geht von einer klimatischen Geschichtlichkeit aus. Ōhashi beschreibt die japanische Gesellschaft als eine Windkultur. Weitere Reflexionen, die in die gleiche Richtung gehen, finden sich in James K. McNeleys Darstellung der umfassenden poetischen und philosophischen Wind-Philosophie der Navajo-Kultur, von der aus zugleich wesentliche Momente des gesamten Buches noch einmal kritisch und erweiternd aufgerufen werden können.
Wie ich in diesem Buch zeigen möchte, kann man anhand einer Philosophie des Windes einen anderen Blick auf eine ganze Reihe von Phänomen gewinnen. Winde verschieben unsere Aufmerksamkeit auf das Unsichtbare und Immaterielle, vom Visuellen zum Akustischen, Haptischen und Olfaktorischen. Die Winde sprechen zu uns und tragen uns Gerüche zu. Der Wind ist eine allgegenwärtige inspirierende und belebende Kraft, die wir gelernt haben, weitgehend zu ignorieren. Meist nehmen wir ihn nur noch in seinen extremen und destruktiven Manifestationen wahr. Der Wind aber ist im Subtilen, Spielerischen und Ephemeren angesiedelt.
Wien und Lugano, Herbst 2022
1Mit Nennung der weiblichen [männlichen] Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die männliche [weibliche] Form mitgemeint.
2Ch. Low und E. Hsu, »Introduction«, in: Journal of the Royal Anthropological Institute 13 (2007), S. 2.
3G. Bachelard, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris 1992, S. 291-292. Alle Texte, die nicht schon in einer deutschen Übersetzung vorlagen, sind von mir übersetzt worden.
4N. Hunt, Where the Wild Winds are. Walking Europe’s Winds from the Pennines to Provence, London und Boston 2018, S. 28.
5S. Kuriyama, »The Imagination of Winds and the Development of the Chinese Conception of the Body«, in: Body, Subject & Power in China, hg. von A. Zito und T. E. Barlow, Chicago 1994, S. 24.
6Ebd., S. 38.
7M. Black, »More about Metaphor«, in: Metaphor and Thought, hg. von A. Ortony, Cambridge 1979, S. 31.
8Zur Bedeutung der Metapher in der Philosophie vgl. R. Konersmann, »Figuratives Wissen«, in: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. von R. Konersmann, Darmstadt 2011, S. 7-20.
9A. Reed, Romantic Weather. The Climates of Coleridge and Baudelaire, Hanover 1983, S. 19.
10E. Aubert de la Rüe, L’homme et le Vent, Paris 1940.
11J. DeBlieu, Wind. How the Flow of Air Has Shaped Life, Myth & the Land, Berkeley 2006.
12X. Fielding, Das Buch der Winde, Nördlingen 1988, S. 8.
13L. Watson, Heaven’s Breath. A Natural History of the Wind, New York 2019, S. vii-viii.
14Ebd., S. ix-x.
15Ebd., S. 222.
16Ebd., S. 276.
17Ebd., S. 7.
18A. Nova, Das Buch des Windes. Das Unsichtbare sichtbar machen, München und Berlin 2007.
19S. Cartier, Der Wind oder Das himmlische Kind. Eine Kulturgeschichte, Berlin 2014.
20P. Greenaway, Prosperos Bücher, Drehbuch nach »Der Sturm« von William Shakespeare, Zürich 1991, S. 232-233.
21M. Serres, Aufklärungen. Fünf Gespräche mit Bruno Latour, Berlin 2008, S. 151 und 154.
22V. Flusser, Vogelflüge. Essays zu Natur und Kultur, München 2000, S. 123.
23H. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt am Main 1998, S. 49.
1. Meteore: Figuren der Ambivalenz
»Von Aristoteles oder sogar den Vorsokratikern bis mindestens zu Descartes konnte niemand sich als Philosoph bezeichnen, wenn er nicht über die meteora geschrieben hatte.«
Michel Serres, Atlas
Aufgrund ihrer Flüchtigkeit und ihres hybriden Charakters haben Wetterphänomene nicht denselben ontologischen Status wie andere natürliche Gegenstände. Dies kommt im Begriff ›Meteor‹ zum Ausdruck, dessen Geschichte ich hier nachzeichnen werde. Eine Philosophie der Meteore bedingt auch einen anderen Zugang zur Zeit, wie Serres in seinem Werk aufgezeigt hat. Und schließlich lässt sich eine grundlegende Analogie von Meteoren und Metaphern postulieren, welche das enge strukturelle Verhältnis der beiden Bereiche miterklären kann.
›Meteor‹, von meta, ›auf einer höheren Stufe‹, und aoros, ›erhoben, in der Luft schwebend‹, kommt vom griechischen Substantiv meteoron, ›etwas, was hoch oben ist‹ und dem Adjektiv meteoros, ›vom Boden entfernt‹. Das Präfix meta- betont eine Zwischenstufe, einen Wechsel, oder bezeichnet eine hierarchisch höherliegende Ebene. Aoros ist verwandt mit aerein ›erheben, hochhalten‹. Der Begriff ›Meteor‹, den man heute zwar immer noch in der Fachsprache der Meteorologie für Phänomene verwendet, die man in der Atmosphäre und an der Erdoberfläche beobachten kann – aber, wie noch zu zeigen sein wird, nicht mehr für den Wind –, hat im Laufe seiner Geschichte eine fortschreitende terminologische Einengung erfahren.
In Aristoteles’ Meteorologie hatte der Begriff Meteor ein sehr weites Bedeutungsspektrum, das neben Wetterphänomenen auch die Milchstraße, Sternschnuppen, Flüsse, das Meer, Erdbeben und sogar Verwesungsprozesse umfasste. Die spätere Bedeutung von ›Meteor‹ als Feuerball im Himmel wird zum ersten Mal 1590 verwendet. Im Laufe des 19. Jahrhunderts werden die Begriffe Meteorologie, Meteorologe und meteorologisch nur noch für Wetterphänomene im modernen Sinn verwendet. Dieser Übergang war jedoch graduell und verlief über Mischformen. Heute versteht man unter ›Meteor‹ im Allgemeinen eine Leuchterscheinung, die auf den Eintritt eines Meteoroiden in die Erdatmosphäre zurückzuführen ist. Meteoroiden sind kleiner alsAsteroiden und befinden sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Sie entstehen meist, indem sie durch Kollisionen aus einem Asteroiden herausgeschlagen werden. Ein nicht vollständig verglühter Meteoroid, der die Erdoberfläche erreicht, wird ›Meteorit‹ genannt.
Im Zitat, das diesem Kapitel vorangestellt ist, weist Serres auf eine Ruptur in der philosophischen Wahrnehmung des Wetters in Europa hin, die er auf den Sieg der mechanistischen Weltsicht Newtons zurückführt. Waren Wind und Wetter im 17. Jahrhundert noch ein »major topic of Western philosophy and literature«, wie Reed festhält, so vollzog sich in der Folge, vor allem mit der Aufklärung und in verstärktem Maße im Laufe des 19. Jahrhunderts, eine Neudefinition des Phänomens. Das Wettergeschehen wurde aus den philosophischen Diskursen ausgegrenzt und dem Bereich der sich neu konstituierenden wissenschaftlichen Disziplin der Meteorologie zugewiesen. Damit änderte sich das Interesse für das Wetter grundlegend. Fragte die Philosophie der Meteore noch nach der lebendigen Eingebundenheit des Menschen in die Wetterzusammenhänge, so ging es der naturwissenschaftlichen Meteorologie nunmehr nur noch um das abgezirkelte und dadurch objektivierte Gebiet der Wettererscheinungen. Als Reaktion auf diese Entwicklung haben Serres und Reed versucht, die Meteore wieder in den philosophischen und literarturkritischen Diskurs zurückzuholen.
Die moderne experimentelle Wissenschaft verlangte rigorose Beobachtungen und exakte Messungen. Vor diesem Hintergrund musste das unvorhersehbare anarchische Wetter als ein hochproblematisches Feld wirken, das sich quer zu den positivistischen und objektivierenden Ansprüchen der Zeit legte. Die Literatur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, besonders die Romantik versuchte, die Tradition der Meteoren zu rehabilitieren. »The Enlightenment, for reasons implicit in its very name, attempted to dissipate the clouds […]. But the Romantics tended to lift that repression, and Sturm und Drang broke over the skies of the Aufklärung – skies that had never been entirely clear, of course, in the first place.«1Reed liest die beiden Begriffe ›Aufklärung‹ und ›Sturm und Drang‹ konsequent als das, was sie eigentlich sind: Wettermetaphern. Die Aufklärung träumt von einem wolkenlosen unverstellten Himmel, einem idealen wetterlosen Zustand und verwendet zu dessen Beschreibung ironischerweise gerade eine Wettermetapher. In der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts wird die Tradition der Meteore weiter gepflegt. Die Philosophie wird sich jedoch erst wieder im 20. Jahrhundert, vor allem im Anschluss an die Chaostheorie, ernsthaft mit Wetterphänomenen beschäftigen.
Wie Serres in Éloge de la philosophie en langue françaiseausführt, findet jedoch schon in Paris um 1900 eine erste diskursive Öffnung und Umschichtung statt, welche die Chaostheorie vorwegnimmt und die verschiedensten Kulturbereiche von der Mathematik und Physik hin zu Philosophie, Musik, Malerei und Literatur verbindet. Serres führt den Physiker und Wissenschaftsphilosophen Pierre Duhem, die Mathematiker Jacques Hadamard und Henri Poincaré, den Philosophen Henri Bergson, Claude Debussys La Mer, Maurice Ravels Jeux d’eau, Claude Monets Nymphées, Lautréamonts Chants de Maldoror undCharles Peguys Clio zusammen. Allen gemeinsam sind die Abweichung vom Gleichgewicht und die Hinwendung zur chaotischen Turbulenz als einer neuen komplexeren Form der Logik, die Serres auf Descartes’ Wirbel und Lukrez’ Physik bezieht. Die melodischen Linien Ravels und Debussys gleichen Wellen, die vom Wind angetrieben werden und erinnern an den unvorhersehbaren Zickzack-Flug der Wespe aus einem Gedicht Verlaines: »ein turbulentes, aber logisches und zielgerichtetes Verhalten.«2 Serres erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Lorenz-Attraktor (1963) des amerikanischen Mathematikers und Meteorologen Edward Lorenz, der als einer der Wegbereiter der Chaostheorie gilt. Es handelt sich dabei um ein System von drei gekoppelten nichtlinearen Differentialgleichungen, das von zentraler Bedeutung für die Meteorologie ist. Serres verbindet den zerklüfteten Schreibstil Peguys mit der Trunkenheit des Wespenfluges, dem fraktalen Küstenverlauf Benoît Mandelbrots und der unvorhersehbaren Abfolge der befreiten melodischen Linien von Gabriel Fauré, César Franck und Francis Poulenc: »perfekte Kohärenz unter scheinbarer Unordnung.«3
Im Zeichen des Unbestimmten und Hybriden
In der Meteorologie, ein Buch, das bis weit in die Frühe Neuzeit hineinwirkte, diskutiert Aristoteles die Stellung der Meteorologie innerhalb der Naturlehre. Diese beschäftigt sich mit den Meteoren, das heißt mit den natürlichen Phänomenen, die sich in dem der Gestirnsphäre benachbarten sublunaren Raum abspielen und dem allgemeinen Werden und Vergehen unterworfen sind. Im Vergleich zu den ersten einfachen Elementarkörpern sind die Meteore durch Instabilität und Unregelmäßigkeit charakterisiert. Meteore sind von kurzer Dauer. So wie sie räumlich zwischen dem Himmel und der Erde liegen, siedeln sie sich auch zeitlich zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit an. Geburt und Tod folgen hier nicht aufeinander, sondern vollziehen sich im gleichen Moment.
Wie Anouchka Vasak und Thierry Belleguic festhalten, sind die Meteore der Instabilität und dem Verfall anheimgegeben, »frappée d’instabilité, de corruption.«4 Die Region der Meteore ist ein Ort, an dem sich die Unordnung entfaltet. Auch Aristoteles musste sich verschiedenen Definitionsschwierigkeiten stellen. So hat er einige Meteore neu benannt und auf poetische Wendungen in der Bezeichnung unterschiedlicher Blitzformen zurückgegriffen. Die Schwierigkeit des Trennens und Eingrenzens der einzelnen Phänomene wird auch offen angesprochen, und der Begriff der Grenze (ὄρος) und verwandte Wortverbindungen spielen in vielfacher Hinsicht eine zentrale Rolle in der Meteorologie. Die Meteore widersetzen sich einfachen Definitionen und Klassifikationen. Selbst der Begriff ›Meteor‹ ist in mehrfacher Hinsicht ambivalent. »Der Meteor ist ein schlecht definierter Körper, dessen Zusammensetzung unklar ist und sich dadurch der linguistischen Bestimmung widersetzt. Diese terminologische Unbestimmtheit verfolgt ihn als seine eigentliche Natur […].«5 Seine Bedeutung bleibt selbst heute noch unabgeschlossen. Er bezeichnet gemischte, instabile und ephemere Phänomene, die sich in einem mittleren Zwischenraum ereignen, und oszilliert zwischen einer metaphorischen und einer wörtlichen, einer wissenschaftlichen und einer literarisch-philosophischen Bedeutung. Die »undeutliche und ungeteilte Vielfalt scheint ein Merkmal des Meteors zu sein. Als Objekte mit unbestimmten Konturen stellen Meteore ein wesentliches Definitionsproblem dar, und das von Anfang an […].«6 In diesem Sinne ist die Geschichte der Meteore auch der immer wieder angestrebte und gescheiterte Versuch, das grundsätzlich Vermischte und Unübersichtliche terminologisch zu zähmen.
Die Meteore sind in vielfacher Hinsicht ein Gemisch. Für einige von ihnen findet man keine Erklärung, andere hingegen können einigermaßen begrifflich erfasst werden. Die Kometen, die Milchstraße und die Sternschnuppen beruhen auf Entzündung und sind mit Bewegung verbunden. Andere wiederum, wie der Regen und die Wolken, kann man der Luft und dem Wasser zuschreiben und schließlich gibt es noch diejenigen, die mit der Erde verbunden sind, wie die Winde und die Erdbeben. Der Unterschied zwischen der ungeordneten Welt der Meteore und den geregelten unveränderlichen Abläufen der Sterne und die darauf zurückgehende Gegenüberstellung der beiden Wissensformen der Meteorologie und der Astronomie ist bis in die Moderne hinein zentral für die Geschichte des Wetters im europäischen Raum gewesen. Gleichzeitig hat es parallel dazu den Versuch gegeben, das chaotische Wetter anhand des Einflusses der Sterne zu deuten. Erste Elemente dieser Astrometeorologie finden sich schon bei Aristoteles. Die materielle Ursache des sublunaren Wetters beruht auf den vier übereinander gelagerten Elementen, die sich in konzentrischen Kreisen von innen nach außen, von der Erde, über das Wasser und die Luft zum Feuer anordnen. Das fünfte Element ist der Äther - von altgriechisch αἰθήρ aithḗr, blauer Himmel -, ein einfacher elementarer Körper, aus dem der Himmel und die Sterne gemacht sind. Der Äther gehört in den oberen Bereich des Himmels, ein Ort ewig gleicher unbegrenzter und perfekter Bewegungen. Die ewig bewegten Himmelskörper, die in der äußeren Sphäre kreisen, aber mit ihren Umschwüngen in kontinuierlicher Verbindung mit den inneren vier Sphären stehen, sind Ursprung und erste Ursache der Meteore. Die Meteorologie ist hier somit letztlich von der Astronomie her zu verstehen, wenigstens was die innere Bewegungsursache angeht.
Die Meteore stehen für einen Teil der Natur, der in vielfacher Hinsicht von den Gesetzen abweicht. Über Meteore zu schreiben, bedingt daher eine Reihe von Ambivalenzen, die nicht nur den Inhalt, sondern auch die Methode betreffen. Die verschiedenen Windtheorien sind durch einen hybriden Zugang zum Phänomen charakterisiert, der empirische Erfahrungen, theoretische Spekulation und einen Rückgriff auf frühere Vorstellungen zusammenführt. Dies gilt nicht nur für die Autoren der Antike und des Mittelalters, sondern auch für Bacon und Descartes. Sowohl bei Aristoteles wie bei Descartes kommen noch terminologische Unklarheiten hinzu, besonders im Zusammenhang mit der Bestimmung des Windes. Davon mehr im nächsten Kapitel.
Aristoteles unterscheidet zwischen einfachen und zusammengesetzten Körpern. Diese bestehen aus den vier Elementen, Luft, Wasser, Erde und Feuer. Die gemischten Körper können vollkommen oder unvollkommen sein. Die ersten entstehen an ihrem angestammten natürlichen Ort und nach den Gesetzen der Natur, die anderen hingegen, unter denen sich auch die Meteore befinden, entstehen außerhalb der natürlichen Ordnung, die darauf beruht, dass Gleiches Gleiches erzeugt. Aristoteles verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Meteore zwar aus Erde und vor allem aus Wasser bestehen, sich aber in der Luft manifestieren. Die Zeit, in der die Meteore erscheinen, ist nicht geregelt, wie das durch die Jahreszeiten bedingte Wachstum der Pflanzen. Auch der Ort, an dem sie in Erscheinung treten ist nicht immer derselbe. Die Himmelsbewegung rührt die unteren vier Elemente auf, die sonst in sich ruhen würden. Dadurch werden sie vermischt und miteinander verbunden. Dies generiert hoch instabile Interaktionen, da jedes Element in sich bereits instabil und potenziell in den anderen latent vorhanden ist, was auch dazu führt, dass sich die einzelnen Elemente jederzeit ineinander verwandeln können. So bestehen die Meteore nicht nur aus Luft oder Wasser, oder einer Kombination davon, sondern auch immer aus allen anderen Elementen, mit denen sie vielfältige Wechselbeziehungen unterhalten. Die unvollkommene sublunare Welt der vier Elemente ist nicht nur durch andauernden Ortswechsel, sondern auch durch gemischte Bewegungen charakterisiert. So sind die Meteore ein Gemisch, auch was die Art ihrer Fortbewegung betrifft.
Die sublunare Welt der Antike ist durch eine doppelte zugleich zentrifugale (Feuer und Luft) und zentripetale (Erde und Wasser) Bewegung bestimmt. So wie es einfache und gemischte Körper gibt, gibt es auch einfache und gemischte Bewegungsformen. Die einfache gradlinige Bewegung geht von oben nach unten oder von unten nach oben. Feuer und Luft, die beiden oberen Elemente, tendieren von sich aus nach oben, die beiden unteren Elemente, Wasser und Erde, hingegen nach unten. Der Äther wird mit einer einfachen zirkulären Bewegung verbunden. Und schließlich ist die jeweilige Ausformung der Meteore nicht immer der Ursache angemessen. Meteore erscheinen somit weder am richtigen Ort noch zur richtigen Zeit, und tendieren dazu über ein gesundes Maß hinauszugehen. Sie sind daher unvorhersehbar und letztlich unkontrollierbar.
Im Gegensatz zu Serres und Reed, welche die Vermischtheit und Ambivalenz der Meteore zum Ausgangspunkt einer ganzheitlichen Vorstellung machen, geht Daniel Parrochia in Météores. Essai sur le ciel et la cité von einer Position aus, welche das kategorisierende Wissen der modernen Meteorologie in die Vergangenheit zurückprojiziert. Dabei steht das Trennende im Vordergrund. Aristoteles habe versucht, in der Gesamtheit der Phänomene die von den Meteoren gebildete Domäne stricto sensu zu isolieren, obwohl die Grenzen noch unsicher waren. Die Astrometeorologie der Antike und der Renaissance habe es unterlassen, den Bereich der Meteoren und Kometen, von den »eigentlichen atmosphärischen Phänomenen korrekt zu isolieren.«7 Mit diesem eingeengten Blick, bei dem es vor allem um die disziplinären Grenzen der modernen Meteorologie geht, verliert man die verschiedenen zuvor zusammengedachten Bereiche aus den Augen. Dass die frühe Meteorologie Aristoteles’ zu den Meteoren unter anderem auch Himmelsphänomene sowie Flüsse und Erdbeben zählte, geht aus einer gesamtheitlichen Vorstellung hervor, die in übergreifenden Verbindungen quer über die Realitätsbereiche hinweg denkt. So vereint Aristoteles’ Meteorologie auch verschiedene heute weitgehend getrennte disziplinäre Wissensbereiche: Astronomie, Geografie, Physik, Geometrie, Optik, Geologie, Seismologie, Vulkanologie, Chemie und eben Meteorologie im modernen Sinne des Wortes.
Übergänge
In Bacons The Natural and Experimental History of the Winds (1622) kommt der Begriff meteor nochan verschiedenen Stellen vor und auch die aristotelische Verbindung von Wind und Erdbeben wird angesprochen. Die Hybridität der Meteore hinterlässt darüber hinaus ihre Spuren in der Methodologie. Dennoch spielt der Begriff nicht mehr die zentrale Rolle, die er in früheren Texten noch hatte. Bacon unterscheidet zwischen fiery und aqueous meteors. Die einzelnen Meteore erscheinen oft zusammen, vermischen sich und sind daher nur schwer voneinander zu trennen, was zu Problemen in Hinblick auf mögliche Wettervoraussagen führt. Bacons Vorgehen ist eine Mischung aus systematischer empirischer Wetterbeobachtung und dem Wissen der früheren Meteorologie, vor allem die Texte von Aristoteles, Theophrastos und Plinius dem Älteren, wobei nur der letztere explizit erwähnt wird. Einschränkend hält Bacon zu Beginn fest, dass es unmöglich sei, eine befriedigende Antwort auf alle Fragen bezüglich des Windes zu finden. Dazu verwendet er die Metapher des Prozesses, in dem die Natur auf der Zeugenbank sitzt. »Such are the heads requisite to a particular history of the winds; but we expect not that our present stock of experience should be able to answer them all. However, as in trials at law, a good lawyer knows how to put such questions as the case requires; but knows not what the witnesses will answer: so we can proceed no otherwise in the grand cause betwixt nature and mankind; and must leave posterity to see the issue.«8
In Die Meteore (1637) geht es Descartes vor allem darum, die reine Fantasie, den Aberglauben und das Irrationelle durch einen rationalisierenden Zugang zu entschärfen und die früheren, inzwischen als heterogen empfundenen Bestandteile aus dem Studium der Meteore auszuschließen, was ihm jedoch nur zum Teil gelingt. Wie schon in Lukrez’ De rerum natura geht es um eine Säkularisierung und Entzauberung der Himmelserscheinungen. »Wir begegnen naturgemäß den Dingen über uns mit größerer Bewunderung als denen, die auf selber Höhe oder unterhalb von uns sind.« Wir müssen
»die Augen zum Himmel drehen, um auf sie zu blicken, und deshalb stellen wir sie uns als so hochstehend vor, daß Dichter und Maler aus ihnen sogar den Thron Gottes bilden und ihn dort seine eigenen Hände dazu verwenden lassen, den Winden die Türe zu öffnen und zu schließen […]. Dies lässt mich hoffen, daß wenn ich ihre Natur hier so erkläre, daß kein Anlaß mehr besteht, sich über irgendwas zu verwundern, was sich an ihnen zeigt oder von ihnen herkommt, man mir leicht glauben wird, daß es möglich ist, in derselben Weise die Ursachen aller bewundernswerten Dinge zu finden, die es sonst noch auf der Erde gibt.«9
Zur Verbindung von Wetter und Aberglaube schreibt er: »für die untätige Bevölkerung« seien dramatische Himmelsereignisse ein »Beweggrund […] sich Scharen von in der Luft miteinander kämpfender Gespenster« vorzustellen. Es überwiegten dabei die »Phantasie oder Hoffnung«, und diese würden noch zusätzlich »durch Aberglaube und Unwissenheit verfälscht und gesteigert.«10
Aus diesem Grund präsentiert er die einzelnen Meteore nacheinander als Bestandteile einer logischen in sich stimmigen Serie, deren einzelne Teile organisch auseinander hervorgehen, und schließt dabei Kometen, Feuersäulen, Erdbeben und Mineralien aus. Die neue Ordnung wird durch Ausgrenzung und Entmischung erreicht. Nach einer Reflexion über Dämpfe (vapeurs) und Ausdünstungen (exhalaisons), die an die aristotelische Tradition gemahnt, behandelt er das Salz, die Winde, die Wolken, den Schnee, den Regen, den Hagel, die Stürme sowie den Blitz und die anderen Feuer, die sich in der Luft entzünden. Es folgen die optischen Phänomene, der Regenbogen, die Farben der Wolken, der Kreise und Kränze, die sich manchmal um die Gestirne bilden (Korona), und die Erscheinung mehrerer Sonnen (Parhelia). Descartes versucht anhand der Meteore, seine neue Methode an einem besonders schwierigen Gegenstand vorzuführen. Das Außergewöhnliche der Meteore und ihre Einzigartigkeit sollen dadurch einer rationalen Erklärung zugeführt werden. Dass der Discours de la méthode eigentlich vor allem eine Einleitung zum Studium der Meteore war und deren Darstellung die Methode im Vollzug zeigen sollte, wurde von der Forschung lange übergangen.
Descartes’ philosophische Betrachtung auf der Basis sinnlicher Anschauung und geduldig empirischer Beobachtung gilt vor allem für die erste Gruppe der Meteore: Wind, Wolken, Schnee, Regen, Hagel, Sturm und Blitze. Hinzu kommt eine mathematische Perspektive, die für die zweite Gruppe der optischen Phänomene bedeutsam ist: Regenbogen, die Farben der Wolken, Kreise und Kränze und die Erscheinung mehrerer Sonnen. Wie Zittel festhält, hat dies damit zu tun, dass Meteore »traditionell als unberechenbareRenegaten im sonst gesetzesförmigen Reich der Naturphilosophie auftreten und von der Theorie prinzipiell nicht leicht ›einzufangen‹ sind. Meteore sind instabil, transitorisch und ihr Verhalten von so vielen Faktoren abhängig, dass man sie nicht berechnen, sondern lediglich beobachten, beschreiben und erfindungsreich visualisieren kann [Hervorhebung d. A.].«11 Die Metapher des unberechenbaren Renegaten, ein Abtrünniger eines Glaubens- oder Wertsystems, überführt die Meteore in ein politisches und religiöses Deutungsmuster. Die Jagdmetapher des Einfangens, die eigentlich beim Wind eher unangebracht ist, würde er doch auch dem feinmaschigsten Netz entkommen, taucht, wie noch zu zeigen sein wird, immer wieder auf. Die Verbindung zur Jagd wird zudem durch die Vorstellung Winde seien wilde Tiere hergestellt.
Wie Parrochia12