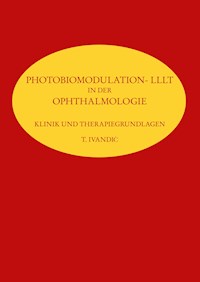
89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Phototherapie innovativ nicht invasiv regenerativ effektiv auf physiologischer Basis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Autor ist in Kroatien geboren. Die akademische Ausbildung der Humanmedizin führte über mehrere europäische Universitäten, darunter: Zagreb, Paris, Madrid, Salamanca (Staatsexamen, OCAU-Stipendienempfänger). An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg war er als wissenschaftlicher Assistent tätig (Rigurosum, Promotion, Fachausbildung). In dieser Zeit wurde bereits ein wissenschaftlicher Beitrag veröffentlicht, der zur Einführung von Dreipunktegurt und Windschutzscheibe aus Verbundglas in den Fahrzeugen beigetragen hat, was zur Reduzierung der Augenverletzungen durch Autounfälle führte. Dort entstand auch die Idee, dass das Glaukom mit Betablockern behandelt werden könnte. Die Betablocker sind seit 1971 die erste Wahl bei der Glaukomtherapie und stellen noch immer einen großen Fortschritt im Kampf gegen Erblindung dar. Über die weiteren therapeutischen Laseranwendungen in der Ophthalmologie wurde jahrelang in eigener Praxis geforscht und die Resultate sind in diesem Buch zusammengefasst. Laserbiomodulationtherapie ist eine neue Behandlungsmöglichkeit im Kampf gegen Erblindung. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind in internationalen Zeitschriften erschienen. Der Autor ist langjähriges Mitglied der französischen (SFO) und deutschen ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) und aktiver Teilnehmer an internationalen Kongressen.
Vorwort
Das Sehen zu retten und zu bewahren, ist die vorrangige Aufgabe aller Ophthalmologen.
Um Patienten die Beteiligung am täglichen Leben zu erleichtern oder zu ermöglichen, ist es erforderlich, ständig nach neuen Behandlungsarten zu suchen. Trotz großer therapeutischer Fortschritte in neuerer Zeit bleiben noch viele Augenerkrankungen unbehandelbar.
Seit den Achtzigerjahren haben wir mit einem schwachen Laser die kranken Augen behandelt mit der Frage, ob diese angewandte Methode für Augenkranke von Nutzen sein kann oder nicht. Da wir von den positiven Ergebnissen überzeugt sind, geben wir gerne einen kurzen, unvollständigen Überblick über diese neue therapeutische Option mit der Hoffnung auf eine positive Resonanz.
Die Artikel sind nach Themen, wie in den ophthalomologischen Zeitschriften üblich, einzeln in knapper Form verfasst und geordnet. Der erste Teil beinhaltet klinische Erfahrungen, der zweite, zwecks besseren Verständnisses, die Therapiegrundlagen mit biophysikalischen Daten und Funktionsmechanismus.
Manche Erkenntnisse werden ohne notwendige Beweisdaten berichtet und sind einfach als Erfahrungswerte zu betrachten. Die Überzeugung generiert sich aus der Erkenntnis, die wiederum die Erfahrung voraussetzt.
Alle studienbezogenen Untersuchungen und Behandlungen wurden vom Augenarzt ohne wirtschaftliche Vorteile für ihn oder für die Patienten unter Berücksichtigung der Helsinki-Deklaration und mit Patienteneinwilligung durchgeführt. Es besteht kein Interessenkonflikt.
Eine wünschenswerte und zwingend erforderliche, randomisierte klinische Langzeitstudie war aus verständlichen Gründen nicht immer durchführbar. Viele Fragen bleiben also noch offen und warten darauf, erforscht zu werden.
Dieser erste Abriss sollte als Anstoß und effektive Information für eine weitere Forschung dienen. Eine faszinierende Forschungswelt, das Geheimnis des Lichts zu entschlüsseln und zu erschließen, ist die dringendste Aufgabe in der Ophthalmologie. Gleichzeitig möge dieser Bericht aus der Praxis für die Praxis den Kollegen direkte Hilfe sein, um das tägliche Tun zu bewältigen und den Patienten das Wunder des Sehens zu bewahren.
Das Laserlicht eignet sich sowohl für Diagnostik als auch für Therapie und Prävention von Augenerkrankungen. Wegen seiner biomodulierenden Wirkung auf die normalen biochemischen Prozesse eignet sich idealerweise das Laserlicht für eine vielfältige, kurz dauernde, komplikationslose und kostengünstige Anwendung. Besonders wertvoll ist die Behandlung für Patienten, die von Blindheit bedroht sind, und für die es keine andere therapeutische Option gibt.
Unter Phototherapie (PT) versteht man im Allgemeinen »Lichttherapie«. Die Lichtart ist nicht spezifiziert. Die Sonnenlichttherapie ist als Heliotherapie seit der Antike bekannt. Das Laserlicht wird in der Ophthalmologie hauptsächlich zur Photokoagulation und Photodynamischen Therapie (PDT) verwendet. Die Laser-Biomodulationstherapie (LBMT) ist die Behandlung mit schwachem Laser. Sie ist auch als »Low-level laser therapy« (LLLT) bekannt.
Die langjährige Erfahrung mit LBMT in der Augenheilkunde zeigt, dass das schwache Laserlicht als eine neue therapeutische Option wertvoll und seine Anwendung gerechtfertigt ist.
In unserer medialen Welt gewinnen das Sehvermögen und damit zwangsläufig die regenerative Lasertherapie rapide an Bedeutung.
Ohne Unterstützung meiner tapferen Frau und unserer Kinder wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Ihnen gilt mein besonderer Dank.
München, im August 2018
INHALT
Vorwort
TEIL I KLINISCHE ERFAHRUNGEN
Laser und Sehschärfe
1.1 Therapie der Amblyopie bei Erwachsenen*
1.2 Behandlung der Amblyopie bei Kindern
1.3 Laser und Akkommodation
Laser und Glaukom
2.1 Lasertest zur Frühdiagnostik der okulären Hypertonie und des Glaukoms*
2.2 Glaukombehandlung durch Laserbestrahlung*
Hornhaut
3.1 Behandlung der Herpes-simplex-Viruskeratitis
3.2 Behandlung der neurotrophen Keratopathie
Linse
4.1 Laser und Katarakt
Uvea
5.1 Behandlung der Uveitis
Glaskörper
6.1 Behandlung der Glaskörpertrübungen
Retina
7.1 Behandlung der Chorioretinopathia centralis serosa
7.2 Therapie der altersbezogenen Makuladegeneration*
7.3 Behandlung der Makuladegeneration bei hoher Myopie
7.4 Behandlung der Makulaforamina
7.5 Behandlung der Retinopathia pigmentosa*
7.6 Behandlung der Retinopathia diabetica
7.7 Behandlung der Verschlüsse der Netzhautgefäße
Opticus
8.1 Behandlung der Opticusneuritis*
Blutungen
9.1 Behandlung der Augenblutungen
Augenmotilität
10.1 Behandlung der Motilitätsstörungen
TEIL II THERAPIEGRUNDLAGEN
Laser
1.1 Kohärenz
1.2 Monochromasie
1.3 Kollimiert stark
1.4 Emissionsart
1.5 Emissionsdauer
1.6 Einwirkungsdauer
1.7 Spotdurchmesser
1.8 Wellenlänge
1.9 Frequenz
1.10 Interferenz
1.11 Polarisation
1.12 Stärke
1.13 Dosis
1.14 Extinktion des Laserlichts durch die Augengewebe
1.15 Laserarten
1.16 Laserklassen
1.17 Vorteile der Laserlichts
1.18 Laseranwendung in der Ophthalmologie
1.19 Literatur
Anwendungsart der Laserbestrahlung
Wirkung der Laser
3.1 Thermische Wirkung
3.2 Mechanische Wirkung
3.3 Photochemische Wirkung
3.4 Literatur
Laser und neurovegetatives System
4.1 Laser und Sympathikus
4.2 Laser und Parasympathikus
4.3 Neurovegetatives System und Farben
4.4 Literatur
Laser und Retina
5.1 Retinale Stimulation / Inhibition
5.2 Photoisomerisierung
5.3 Phototransduktion
5.4 Membrankanäle, Depolarisation / Hyperpolarisation, Aktionspotenzialbildung
5.5 Ruhepotenzial der Zellmembran
5.6 Ruhepotenzial des Auges
5.7 Genexpression und Immunreaktion
5.8 Phagozytose und Autophagie
5.9 Flüssigkeitsaustausch
5.10 Vasodilatation
5.11 Regeneration
5.12 Literatur
Schadenschwelle der Laser
6.1 Literatur
Laser und Zellenergie
7.1 Energieverbrauch
7.2 Energiegewinnung
7.3 Literatur
Physikalisch-biochemische Betrachtungen
8.1 Materie/Energie
8.2 Energetische Wechselwirkungen
8.3 Energieumwandlungen
8.4 Valenzen/Polarisierung
8.5 Energieverbreitung und Kommunikation
8.6 Literatur
Lichtstimulus und Zellantwort
9.1 Literatur
Indikatoren in der Ophthalmologie
Behandlungsempfehlungen
Laser in der allgemeinen Medizin
Vorteile der Laserbestrahlung
Fazit
14.1 Literatur
Ausblick
15.1 Literatur
ANHANG
Kosmische Strahlung
1.1 Gamma- und Röntgen- Strahlen
1.2 Optisches Spektrum
1.3 Ultraviolette Strahlung
1.4 Sichtbares Spektrum
1.5 Ultrarotstrahlung
1.6 Hochfrequenzstrahlung
1.7 Mikrowellen
1.8 Radar, Radiowellen
1.9 Niederfrequenzstrahlung
1.10 Literatur
Licht und bestrahlte Materie
2.1 Extinktion
2.2 Reflexion
2.3 Streuung
2.4 Absorption
2.5 Transmission
2.6 Literatur
Absorption des optischen Spektrums in den Augengeweben
3.1 Literatur
Absorption der retinalen Pigmente
4.1 Rhodopsin
4.2 Jodopsine
4.3 Xanthophyll
4.4 Melanine
4.5 Hämoglobine
4.6 Flavine
4.7 Melanopsin
4.8 Lipofuszin
4.9 Wasser
4.10 Literatur
TEIL I
KLINISCHE ERFAHRUNGEN
1 LASER UND SEHSCHÄRFE
Das verlorene Sehvermögen konnte mit einer herkömmlichen Behandlung nur in Ausnahmefällen gebessert werden. Die nachfolgenden, prospektiven »Investigator Initiated Trials«-Beispiele zeigen, dass es nicht so bleiben muss.
1.1 Therapie der Amblyopie bei Erwachsenen*
*Ivandic T. Low-power Laser Therapie der Amblyopie bei Erwachsenen. DOG-Berlin, 2001
Ivandic BT, Ivandic T: Low-level laser therapy improves visual acuity in adolescent and adult patients with amblyopia. Photomed Laser Surg. 2012, 30 (3):167–171
Zusammenfassung
Hintergrund. Eine Amblyopiebehandlung ist nur im Kindesalter Erfolg versprechend. In dieser prospektiven klinischen Studie wird über erste Erfahrungen der Behandlung der Amblyopie bei Erwachsenen mit einem schwachen Laser berichtet.
Methode. Es wurden 178 Patienten (231 amblyope Augen) behandelt, deren Amblyopie bei 110 Augen durch Ametropie und bei 121 durch Strabismus verursacht war.
Die Behandlung wurde mit einem modulierten Dioden-Laser der Stärke 7,5 mW mit einer Wellenlänge von 780 nm, Frequenz 292 Hz, in kontinuierlicher Emission und einem Spot von ca. 3 mm2 Fläche, in 1 cm Entfernung vom Auge, durchgeführt.
Die Makulabestrahlung erfolgte von außen, senkrecht, transkonjunktival, bei maximalem nasalem Blick, im temporalen Bereich, 30 s lang (0,22 W/cm2). Durchschnittlich erfolgten pro Auge 3–4 Behandlungen (0,66–0,88 W/cm2) in 2–3 täglichen Abständen und ohne zusätzliche Okklusion oder Medikamentengabe. Eine Gruppe von 20 Augen wurde scheinbehandelt. Bei 12 Augen wurde ein M-VEP abgeleitet. Die statistische Signifikanz wurde mit dem t-Test überprüft.
Ergebnisse. Von allen behandelten Augen konnte bei 90 % eine unterschiedliche Besserung des Visus erzielt werden (p < 0,001). Bei der Amblyopie ex Ametropie konnte in 56,2%, bei der Strabismusamblyopie in 53,6 % der Augen eine Besserung des Visus um drei oder mehr Reihen erreicht werden. Der M-VEP zeigte eine Amplitudensteigerung +1207 nV (50%, p<0.001) und eine leichte Latenzverkürzung von 7 ms (5%, p<0,14).
Bei der Placebo-Gruppe blieb der Visus unverändert. Es wurde keine Nebenwirkung beobachtet.
Schlussfolgerung. Die ersten Behandlungen der amblyopen Augen bei Erwachsenen mit einem schwachen Laser zeigen, dass auch im fortgeschrittenen Alter eine anhaltende Besserung der Sehschärfe möglich ist. M-VEP-Besserungen bestätigen dies.
Schlüsselwörter. Amblyopie, Laserbiomodulationtherapie (LBMT), Photobiomodulationtherapie (PBMT), Low-Level Laser Therapie (LLLT), Phototherapie
Einleitung
Die Amblyopie wird definiert als Funktionsschwäche des Auges ohne erkennbare strukturelle Abnormität im okulo-zerebral-visuellen System oder mit einer erkennbaren Ursache, die nicht in adäquatem Verhältnis zur Visusminderung steht [1, 16, 28].
Ihre Ursache liegt neben der optischen Defokussierung und Anopsie in abnormer Binokularität und vermindertem visuellem Input, der zu einer Minderung der Funktionalität des visuellen Cortex führt [5, 12]. Bei Refraktionsfehlern resultiert eine ametrope Amblyopie wegen der qualitativ ungleichen retinalen Bilder und der Strabismusamblyopie durch visuelle Suppression der zentralen, foveolaren Fixation [5, 19]. Es wird angenommen, dass die Amblyopie bei Kindern im frühkindlichen Alter entsteht, in der sog. »sensitiven« Phase der Hirnentwicklung, die die ersten 60 Lebensmonate andauert [3, 6]. Nach der Geburt erfordert die normale Entwicklung des visuellen Systems eine ständige Reizung. Ohne diese Reize können sich die Axone der Ganglienzellen nicht bis zum Corpus geniculatum laterale, in dem die Umschaltung zum visuellen Cortex stattfindet, vollwertig entwickeln. Eine normale synaptische Verschaltung findet nur unzureichend statt. Die vorhandenen Neuronen im Corpus geniculatum laterale und im visuellen Cortex atrophieren [10, 12, 13, 18, 21, 29].
Als Konsequenz zeigen sich neben der Visusminderung pathologische Muster-Elektroretinogramme (M-ERG), visuell evozierte Potenziale (M-VEP) und Elektrookulogramme (EOG) am amblyopen Auge. Die funktionellen Störungen im gesamten retino-geniculo-corticalen System und im retinalen pigmentierten Epithel (RPE) belegen dies [2, 22, 23, 24, 33].
Die Okklusionstherapie ist neben der medikamentösen Vernebelung des führenden Auges nach optimaler Korrektur von Refraktionsanomalien die Therapie der Wahl [5, 7, 26, 30, 31]. Sie ist jedoch langwierig und kann psychologische Probleme bei Eltern und Kindern hervorrufen, woraus eine schlechte Compliance resultiert.
Durch Okklusionsbehandlung oder Penalisation wird das amblyope Auge häufiger und intensiver visuellen Reizen ausgesetzt, sodass eine Visusbesserung durch lückenlose Therapie bis zum 9. Lebensjahr möglich ist [1]. Jede spätere Therapie kann nur vereinzelt die vollständige Sehschärfe und Binokularität erreichen.
Eine Amblyopiebehandlung bei Erwachsenen sollte die berufliche Benachteiligung möglichst beseitigen und die Lebensqualität erhöhen [8, 9]. Unterschiedliche Ansätze wurden in neuerer Zeit bei Erwachsenen aufgegriffen, jedoch ohne den Nachweis zu erbringen, dass die Visusbesserung dauerhaft bleibt [10, 17, 25].
Hierbei stellt sich die Frage, ob eine Laserbestrahlung bei älteren Patienten mit Amblyopie von Vorteil sein kann oder nicht. Bei allen amblyopen Augen war nicht beabsichtigt, die volle Sehschärfe zu erreichen.
Methode
Um die Frage zu beantworten, ob eine Amblyopie auch nach dem 13. Lebensjahr positiv therapeutisch beeinflusst werden kann, wurden insgesamt 178 Patienten (103 männlich, 75 weiblich) behandelt. Der jüngste Patient war 13, der älteste 72 Jahre alt, durchschnittlich 46 Jahre. Es wurden 231 amblyope Augen (118 rechts, 113 links) unter Berücksichtigung der Deklaration von Helsinki und nach Patienteneinwilligung mit einem Low-Level Laser behandelt. Von 178 Patienten hatten 125 (70%) eine einseitige und 53 (30%) eine beidseitige Amblyopie.
Die Visuskontrollen erfolgten unter denselben Bedingungen. Bei der Kontrolle wurden, um das Erlernen zu vermeiden, nur noch nicht erkannte Optotypenreihen angeboten.
Die Daten wurden in Karteikarten dokumentiert und nachträglich ausgewertet. Der angewandte Dioden-Laser hatte eine mittlere Ausgangs-Strahlstärke von 7,5 mW und eine Wellenlänge von 780 nm, mit Emissionfrequenz von 292 Hertz, und einen Spot von 3 mm2 Fläche.
Für die Behandlung der Patienten wurde folgendes Vorgehen gewählt: Aus 1 cm Entfernung wurde das amblyope Auge mit dem Laser im unteren temporalen Quadranten, bei maximaler Adduktion, senkrecht, transkonjunktival in Projektion auf die Makula, 30 s lang (entsprechend einer Energiedichte 0,22 W/cm2), zweimal pro Woche bestrahlt. Durchschnittlich wurde 3- bis 4-mal (Total Dosis: 0,66–0,88 W/cm2) das amblyope Auge ohne Okklusion oder Vernebelung des führenden Auges behandelt. Es wurde so lange behandelt, bis die volle Sehschärfe am bestrahlten Auge erreicht war oder sich keine weitere Visusbesserung abzeichnete.
Bei den Patienten mit einer Amblyopie an beiden Augen wurde zuerst das Auge mit schlechterem Visus behandelt. Vor jeder Sitzung wurde unter den gleichen Bedingungen eine Visuskontrolle mit optimaler Refraktionskorrektur durchgeführt.
Um visuelle Funktionsveränderungen zu objektivieren, wurden bei 12 amblyopen Augen Muster-visuell evozierte Potenziale (M-VEP) mit einem »Retiport« (Fa. Roland Consult, Wiesbaden) nach international empfohlenen Kriterien (www.iscev.org) abgeleitet und komparativ ausgewertet. Die Randomisierung erfolgte per Zufallsbestimmung.
Dabei wurde der Laserstrahl über die Nasenwurzel, ohne das Auge zu tangieren, vom Patienten weggerichtet. Während der Behandlung stand das Auge in maximaler Adduktion. Alle zehn Sekunden ertönte ein akustischer Ton, der vom Patienten als Behandlungsablauf interpretiert wurde.
Zum statistischen Vergleich der Untersuchungsergebnisse vor und nach Therapie wurde der t-Test für verbundene Stichproben herangezogen. Der Wert p<0,05 wird als signifikant betrachtet.
Das Ziel der Studie war die Frage, ob es grundsätzlich möglich ist, mit der Laserbiomodulation-Therapie (LBMT) die Sehschärfe von amblyopen Augen bei Erwachsenen zu bessern. Die Absicht war nicht, die volle Sehschärfe bei allen Augen wieder herzustellen. Weder der behandelnde Arzt noch die Teilnehmer der Studie hatten finanzielle oder andere Vorteile.
Ergebnisse
Die im Voraus gemessenen Untersuchungen am frisch enukleierten Schweinsauge ergaben, dass bei einer transkonjunktivalen Bestrahlung mit einer Laserstärke von 10,5 mW alle Augenschichten durchquert werden können. Nach Extinktion von 10,3 mW durch alle Augenschichten wurde noch 0,2 mW Strahlstärke an der inneren Netzhautseite gemessen. An das RPE gelangt nur eine Energiestärke von 1,2 mW, bevor sie fast vollständig absorbiert wird
Bei der Amblyopie ex Ametropie konnte bei der Überprüfung des Fernvisus eine positive Veränderung (91%, p < 0,001) festgestellt werden.
Der Fernvisus stieg um eine Optotypenreihe nach Snellen bei 7 (6%) Augen an. 31 (28%) Augen verbesserten sich um zwei, 25 (23%) um drei, 16 (14%) um vier, 14 (13%) um fünf, 4 (4%) um sechs und 3 (3%) um sieben Reihen. Bei 10 (9%) Augen blieb der Visus nach der Behandlung unverändert (Tabelle 1).
Bei der Strabismusamblyopie kam es bei 107 Augen (89%, p < 0,001) zu einer teilweise deutlichen Visuszunahme. Bei 24 (20%) Augen verbesserte sich die Sehschärfe um eine Reihe, bei 18 (15%) Augen stieg sie um zwei, bei 23 (19%) um drei, bei 20 (16%) um vier, bei 17 (14%) um fünf, bei 3 (3%) um sechs und bei 2 (2%) um 7 Optotypenreihen. Bei 14 (11%) Augen blieb der Visus unverändert (Tabelle 2). Es wurden keine lokalen, systemischen Nebenwirkungen oder Diplopie beobachtet.
Abb. 1 zeigt exemplarisch den Langzeitverlauf einer Patientin mit Strabismus und Ametropieamblyopie, die über 13 Jahre nachverfolgt und mehrfach untersucht wurde.
Abb. 1:Therapieverlauf bei amblyopia mixta
Therapieverlauf bei einer 13-jährigen Patientin (zu Beginn der Therapie) mit Ametropie (OS, obere Kurve) und Esotropieamblyopie (OD, untere Kurve):A:Ausgangsvisus und Veränderung bei den ersten Behandlungen.
B: Visus nach 10 Monaten Behandlungspause und nach erneuter Behandlung.
C: Visus nach 29 Monaten Therapiepause und nach dreimaliger Behandlung.
D: Visus 10 Jahre später ohne und nach erneuter Behandlung. Das führende Auge (OS) hat den bereits vor zehn Jahren erreichten Visus behalten, der Visus des esotropen Auges (OD) fiel fast auf den Ausgangswert zurück, erreichte jedoch nach vier Behandlungen den Höchstwert.
Der Ausgangsvisus mit der Korrektur (sph +3,5 cyl -4,0/10°D) stieg rechts von 20/100 auf 20/25 und links (sph +3,0 cyl -3,0/175°D) von 20/30 auf 20/16. Die Amplitude der M-VEP stieg rechts von 1267 auf 1471 (>214) nV, links von 2173 auf 3091 (>918) nV bei gleichbleibender Latenz (120 ms).
Amplitude [nV]
Latenz [ms]
Visus
n
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
1
2438
3532
128
128
20/63
20/25
2
1280
1903
121
116
20/80
20/25
3
1267
1471
120
120
20/40
20/20
4
2173
3091
120
120
20/200
20/25
5
1803
2248
125
125
20/40
20/16
6
1445
2019
125
125
20/40
20/32
7
2295
4469
125
125
20/32
20/25
8
4296
6794
195
153
20/63
20/32
9
6543
7530
195
195
20/80
20/16
10
558
1847
120
120
20/100
20/32
11
2248
3916
160
125
20/40
20/16
12
2592
4603
125
125
20/25
20/16
Durchschnitt
2412
3619
138
131
20/66,9
20/23,3
Veränderung [%]
+ 50,0
– 5,3
+188
Tabelle 3:M-VEP und Visus bei amblyopen Augen vor und nach Behandlung.
A
B
C
Abb. 2:M-VEP der Strabismusamblyopie vor und nach der Therapie. Die Abbildung zeigt M-VEP einer 65-jährigen Patientin mit Strabismusamblyopie mit parafovealer Fixation am linken Auge vor (A, untere Kurve) und nach sechsmaliger Bestrahlung (B). Überlagerte Darstellung beider Kurven (C). DieC-Kurve zeigt, dass sich die Amplituden nach der Behandlung des linken Auges angeglichen haben (>1094 nV) und das nicht behandelte Auge unverändert blieb. Der Visus besserte sich durch die Bestrahlung von 20/70 auf 20/30.
Diskussion
Die Untersuchungen am Schweinsauge zeigten, dass bei einer transkonjunktivalen Laserbestrahlung schon eine geringe Strahlstärke ausreicht, um Sklera und Chorioidea zu durchqueren und das RPE und die Retina zu erreichen, um dort einen positiven biochemischen Effekt zu erzielen. Bei dieser Laserstärke waren keine schädigende thermische Wirkung und somit auch keine anatomischen Netzhautschäden zu erwarten.
Obwohl die Netzhaut diese Wellenlänge nur im geringen Umfang absorbiert, ihr eventueller Schaden also ausgeschlossen ist, wurde auf eine transpupilläre Bestrahlung der Makula aus psychologischen Gründen verzichtet. Die gewählte Laserwellenlänge hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie gerade noch sichtbar ist, d. h. keine Blendung, Nachbilder oder Phosphene verursacht und bei der Proteinsynthese günstig wirkt [14].
Der Therapieerfolg war im Wesentlichen vom Ausgangsvisus abhängig. Die Visusbesserung lässt sich schnell erreichen. Schon 30 Min. nach Bestrahlung ist es möglich, besonders bei einem jüngeren Teilnehmer, eine Visusveränderung festzustellen. Nach durchschnittlich dreimaligen Behandlungen waren fast alle Augen positiv verändert. Der Visusanstieg war statistisch hochsignifikant in beiden Gruppen.
In den therapieresistenten Fällen mit Strabismusamblyopie handelte es sich zumeist um Augen mit hochgradiger Amblyopie, schlechtem Ausgangsvisus (≤ 0,2) und exzentrischer Fixation. Bei denjenigen Patienten, bei denen binokulares Sehen erreicht werden konnte, blieb die erreichte Sehschärfe teilweise auch ohne weitere Therapiesitzungen bestehen. Bei den restlichen Patienten ohne bzw. mit Strabismusamblyopie wurde häufiger ein langsamer Rückgang auf den ursprünglichen Visus beobachtet (Abb. 1).
Unter regelmäßiger Verlaufskontrolle und, falls notwendig, durch erneute Bestrahlung (zunächst alle drei Monate, später jährlich) kann ein Therapieerfolg jahrelang anhalten und ohne erneute Laserbestrahlung auf hohem Niveau stabilisiert werden. Eine Amblyopie an einem Auge verdoppelt das lebenslange Risiko einer beidseitigen Sehbehinderung [32]. Dies erklärt, warum eine doppelseitige Amblyopie so häufig vorkommt. Durch die kurze Therapiedauer ohne störende Okklusion und Medikamentengabe wird eine verbesserte Patientencompliance erreicht.
Die Erhöhung der M-VEP Amplitude kann als zusätzliche Bestätigung einer Hyperpolarisation bzw. Steigerung des negativen intrazellulären Potenzials betrachtet werden. Die Amplitude steigt nicht proportional zur positiven Visusänderung an. Die Latenz war, wie erwartet, nicht signifikant verändert.
Es wurden bei Patienten mit Strabismusamblyopie neben der Visusbesserung auch eine Verkleinerung der Schielwinkel und Refraktionsveränderung beobachtet. Mit überlegter Behandlungsstrategie wäre es möglich, besonders bei kleinen Kindern, die auf die Therapie prompt reagieren, auch den Schielwinkel zu verkleinern. Durch das Laserlicht wird der muskuläre Tonus gesteigert.
Der exakte Wirkungsmechanismus der LBMT ist noch nicht bekannt [15]. Aus zellphysiologischen Untersuchungen ist bekannt, dass durch Reizstimulation mittels Laserlicht der physiologische zelluläre Metabolismus gesteigert wird. Vermutlich wird dadurch der Regenerationszyklus von Rhodopsin im RPE und in den Photorezeptoren gebessert. Das würde auch den raschen Visusanstieg erklären, der von der Rhodopsinmenge abhängig ist. Die energieabhängigen biochemischen Prozesse werden durch die ATP-Synthesesteigerung ausgelöst und gesteigert [14].
Der nach erfolgreicher Behandlung einsetzende kontinuierliche visuelle Reizzufluss könnte dann den erreichten Visus durch ständige Stimulation des amblyopen Auges auf dem verbesserten Niveau erhalten. Die visuelle Stimulation kortikaler Zentren unterstützt diesen Prozess wiederum durch eine reaktive Steigerung des regionalen Blutflusses [27]. Weitere Mechanismen, die möglicherweise den Erfolg der LBMT erklären könnten, betreffen Zahl und Qualität der interneuronalen Synapsen. Der rasche Visusanstieg ist auch durch eine Synaptogenese und Bildung von »spins«, die sich in kurzer Zeit vollziehen können [13], vorstellbar. Gegebenenfalls würden sich damit auch die beobachteten Skotomebesserungen erklären.
Die vorgelegten ersten positiven Erfahrungen mit der LBMT bei der Amblyopie bei Erwachsenen sollten im Rahmen kontrollierter Studien mit größeren Kollektiven und definierter Nachbeobachtungszeit gesichert werden. Vermutlich kann diese Behandlungsmethode sowohl in der Therapie von bereits amblyopen Kindern als auch zur Verhütung der Amblyopie bei kindlichem Strabismus oder angeborener Katarakt wirksam sein. Je früher die Behandlung beginnt, desto schnellere und günstigere Ergebnisse sollten sich dabei erzielen lassen. In diesen kontrollierten Untersuchungen sollten bekannte Begleitstörungen wie Gesichtsfelddefekte, Farbsinnstörungen, Fusionsdefizite, Veränderungen der Stereosehens, mögliche Reduzierung der Schielwinkel und der neuronalen Verarbeitung [4, 11, 19, 20] berücksichtigt und die Ergebnisse mit der herkömmlichen Therapie der Okklusion und Vernebelung verglichen werden.
Wegen intrachiasmatischer Nervenfasern-Kreuzungen könnte sich eine zusätzliche Bestrahlung der nasalen Retina des nicht amblyopen Auges eventuell als vorteilhaft erweisen. Ebenfalls sollte untersucht werden, ob eine zusätzliche transkraniale, transorbitale oder parabulbäre Laserbestrahlung des visuellen Cortex, dessen Neuronen und synaptische Verbindungen unentwickelt geblieben sind, noch bessere Ergebnisse liefern kann. Eine Bestrahlung der gesamten Retina an den beiden Augen mit Erhöhung der Dosis oder mit anderen Wellenlängen ist auch denkbar. Dabei würde mehr Energie an den entsprechenden visuellen Cortex geleitet, der neuronale Metabolismus bzw. antero-retrograde axonale Fluss optimiert und somit ein noch besserer und dauerhafter Erfolg erzielt. Normalerweise bilden die kortikalen Zielzellen Neurotrophine und dirigieren das Axonenwachstum der retinalen Ganglienzellen. Ihre Hypofunktion sollte Aufgabe der Behandlung sein. Auch eine längere Behandlungsstrategie ist erforderlich.
Fazit
Die Vorteile der LBMT für Patienten und Therapeuten sowie die geringen Kosten rechtfertigen umfangreichere klinische Untersuchungen, denen diese vorläufigen Ergebnisse als Grundlage dienen sollen.
Literatur
1. Avedikian H. Amblyopie. Spektrum der Augenheilkunde 1995, (Suppl 9): 13: 1–13
2. Boschi MC, Castellani E, Sodi A. L’analyse de Fourier dans l’étude électrophysiologique de l’amblyopie strabique. Ophtalmologie 1991, 5: 403–405
3. Daw NW. Mechanisms of plasticity in the visual cortex: the Friedewald lecture. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994, 35: 4162–4179
4. Donahue Spet al. Automated perimetry in amblyopia: a generalized depression. Am J Ophthalmol 1999, 127: 312–321
5. Duke-Elder S, Wybar K. System of Ophthalmology. Vol. VI. Ocular motility and Strabismus. Henry Kimpton, London 1973, s. 421–487
6. Epelbaum M et al. The sensitive period for strabismic amblyopia in humans. Ophthalmology 1993, 100: 323–327
7. Foley-Nolan A, McCann A, O’Keefe M. Atropine penalisation versus occlusion as the primary treatment for amblyopia. Br J Ophthalmol 1997, 81: 54–60
8. Haase W. Amblyopien, Teil I. Diagnose. Ophthalmologe 2003, 100: 69–87
9. Haase W. Amblyopien, Teil II: Vorsorge und Therapie. Ophthalmologe 2003, 100: 160–174
10. Harrer S, Hehm J, Nemetz U. Amblyopiebehandlung aus pathogenetischer Sicht. Spektrum Augenheilkunde 1992, 6: 79–80
11. Hofeldt TS, Hofeldt AJ. Measuring colour rivalry suppression in amblyopia. Br J Ophthalmol 1999, 83: 1283–1286
12. Hubel DH. Exploration of the primary visual cortex. Nature 1982, 299: 515
13. Kalil RE. Nervenverknüpfung im jungen Gehirn. In: Spektrum der Wissenschaft. Physiologie der Sinne. Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Heidelberg, 1994, 150–157
14. Karu TI. Ten Lectures on Basic Science of Laser Phototherapy. Prima Books AB 2007, Grängesberg, Schweden
15. King PR. Low level laser therapy: a review. Lasers Med Sci 1989, 4: 141–150
16. Lang J. Die Amblyopie und ihre Behandlung. Ophthalmologe 1997, 97: 606–618
17. Levi DM, Polat U, Hu YS. Improvement in vernier acuity in adult with amblyopia. Invest Ophthalmol Vis 1997, 38: 1493–1510
18. Marre M, Marre E. Colour vision in squint amblyopia. Mod Probl Ophthalmol 1978, 19: 308–313
19. McKee SP, Harrad RA. Fusional suppression in normal and stereo anomalous observers. Vision Res 1993, 33: 1645–1658
20. Nawratzki I, Auerbach E, Rowe H. Amblyopia ex anisometropie. Am J Ophthalmol 1996, 61: 430–435
21. Nemetz U, Harrer S. Die Amblyopie als Ausdruck einer postnatalen Entwicklungsstörung im Bereich des Zentralnervensystems. Spektrum Augenheilkunde 1992, 6: 72–78
22. Noorden GK. Amblyopiebehandlung. Fortschr Ophthalmol 1990, (Suppl 87): 149–154
23. Norcia AM, Garcia H, Humphry R et al. Anomalous motion VEPs in infants and in infantile esotropia. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991, 32: 436–439
24. Paris V. Un nouveau concept du strabisme: la biocularité. Ophtalmologie 1991, 5: 371–373
25. Polat U et al. Improving vision in adult amblyopia by perceptual learning. Proc Natl Sci 2004, 101: 6692–6697
26. Repka MX, Krake RT, Holmes JM et al. Atropin vs patching for treatment of moderate amblyopia: follow-up at 15 years of age a randomised clinical trial. Jama Ophthalmol 2014, 132: 799–805
27. Schiefer U et al. Activity during stimulation: a positron emission tomography and functional magnetic resonance imaging study. German J Ophthalmol 1996, 5: 109–117
28. Schrader W, Witschel H. Behandlungsmöglichkeiten bei kongenitaler und frühkindlicher Katarakt. Ophthalmologe 1994, 91: 553–571
29. Tychsen L, Burkhalter H, Boothe R. Funktionelle und strukturelle Abnormitäten im visuellen Cortex bei frühkindlichem Strabismus. Klin Monatsbl Augenheilkunde 1996, 208: 18–22
30. Vagge A, Nelson LB. Amlyopia update: new treatments. Cur Opin Ophthalmol 2016, 27: 380–386
31. Wallace MP, Stewart CE, Maseley MJ, Stephens DA, Fielder AR, MOTAS and ROTAS Cooperatives. Treatment of amblyopia using personalized dosing strategies: statistical modeling and clinical implementation. Strabismus 2016, 24: 161–168
32. Van Leeuwen R, Eijkemans MJ, Vingerling JR et al. Risk of bilateral visual impairment in individuals with amblyopia: the Rotterdam study. Br J Ophthalmol 2007, 91: 1450–1451
33. Williams C, Papakostopoulos D. Electro-oculographic abnormalities in amblyopia. Br J Ophthalmol 1995, 79: 218–224
1.2 Behandlung der Amblyopie bei Kindern
Zusammenfassung
Hintergrund. Die Amblyopie bei kleinen Kindern stellt ein therapeutisches Problem dar.
Methode. Wie bei den Erwachsenen (Kap.1.1).
Ergebnisse. Positive Ergebnisse sind bereits nach einer einmaligen Bestrahlung zu erwarten. Im Vergleich mit der Okklusionstherapie stellt die Laserbestrahlung eine große Erleichterung für kleine Patienten und den behandelnden Arzt dar. Sie ist nicht-invasiv, kurz und schmerzlos.
Schlussfolgerung. Die klinischen Studien sind dringend erforderlich.
Schlüsselwörter. Strabismus, Schielen, Schwachsichtigkeit, LBMT, LLLT.
Einleitung
Die Behandlung der kindlichen Amblyopie ist bis zum sechsten Lebensjahr erfolgsversprechend. Die Okklusion oder Penalisation ist Mittel der Wahl [1, 2].
Die Behandlungen sind langwierig und lästig für Kinder und Familie. Die Ergebnisse waren nicht immer zufriedenstellend. Auf Basis der Erfahrung mit Einzelfällen wird die Laserbestrahlung empfohlen.
Methode
Die Art der Behandlung der Amlyopie ist bei Kindern identisch mit der Behandlung der Amblyopie bei Erwachsenen (Kap.1.1). Je nach Alter des Kindes können Laserstärke (1–5 mW) oder Behandlungszeit verringert werden. Die Therapiedauer ist individuell. Die kindlichen Augen reagieren sehr schnell auf Bestrahlung. Die Zahl der Behandlungen fällt geringer aus als bei Erwachsenen. Eine Okklusion oder Vernebelung des führenden Auges ist dabei nicht erforderlich. Am Anfang sind tägliche Kontrollen ratsam, danach in größeren Abständen.
Ergebnisse
Die Ergebnisse sind stets positiv und in kurzer Zeit zu erreichen.
Diskussion
Je früher die Behandlung erfolgt, desto schneller und stabiler ist ein Erfolg zu erzielen. Wenn neben Amblyopie zusätzlich ein Strabismus vorliegt, dann sollte verfahren werden wie bei Erwachsenen (Kap. 10.2).
Fazit
Klinische Studien sind dringend erforderlich. Dabei sollen zusätzlich Refraktion -und Schielwinkelveränderung untersucht werden.
Literatur
1. Repka MX, Krake RT, Holmes JM et al. Atropin vs patching for treatment of moderate amblyopia: follow-up at 15 years of age a randomised clinical trial. Jama Ophthalmol 2014, 132: 799–805
2. Vagge A, Nelson LB. Amlyopia update: new treatments. Cur Opin Opthamol 2016, 27: 380–386
1.3 Laser und Akkommodation
Zusammenfassung
Hintergrund. Die Behandlung der Akkommodationstörungen ist schwierig.
Methode. Bestrahlung des corpus ciliaris mit Laser (780 nm,10 mW, 0,3 W/cm2 Dosis).
Ergebnisse. Eine vorteilhafte Steigerung der Akkommodation bei Presbyopen wurde 30 Min. nach einer Laserbestrahlung festgestellt (+1,0 ± 0,5 D).
Schlussfolgerung. Die Akkommodationsstörungen können durch Laserbestrahlung günstig beeinflusst werden. Klinische Studien sind erforderlich.
Schlüsselwörter. Behandlung, Akkommodationsstörungen, LLLT, LBMT
Einleitung
Die Akkommodation ist die Fähigkeit des Auges, alle Punkte zwischen Fern- und Nahpunkt durch Verstärkung der Linsenbrechkraft scharf abzubilden. Dies wird hauptsächlich durch die Kontraktion des Ziliarmuskels, Erschlaffung der Zonulafasern und Steigerung der Linsenwölbung erreicht [3, 5]. Der Ziliarmuskel ist im corpus ciliaris gelagert und wird aus glatten Muskelfasern gebildet. Die longitudinalen Fasern von Brucke-Wallace wirken auf Trabekelwerk und Schlemmschen Kanal. Ihr radiärer durch den Sympathikus innervierter Teil spannt die Zonulafasern an. Der zirkuläre Rouget-Müller-Muskel, der durch parasympathische Äste des Nervus ciliaris innerviert ist, verursacht durch seine Kontraktion die Akkommodation. Dabei werden die Zonulafasern entspannt und die Linse steigert ihre Brechkraft durch die vordere Krümmungsteigerung.
Die Desakkommodation wird durch die longitudinalen, durch die vom Sympathikus innervierten radiären Muskelfasern von Brücke-Wallace mit ihren elastischen Sehnen und Zonulaplexus verursacht. Dabei werden die Zonulafasern angespannt, die Linsenkapsel zur Seite gezogen und die Linse flacht sich ab [5, 8]. Zusätzlich wird die Akkommodation von Konvergenz und Miosis begleitet und stellt ein komplexes, noch nicht ganz geklärtes Reflex-Phänomen dar.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Akkommodationsfähigkeit wegen des Verlusts der Elastizität der Linsenfasern und der Muskelkontraktionsfähigkeit ab und wird durch optische Sehhilfen oder operativ korrigiert [1, 2, 3, 4].
Methode
Eine Störung der Nervenfasern kann zum partiellen oder totalen Ausfall der Akkommodation führen. Ein Akkommodationskrampf, eine akkommodative Asthenopie, die durch die muskuläre Überanstrengung, meistens durch latente Hyperopie, verursacht wird, sowie Paresen der Ziliarmuskeln können durch Laserbestrahlung im Limbusbereich und / oder über den Ganglion ciliare günstig beeinflusst werden.
Ergebnisse
Eine vorteilhafte Steigerung der Akkommodation bei Presbyopen wurde 30 Min. nach einer Laserbestrahlung festgestellt (+1,0 ± 0,5 D).
Diskussion
Die Steigerung der Akkommodation beruht vermutlich auf muskulärer Tonussteigerung der durch den Parasympathikus innervierten muskulären Fasern. Eine Steigerung der ATP und Glutathionsynthese wird vermutet. Diese liefern die Energie für die biochemischen Prozesse der Linse und steigern ihre Leistungsfähigkeit. Die klaren Linsenfasern und Epithelzellen bilden sich lebenslang. Dabei wird viel freie Energie verbraucht.
Die ATP-Synthese nimmt mit zunehmendem Alter ab, ebenso die Kontraktionsfähigkeit des Rouget-Müllers-Muskels, der Zonula und der Linsenfasern. Die Relation bzw. die Abhängigkeit der Akkommodation und ATP / Glutathion sollten genauer untersucht werden.
Laserlicht steigert den Zellmetabolismus [6], bessert somit die gesamte Augenfunktion.
Es handelt sich hier nicht um eine Auslösung der Akkommodation, sondern um ein 3–6 Monate andauerndes Phänomen, d. h. eine Steigerung der Akkommodationsfähigkeit. Dies wurde auch bei Bestrahlung der corpus ciliare bei Nystagmus festgestellt [7].
Die pupillären Störungen können auf die gleiche Art wie die Akkommodationsstörungen behandelt werden.
Fazit
Die Bestrahlung des Auges im Limbusbereich mit Infrarotlicht, 780 nm, verursacht eine Steigerung der Akkommodationskraft. Diese Beobachtung benötigt eine Bestätigung durch weitere klinische Studien.
Literatur
1. Becker KA, Jaksche A, Holtz FG. Presby Lasik. Ophthalmologe 2006, 103: 667–672
2. Bischoff G. Ausgleich der Presbyopie mit Kontaktlinsen. Ophthalmologe 2006, 103: 655–660
3. Helmholtz von H. Über die Akkommodation des Auges. Albrecht von Graefes Archiv Klein Exp Ophthalmologie 1855, 1: 1–74
4. Holzer MP, Rabsilber TM, Auffarth GU. Presbyopiekorrektur mittels Intraokularlinsen. Ophthalmologe 2006, 103: 661–666
5. Lütjen-Drecoll E, Rohen JW. Augenwunder. Kaden Verlag 2007, S. 54, Heidelberg
6. Oron U. Of tissue repair in skeletal and cardiac muscles. Photomed Laser Surg. 2006, 24: 111–120
7. Smolianinova IL, Kashchenko TP, Anikina EB, Proskurina OV. Possibilities of use of low-energy effects on the ciliary body in optic nystagmus. Vestern Oftalmol 1995, 111: 15–17
8. Solé P, Dalens H, Gentou C. Biophtalmologie. Masson 1992, Livre IV, S. 10, Paris
2 LASER UND GLAUKOM
Der Laser wird beim Glaukom bis dato ausschließlich für operative Zwecke angewandt. Hier wird über biostimulative Anwendungen der Laser beim Glaukom berichtet.
2.1 Lasertest zur Frühdiagnostik der okulären Hypertonie und des Glaukoms*
*Ivandic BT, Hoque N, Ivandic T. Early diagnosis of ocular hypertension using a low-intensity laser irradiation test. Photomedicine and Laser Surgery 2009, 4: 571–575
Zusammenfassung
Hintergrund. Die Unsicherheit bei der Glaukomdiagnostik resultiert auch daraus, dass man den individuellen, physiologischen intraokulären Druck (IOD) nicht kennt. Mittels Laserbestrahlung sollen die Augen mit okulärer Hypertonie von normotonen Augen unterschieden werden.
Methode. 1. Um sicherzustellen, dass der IOD in 30 Min. unverändert bleibt, wurde im Voraus bei 30 Patienten, 60 Augen, innerhalb 30 Min. zweimal eine Applanationstonometrie durchgeführt.
2. Bei einer Gruppe von 123 Patienten, 211 scheinbar gesunden Augen, wurde der IOD vor und 30 Min. nach einer einmaligen, 30 s langen Bestrahlung im Limbusbereich mit kontinuierlichem Laserlicht (7,5 mW, 780 nm, 292 Hz) mittels Applanationstonometrie bestimmt. Um festzustellen, dass die Wirkung auf das bestrahlte Auge begrenzt bleibt, wurden 35/123 Patienten nur einseitig bestrahlt.
3. Bei der Placebo-Gruppe, 10 Patienten, wurden 20 Augen scheinbehandelt. Die erhobenen Messwerte vor und nach Bestrahlung wurden mit dem t-Test für verbundene Stichproben auf ihre statistische Signifikanz überprüft.
Ergebnisse 1. Der IOD bleibt normalerweise innerhalb 30 Min. unverändert (14 ± 1 mm Hg).
2. 44/211 Augen hatten bei der ersten Tonometrie einen IOD von 24,1 mm Hg im Durchschnitt, also eine okuläre Hypertonie. Nach der Bestrahlung war der IOD nach 30 Min. durchschnittlich um -6,2 mm Hg (-25,7%, p <0,001) gesunken.
3. 167/211 Augen hatten bei der ersten Tonometrie einen IOD von 17 mm Hg im Durchschnitt, also eine okuläre Normotonie. 30 Min. nach der Bestrahlung war der IOD um 2,9 mm Hg (-17%, p < 0,001) gesunken und zeigte vier verschiedene Muster. Die Wirkung der Laserbestrahlung blieb auf das bestrahlte Auge begrenzt. Es waren keine Nebenwirkungen zu beobachten.
In der Placebo-Gruppe änderte sich der IOD nur geringfügig (14,2 ± 1 mm Hg).
Schlussfolgerung. Ein erhöhter IOD sinkt nach einer schwachen Laserbestrahlung stets. Besonders bei einem IOD < 21 mm Hg kann eine Senkung um mehr als 2 mm Hg oder 20 % auf einen erhöhten IOD hindeuten. Die okuläre Hypertonie wird als eine Sekretions- / Exkretionsstörung des Kammerwassers mit IOD-Erhöhung betrachtet und in drei Stufen eingeteilt: leicht (I), moderat (II) und schwer (III).
Schlüsselwörter. IOD, okuläre Hypertonie, Glaukom, Diagnostik, Klassifikation, Lasertest
Einleitung
Das Glaukom ist eine progrediente chronische Erkrankung, über die wir trotz großer Bemühungen nur sehr unvollständig Bescheid wissen [14]. Obwohl noch immer unterschiedliche Einteilungen und sogar Glaukomdefinitionen vorhanden sind [8, 15], wird das Glaukom als eine Optikusneuropathie, begleitet von progressivem Gesichtsfeldverlust und erhöhtem Augendruck, betrachtet. Die Diagnose eines fortgeschrittenen Glaukoms beruht auf charakteristischen, pathologischen Veränderungen des Sehnervkopfes und / oder Gesichtsfelddefekten und erhöhtem intraokulärem Druck und bereitet keine diagnostischen Probleme. Der funktionelle und anatomische Schaden wird als direkte Konsequenz des erhöhten Augendrucks angesehen [1, 2, 12, 21]. Hierüber wird kontrovers diskutiert [3, 23, 27], da die Steigerung des IOD als wichtigster »Risikofaktor« für die Entstehung eines Optikusschadens gilt. Der IOD korreliert jedoch nicht immer mit dem Ausmaß des klinischen Bildes und verursacht somit eine diagnostische Unsicherheit. So finden sich »typische glaukomatöse« Gesichtsfeldeinschränkungen mit Optikusschaden beim »statistisch noch normalen« IOD (< 21 mm Hg). Ein erhöhter IOD ohne nachweisbaren anatomischen Schaden wird als okuläre Hypertonie bezeichnet.
Eine frühe Diagnosestellung des Glaukoms bzw. der okulären Hypertonie ist trotz elektrophysiologischer [19] und perimetrischer Fortschritte [9, 13, 24] umso schwieriger, als man den individuellen, physiologischen IOD sowie dessen tägliche Schwankungen, eventuelle pathologische Abweichungen und deren Dauer nicht kennt, obwohl diese auch als unabhängige Risikofaktoren beim Glaukom gelten [4]. Auch Versuche mittels Provokationstests wie Wassertrinken, Koffeinzufuhr, Gabe von Medikamenten haben sich nicht als zuverlässig erwiesen [6, 7].
Abweichend von den bekannten diagnostischen Verfahren des primären Offenwinkelglaukoms wird hier über neue Möglichkeiten für eine Frühdiagnostik der okulären Hypertonie bzw.des Glaukoms berichtet. Dazu wird das Auge mit einem schwachen Laser im Limbusbereich bestrahlt und die Veränderung des IOD danach untersucht.
Das Ziel der neuen Methode ist, den individuellen physiologischen IOD zu finden, ggf. seine pathologischen Abweichungen zu erkennen und so hypertone oder glaukomatöse Augen besser von gesunden zu unterscheiden.
Methode
Der Visus wurde mit Projektionsoptotypen nach Snellen von American Optical in 20 Fuß, 6 m Entfernung bestimmt. Der Ausgangswert des IOD wurde mithilfe der Applanationstonometrie (Goldmann-Applanationstonometer der Fa. Zeiss, Oberkochen) an beiden Augen gemessen. Danach wurde beidseits im Limbusbereich bzw. Corpus ciliare sowie Trabekelwerk, Schlemmschem Kanal und episkleralen Venen im Abstand von 1 cm, senkrecht zirkulär, jeweils 30 s lang (0,22 W/cm2) bestrahlt. Die Bestrahlung wurde mit einem schwachen Dioden Laser (Fa. Bimed, München) durchgeführt. Sein Licht der Stärke 7,5 mW, 780 nm Wellenlänge und Frequenz von 292 Hz wurde während der Applikation mit einem elliptischen Spot von 3 mm2 Fläche auf 1 cm Entfernung kontinuierlich emittiert. Nach 30 Min. wurde die zweite Tonometrie durchgeführt. Durch Subtraktion der absoluten Druckwerte, die vor und nach Laserbestrahlung gemessen wurden, konnte die relative Differenz des IOD ermittelt werden. Biomikroskopische Untersuchungen der vorderen Augenabschitte erfolgten mit Spaltlampe (Fa. Zeiss, Oberkochen) und Fundusuntersuchungen mit direktem Ophthalmoskop (Fa. American Optical).
Dieses Vorgehen wurde, unter Berücksichtigung der Helsinki-Deklaration und vorheriger Patienteneinwilligung, an 123 Patienten (64 Männern, 59 Frauen, Altersdurchschnitt 59 ± 12 Jahre), bei 211 Augen (109 rechts / 102 links) durchgeführt. Um festzustellen, ob die Wirkung nur auf das bestrahlte Auge begrenzt bleibt, wurden 35 von 123 Patienten nur einseitig bestrahlt.
Inklusion: Es wurden nur die Augen bestrahlt, bei denen mittels direkter Ophthalmoskopie und Biomikroskopie keine pathologischen Befunde, insbesondere keine glaukomatösen Veränderungen, am vorderen und hinteren Augenabschnitt festgestellt wurden.
Exklusion: Die Patienten mit anderen Augen- oder systemischen Erkrankungen oder die unter einer medikamentösen Behandlung standen, wurden nicht berücksichtigt. Die Patienten, die zufällig zu Untersuchungen kamen, wurden aus der Ambulanz rekrutiert.





























