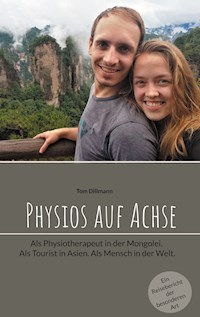
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Anfang 2017 kündigen meine Frau und ich unsere Jobs, um eine mongolische Fördereinrichtung für schwerbehinderte Kinder und Jugendliche physiotherapeutisch zu unterstützen. Zungenbrecherische Namen, wildfremde Erziehungsmethoden, fliegende Windeln, landestypische Essgewohnheiten und gefährliche Straßen halten uns nicht davon ab, einer Tätigkeit nach zu gehen, die uns einnimmt, uns erfüllt, die einen unglaublichen Wert hat. Nach zwei Monaten fernab vom Alltag, packen wir erneut unsere Rucksäcke und reisen nach China, wo uns unsere Reiseroute vom Himmelstempel in Peking bis zu in die Wolken ragenden Felsen im Nationalpark Zhangjiajie führt. Im südlichen Vietnam droht der gemeinsamen Reise ein plötzliches Ende, doch der Kontrast zwischen bettelnden Kindern und pompösen Regierungssitzen auf der einen und uralten Tempelruinen inmitten gigantischer Natur und Pizza satt auf der anderen Seite lässt uns in Kambodscha neue Kraft tanken. Der Klang fliegender Fäuste, der Geruch rasender Tuk-Tuks, das Fühlen einer traditionellen Thai-Massage, der Geschmack unbeschreiblichen Street Foods und das Strahlen goldener Buddhas in den Augen regt nochmals jeden unserer Sinne an, bevor unsere Reise in Bangkok dem Ende entgegengeht. Doch wie schon Michael Palin sagte "Wenn dich einmal das Reisefieber packt, gibt es kein bekanntes Heilmittel, und ich bin gerne bis zum Ende meines Lebens daran erkrankt." Also dann: He Reiter, ho Reiter, He Reiter immer weiter!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Cindy
Inhaltsverzeichnis
MONGOLEI
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
CHINA
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
VIETNAM
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
KAMBODSCHA
Kapitel 1
Kapitel 2
THAILAND
DEUTSCHLAND
MONGOLEI
1
„Die Reise ist zu Ende, wenn zwei Liebende sich finden“ – William Shakespeare
Unsere Reise näher zueinander begann am 04. April 2017
„Hey Tom, sieht man dich doch nochmal!“, diese Worte des Zollbeamten rissen mich aus meinen Gedanken. Meine zitternde Rechte umfasste die zum Gruß gereichte Hand des uniformierten Mannes, die Linke umklammerte die in Klarsichtfolie eingehüllten Papiere.
Flugtickets. Check. Reisepässe. Check. Auslandskrankenversicherung. Check. Visumunterlagen. Check. „Ich wünsche euch beiden eine gute Zeit, man sieht sich bei der Gepäckkontrolle.“ Eher teilnahmslos verabschiedete ich das letzte gut vertraute Gesicht.
Endlich öffnete der Schalter, Zeit unsere Rucksäcke, die unsere Habseligkeiten für die nächsten fünf Monate, fünf Länder, fünfundzwanzigtausend Kilometer, 40°C Temperaturunterschied und dabei stets treuen Begleiter, in die Obhut der russischen Fluggesellschaft zu geben. Unser Reiseziel ließ die junge Angestellte den Blick weg vom Bildschirm, direkt in meine Augen wandern.
„Wo liegt denn Ulan-Bator?“. Ein gutes Gefühl überkam mich. Das Wissen, das unsere kommenden Wochen abseits des Massentourismus, abseits der Sicherheit bietenden Heimat und abseits all unsere Vorstellungen ablaufen sollten, manifestierte sich in genau diesem Moment. „Ulan-Bator ist die Hauptstadt der Mongolei.“, hörte ich mich sagen und nahm mit meiner noch immer schwitzigen Hand die Flugtickets entgegen. Los geht’s.
„Wie kommt man eigentlich darauf, in die Mongolei zu gehen?“ Diese Frage begegnete uns fast täglich. Jeder, der mit unserem Entschluss konfrontiert wurde, stellte diese eine Frage. Warum Mongolei? Nun, ich konnte diese Frage nicht beantworten.
Versuchte es immer auf göttliche Führung und Zufall zu schieben und bin mir sicher, dass, wenn diese Kombination überhaupt zulässig ist, es eben diese sein musste.
Das Jahr 2017 startete genau so, wie 2016 endete. Jede Woche, jeder Tag war exakt durchgeplant und wiederholte sich nahezu in einer Endlosschleife. Arbeiten, Haushalt, Training. Nur die Wochenenden ließen etwas Freiraum im tristen Alltag zu. Das war mir zu wenig, immerhin waren wir frisch verheiratet und sahen uns nur in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Entweder genervt vom frühen Klingeln des Weckers oder erschöpft von der körperlichen Arbeit und seelischen Belastung, die unser Beruf mit sich bringt. Meistens beides. „Man wird des Guten, und auch des Besten, wenn es alltäglich zu werden beginnt, so bald satt.“, erkannte schon Lessing 1777. Das ist so wahr.
Ich mochte und mag auch immer noch meine Arbeit als Physiotherapeut. Ich jobbte in einer kleinen Dorfpraxis, freute mich tagtäglich über das Vertrauen, das Menschen mir entgegenbrachten, ihren eigenen Körper wortwörtlich in meine Hände zu legen und mich danach auch noch ihren Freunden zu empfehlen. Zuhause klang der Refrain des Ohrwurms von Johanna von Koczian „Das bisschen Haushalt...sagt mein Mann“, nie aus meinem Mund, stapelte ich doch ebenfalls die von Angebratenem verdreckten Töpfe und Pfannen zu Gebilden abstrakter Kunst empor. Das Trainieren einer der schnellsten Rückschlagsportart der Welt, Reaktion, Technik, Auge-Hand-Koordination, Taktik und Beinarbeit klingt spannender als es tatsächlich ist, hängt man doch, trotz durchschnittlichen Engagements und Spaß bei der Sache aufgrund mangelnden Talents in der Kreisliga fest und das wöchentliche „Tischtennistraining“ findet weit ab von fachlicher Anleitung mit maximal vier Personen statt.
Es war an der Zeit für einen Wechsel. Kein Vereinswechsel. Kein bloßer Tapetenwechsel.
Kein Berufswechsel. Ein Alleswechsel. Ein Ich-will-mehr-erleben-Wechsel. Ein raushier-ab-ins-Abenteuer-Wechsel. Ein Du-und-Ich-zusammen-in-die-weite-Welt-Wechsel.
Google durchforstend lagen wir auf unserem alten, roten, durchgesessenem Sofa.
Ikeabezüge verdeckten die Flecken vergangener Tage. Der Fernseher bildete eine wirre Geräuschkulisse. Das Tablet in der Hand meiner Frau rauschte ebenso wie der Prozessor meines Laptop, der auf meinem Schoß Platz fand, wegen der unzähligen geöffneten Fenster des Internetbrowsers. Als Physiotherapeut nach Nepal, nach Indien, nach Peru, nach Chile, nach überall nur nicht Afrika, da ist es zu warm, tippten wir in das Suchfeld unter dem bunten Schriftzug der Suchmaschine. So vergingen viele Abende, viel frustriertes Sich-in-den-Schlaf-Grübeln, traurig darüber, wieder nicht Die Stelle gefunden zu haben. Die Stelle, die nicht tausende von Euro kostete. Die Stelle, für die man sich keinen Spenderkreis aufbauen musste. Die Stelle, für die man keinen monatelangen Kultureinführungskurs besuchen musste. Wir wollten jetzt weg. Am liebsten jetzt sofort.
„Wir suchen Physiotherapeuten für unser Kinderförderzentrum in der Mongolei.“, lautete die Schlagzeile, die an einem verregneten Sonntagmittag im Januar den Bildschirm meines Laptops zierte. Das war das erste Mal, dass Google dieses Land ausspuckte, die Mongolei. Wenige Minuten später saß ich am Küchentisch, der Laptop immer noch in greifbarer Nähe. Während eine Hand die Gabel zum Mund führte, bediente die andere das Touchpad, um weitere Informationen über diese Einrichtung und dieses Land herauszufinden. Es klang perfekt. Das Kinderförderzentrum schien dringend Hilfe zu benötigen, Dolmetscher vereinfachten die Kommunikation erheblich und die Temperaturvorhersage war eindeutig nicht zu warm. Ein Wechsel in die Mongolei rückte urplötzlich in greifbare Nähe. Pferde ritten von Kehlkopfgesang begleitet durch die Steppe meiner Phantasie. Es war kein langer Wortwechsel nötig, um uns einig zu sein und kurze Zeit später sollte die erste E-Mail zur Kontaktaufnahme im mongolischen Postfach eingehen.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der täglichen Arbeit in unserer Fördereinrichtung unterstützen würden.“
Ein Satz, der alles weitere einleitete.
Sechzehn Worte, die uns unsere Jobs und unsere Wohnung kündigen ließen.
Einunddreißig Silben, die den Pulsschlag verdoppelten, die schlaflosen Nächte verdreifachten, den Impfschutz vervielfachten und uns ein Lächeln auf das Gesicht zauberten, welches uns lange Zeit nicht mehr verlassen sollte.
Die Pass- und Gepäckkontrolle verlief ohne große Vorkommnisse. Nachdem der für das Handgepäck zuständige Sicherheitsbeamte seine Arbeit an Cindys Rucksack beendet hatte, entließ er uns mit einem freundlichen „Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag.“, in die Abflughalle. Wenn er wüsste. Kurze Zeit später saßen wir im Flugzeug. Endlich. Der große Tag war Wirklichkeit geworden. Auf einmal ging alles so schnell und alles war so einfach. Noch.
„Reiseführer Mongolei“ lautete der Titel des Buches, das ich, nachdem die Sicherheitsleuchten ausgeschaltet wurden, aus dem Handgepäck griff. Reiseführerschön und gut, aber die Kapitel über den Umgang mit behinderten Kindern, Erziehung, Hilfsmittelversorgung, Organisation einer Fördereinrichtung, den kollegialen Umgangston, Arbeitszeiten, Arbeitswege oder die Lernbereitschaft der Erzieher, Eltern und Ärzte, suchte ich vergebens.
Die Mongolei ist mit 1.566.000 Quadratkilometern etwa viereinhalb mal so groß wie Deutschland, liegt als Binnenstaat zwischen Russland im Norden und China im Süden, eingebettet zwischen zwei der bedeutendsten Großmächten unserer Erde und beherbergt ca. drei Millionen Menschen, etwa die Hälfte davon in der Hauptstadt Ulan-Bator. Soweit die Basics. An Ulan-Bator führt kein Weg vorbei und ich vermute, dass schon jeder kleinste Nomade den Weg in die Stadt des „Roten Helden“, auch ohne modernste GPS- Navigation, findet. Doch bevor wir unseren ersten Fuß in diese chaotische, laute Mischung aus Tradition und Moderne setzten, landete der Flieger zu einem dreistündigen Aufenthalt in Moskau.
Mir drückte die Blase. Trinkwasser plus Aufregung war die schlechteste aller möglichen Kombinationen um einer russischen Flughafentoilette fern zu bleiben.
Blind vor dem innerlichen Drang und den damit verbundenen immer schneller werdenden Schritten, steuerte ich direkt auf die erste sichtbare Toilette zu. Im Augenwinkel nahm ich plötzlich eine junge Frau mit ihrem Kind war, wich instinktiv zur Seite, um sie nicht anzustoßen und brachte mich damit in die optimale Ausgangsposition im Rennen um die letzte freie Kabine.
Geschafft. Überglück öffnete ich den Klodeckel, setze mich hin und ließ nicht nur meinen Gedanken freien Lauf. „Komisch, es scheint an russischen Flughäfen keine Pissoirs zu geben?!“, ging es mir durch den Kopf, aber schnell war auch diese Erkenntnis verflogen und freudestrahlend verließ ich die Kabine. Das Waschbecken suchend blickte ich umher und kreuzte dabei den Blick einer etwas verwirrt dreinblickenden schwangeren Dame. Die Frau, welche ich kurze Zeit zuvor fast umgerannt hatte, trat nun neben die Schwangere, dicht gefolgt von ihrem Kind.
Zwei Frauen, ein Mädchen und keine Pissoirs. Mir dämmerte mein erstes Missgeschick auf unserem Weg in die weite Welt. Das Türschild brachte die Gewissheit.
Die restliche Wartezeit verbrachten wir an dem Gate, welches am weitesten von besagter Toilette entfernt lag. Sicher ist sicher. Ich war froh, als wir wieder im Flugzeug saßen und unsere Reise fortsetzten. Wieder schlug ich den Reiseführer auf.
Der berühmteste Mongole aller Zeiten ist und das wird wohl auch immer so bleiben, Dschinghis Khan. „I get a little bit Dschinghis Khan“ klingt es in den USA des 21.
Jahrhunderts, unzählige mongolische Klänge berichten seit hunderten von Jahren von den Siegeszügen des größten Eroberers der Weltgeschichte und selbst der Deutsche singt „Sie ritten mit dem Steppenwind, tausend Mann/ und einer ritt voran, dem folgten alle blind, Dschinghis Khan/ Dschingh Dschingh Dschinghis Khan, He Reiter, Ho Reiter, He Reiter immer weiter!“. Die Textzeile geht dem Deutschen leichter über die Lippen, wenn diese zuvor mit dem zweitliebsten Getränk der Mongolen angefeuchtet wurden, dem Wodka. Würde man einhundert Leute in diesem bevölkerungsarmen Staat nach dem Lieblingsgetränk fragen, wäre die Topantwort allerdings Airag. Da es die vergorene Stutenmilch nur in den Sommermonaten zu verköstigen gibt, ging dieser Kelch sprichwörtlich an uns vorüber.
Nicht nur bei der Fermentierung spielt die Sonne eine zentrale Rolle, sondern auch beim Wetterbericht. Durchschnittlich zweihundertfünfzig Sonnentage und das bei Temperaturschwankungen von -30°C in den Winter- bis zu +30°C in den Sommermonaten, veranlasste damals schon Dschinghis Khan und auch heute wieder immer mehr Menschen dazu, den blauen Himmel und die Natur als Gottheit zu verehren. Aber auch im Buddhismus, der Hauptreligion des Landes, findet sich die Farbe Blau, in Anlehnung an den „Blue Sky“, vermehrt an Gebetstüchern und -fahnen.
Noch bevor ich meine Lektüre wegpacken konnte, fielen mir die Augen zu. Cindy lag schon längere Zeit auf meiner Schulter und atmete tief. Das mehr oder weniger sanfte Aufsetzen der Räder holte uns beide zurück in die Realität.
2
Der erste Tag sollte einem immer besonders in Erinnerung bleiben, aber nicht als der Tag an dem man beginnt die Tage zu zählen, oder?
„Tom + Cindy“ stand in schwarzen Buchstaben auf einem kleinen Karton. Wie kitschig. Das Stück Pappe befand sich in Brusthöhe eines etwa 1,70m großen, eher schmächtigen Mannes, der sein freundlichstes Grinsen an den Tag legte. Die kurzen schwarzen Haare gepaart mit den dunklen, schmalen Augen und dem kleinen halboffenen Mund, aus dem leicht gelbliche Zähne blitzten, ließen auch die letzte Zweifel fallen. Wir waren in die richtige Maschine eingestiegen und wir waren in dem Land angekommen, über welches die letzten Wochen unaufhörlich geredet wurde. Auf gebrochenen Englisch machten wir uns mit dem Mann unserer neuen Chefin, wie wir später erfahren sollten, bekannt. Er nahm Cindys Rucksack ab und verfrachtete ihn in ein Hybridauto. Das Fortbewegungsmittel erster Wahl in Ulan-Bator. Steppe, unendliche Weite, Pferde, Yaks und Kamele.
Vergebens hielt ich nach all den Dingen Ausschau, die ich schon vor intensiver Recherche mit der Mongolei verband. Die einzige Herde, die uns begegnete waren keine Wildpferde, auch keine Rentiere, geschweige denn ein Rudel Wölfe. Nein, nichts Lebendiges. Hybridautos. Toyota Prius Hybrid soweit das Auge reichte. Wahlweise in blau oder weiß, mal als Links- aber auch als Rechtslenker, unterwegs, wie eine Herde Wildpferde aufgeschreckt durch junge Wölfe, in purem Durcheinander. Aufheulende Motoren und grelle Hupgeräusche zerstörten meine Illusionen über mongolische Reiter, die stolz ihren Adler präsentierten, während sie eine Staubwolke aufwirbelnd durch das Land ritten.
Etwa eine halbe Stunde später blieben wir vor einem alten Reihenhaus stehen. Eine Wohnung im letzten Haus einer Mehrfamilienhausreihe mit zerfallener Fassade, kaputten Balkonfenstern, Schmierereien an den Wänden und einem von Zigarettenkippen gepflasterten Eingangsbereich, schien wohl unser neues Zuhause zu werden. Nicht gerade einladend, hoffte ich doch innerlich auf eine eigene Jurte, stellte es wohl in Anbetracht der kalten Temperaturen doch die bessere Alternative dar. Eine stark geschminkte Frau begrüßte uns überschwänglich. So überschwänglich, dass mir die Seiten des Reiseführers über den Alkoholgehalt fermentierter Stutenmilch ins Gedächtnis rasten. Ihr Deutsch war nahezu perfekt, aber schnell machte sie uns deutlich, dass ab diesem Moment mongolisch gesprochen wird.
Ein Zungenbrecher ist laut Definition des Duden ein Wort, „welches schwer auszusprechen ist“. Diese Definition traf genau auf das zu, was uns als nächstes erwartete. Zwischen Tür und Angel wurden wir Schüler einer für uns völlig fremden Sprache. Lachend über unsere kläglichen Bemühungen ein mongolisches Grußwort richtig auszusprechen, öffnete die Frau die Tür. Sofort stieg ein Geruch aus kaltem Rauch in unsere Nasen. Aber da war noch mehr, der Gestank war unausstehlich. Total perplex stolperten wir in die Wohnung. Der schmale Flur führte direkt ins Wohnzimmer, von der Wand aus beobachteten uns die leeren Augenhöhlen eines Rehbockes, dessen Schädel, bis auf die Ohren, komplett gehäutet war. Eine alte braune Couch war das Erste, was uns auffiel. Bis auf die Decken, die als Überwurf dienten, sah sie fast sogar bequem aus. Gegenüber des Sofas befand sich die Küchenzeile. Eine versiffte Arbeitsplatte, ungespültes Geschirr und verschimmelte Teebeutel ließen uns schlagartig den Hunger vergessen. Wir drehten uns rasch um und blickten in ein Zimmer, welches, bis auf ein paar wenige Habseligkeiten des Eigentümers, komplett leer geräumt war. Gegenüber befand sich ein weiterer Raum, unser Schlafzimmer. Ein Kleiderschrank und eine Pressspanplatte als Bett bildeten die dürftige Einrichtung. Auf dem Weg zum Badezimmer öffneten wir die Tiefkühltruhe und identifizierten diese als Übeltäter des bitteren Gestankes. Ich öffnete die Tür nur für den Bruchteil einer Sekunde und dann nie mehr. Zu stark war die undefinierbare Duftwolke, die dieses Gerät binnen so kurzer Zeit verließ. Es gab fließend Wasser. Ja, es gab zu meinem Erstaunen sogar fließend warmes Wasser. Das war auch schon das Positive am Badezimmer. Kaputte Fliesen und keine Duschwand machten das Waschen zu einem Experiment der Wasserdichte des Bodens. Nach dem Rundgang verabredeten wir uns mit unseren mongolischen Bekanntschaften auf ein Treffen in der neuen Arbeitsstätte.
Unmittelbar nachdem die Beiden die Wohnung verließen, stiegen Cindy Tränen in die Augen. Tränen, die weder das Gemälde des Buddhas, noch das des Dschinghis Khan, bei dem die Haare aus Fell bestanden, trocknen konnten.
Der erste Tag sollte einem immer besonders in Erinnerung bleiben, aber nicht als der Tag, an dem man beginnt die Tage zu zählen. Es konnte eigentlich nur besser werden.
Einige Stunden später standen wir im Büro des Kindergartens. Vier Frauen teilten sich den Raum, drei davon sprachen gut Deutsch und standen uns die kommenden Wochen als Dolmetscherinnen zur Seite. Die Frage ob wir hungrig seien, beantworteten wir mit einem klaren Ja und schon machten wir Bekanntschaft mit typisch mongolischem Essen. Fetthaltig. Genauer lässt es sich im Prinzip gar nicht beschreiben. Auf der Suppe schwamm ein klarer Fettfilm und mit jedem Stückchen Fleisch lagen drei bis vier weiße, schwabbelige Klumpen des wertvollsten aller Energieträger mit auf dem Löffel. Ich fragte mich, wie ausgeprägt wohl Gicht in dieser Region der Welt ist. Der gute alte Anstand trieb uns dazu, alle ungesättigten Fettsäuren zu unserer Sättigung beitragen zu lassen.
Eine Tugend, die wir noch das ein oder andere Mal verletzen sollten. Plötzlich öffnete sich die Tür und eine dunkelhaarige junge Frau mit Nasenring betrat den Raum. Ihr Aussehen offenbarte uns sofort, dass sie keine Mongolin war. Braune gelockte Haare, helle Haut und blaue Augen, dazu dieses akzentfreie Deutsch. Australier reisen laut Statistik am meisten, gefolgt von Amerikanern und Engländern, aber Deutsche trifft man auch überall. Ihr Name war Katja, sie war bereits seit vier Wochen in der Einrichtung und hatte erst wenige Monate zuvor ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet. Nun waren wir zu dritt. Drei deutsche Physios im Herzen der Mongolei, um behinderte Kinder zu therapieren, Eltern, Angehörige und Mitarbeiter zu schulen und dabei Erfahrungen zu sammeln, die unsere Sicht auf das Leben komplett verändern sollten.
Das Kinderförderzentrum funktionierte vom Prinzip her wie ein Kindergarten in Deutschland. Jeden Morgen wurden die teilweise schwerstbehinderten Kinder von ihren Eltern in die Einrichtung gebracht, da mit drei Mahlzeiten versorgt, dazwischen bespaßt und die Mittagszeit ließ genug Raum für ein ausgedehntes Nickerchen. Aber ab dem Tag unserer Ankunft stand auch Physiotherapie auf dem Wochenplan. Die Kinder waren nach ihrem Alter in vier Gruppen aufgeteilt. Für die Ältesten stand ein Raum im Erdgeschoss zur Verfügung.
Dieser bot genug Platz um die Jungs und Mädchen im Alter zwischen neun und vierzehn Jahren zu beschäftigen. Gleichzeitig stellte diese Gruppe verständlicherweise auch das höchste Konfliktpotential dar. Eine besondere Art des Aufruhrs entstand immer dann, wenn der autistische Junge, dessen Namen ich sofort wieder vergaß, seinen beeindruckenden Kehlkopfgesang ausgerechnet während den frühen Mittagsstunden erklingen ließ, während der älteste und, von Natur aus eher aggressiv gepolte Khangal, aus seinen offensichtlich feuchten Träumen geweckt wurde. Ein Spektakel, welchem wir glücklicherweise nicht allzu oft beiwohnen konnten, da Katja für die Therapie in dieser Gruppe verantwortlich war. Unser Arbeitsbereich lag im Dachgeschoss. Hier führte ein kleiner Vorraum zu drei großen und durch Sach- und Geldspenden erstaunlich gut ausgestatteten Räumen. Ganz links waren die Ein- bis Zweijährigen untergebracht.
Dazu zählten beispielsweise ein Junge mit Down-Syndrom, ein entwicklungsverzögertes Drillingspärchen und der kleine Minjuur, den ich sofort ins Herz schloss. In der Mitte die drei bis acht Jährigen mit teils schweren geistigen und körperlichen Behinderungen.
Epileptische Anfälle zählten hier zur Tagesordnung und ein junger Kerl mit autistischen Zügen, Bat- Iredu, sorgte zusätzlich für die ein oder andere Schrecksekunde, wenn man ihn mal aus den Augen verlor. Ganz rechts die Kinder, die etwas besser mit sich und ihrer Umwelt interagieren konnten. Von Ataxien über Mikrozephalus bis hin zu Halbseitenlähmungen fand man in dieser Gruppe die größte Bandbreite neurologischer Erkrankungen. Beim Erkunden der Gruppenräume fiel mir auf, dass, besonders bei den Kleinsten, ein deutlicher Mädchenüberschuss bestand. Ein Irrtum, der mir nach ein paar Tagen der Verwirrung verständlich gemacht wurde. Aufgrund der hohen Rate des plötzlichen Kindstods bürgerte sich eine Tradition ein, die Eltern dazu veranlasste, das Leben des Kindes im 3. oder 5. (Überlebens-)Jahr zu feiern und zwar mit dem ersten Haarschnitt des Kindes.
Dieser Ritus setzt sich bis in die heutige Zeit fort, was dazu führt, dass der doofe Deutsche trotz seines hervorragenden Reiseführers in die, in der heutigen Zeit sowieso viel diskutierte, Geschlechterfalle tappte. Lange Haare mit rosa Bändern zu Zöpfen gebunden, stellt in der Mongolei in der jungen Männerwelt kein Tabuthema dar. Nach vielem Lächeln, Händeschütteln, Zungenbrechen, Zurechtfinden, Namen lernen, Tee trinken, Fett essen und Ankommen beendeten wir unseren ersten Tag zufrieden, aber der Kulturschock hatte uns voll erwischt.
Tag zwei begann mit einem Hindernis, vor welchem uns am Vortag mehrmals gewarnt worden war. In Jogginghose, dicker Winterjacke und Turnschuhen standen wir an der Hauptstraße. Und standen. Und standen. Wie sollten wir diese Straße jemals überqueren? „Passt auf der Straße auf, die ist gefährlich!“, klang es in unseren Ohren nach.
Tatsache. Russische Transporter, die wahrscheinlich schon zur Zeit des zweiten Weltkriegs durch die Steppe gerattert waren, kämpften auch heute noch um jeden Zentimeter Asphalt gegen diese japanische Großmacht Toyota Prius Hybrid. Kleinbusse öffneten während der Fahrt die Tür, Menschen lehnten sich heraus und schrien mit heiserer Stimme für uns undefinierbare Silben, wahrscheinlich Ortsnamen, und spielten dabei tatsächlich mit ihrem Leben.
Dann rauschte ein Monster-Truck an uns vorbei. Ja, so ein riesiges Teil aus den verrückten Autoshows, die Reifen so hoch wie die Dächer der anderen PKW. Immer mehr Menschen sammelten sich an der Straßenseite und plötzlich setzte sich der Pulk in Bewegung, unsere Chance sicher die andere Seite und damit unseren neuen Arbeitsplatz zu erreichen. Sichtlich froh uns lebend zu sehen, wurden wir bereits erwartet.
Cindy wurde die Gruppe auf der rechten Seite zugewiesen, mir die mittlere und die Kleinsten unserer neuen Patienten wählten wir sozusagen nach Sympathie, was dazu führte, dass ich die Jungs und meine Frau die Mädels behandeln durfte. Zwei Tage waren für das Kennenlernen der Kinder, Mitarbeiter und Tagesabläufe vorgesehen, bevor wir den Therapieraum im Erdgeschoss bezogen.
3
„Kulturschock- menschlicher Verhaltenszustand, der auf der plötzlichen Konfrontation mit fremden, kulturbestimmten Umweltverhältnissen beruht und zunächst eine schockartige Verwirrung auslöst, die v.a. bei weniger auslandsorientierten Menschen in die emotionale Ablehnung einer fremden Kultur mündet.“ - Definition nach Gabler Wirtschaftslexikon
Zitate von Ernest Hemingway, Mark Twain oder Jack London sollten Kapitel in einem Buch über fremde Welten einleiten, aber anscheinend befanden sich diese großen Abenteurer nie in dem Zustand schockartiger Verwirrung, empfanden niemals Ablehnung gegenüber fremden Kulturen und zählten allem Anschein nach auf keinen Fall zu „weniger auslandsorientierten Menschen“.
Oder aber sie haben nie eine mongolische Fördereinrichtung für Kinder und Jugendliche mit schweren Beeinträchtigungen betreten, denn dann, da bin ich mir sicher, gäbe es ein geeignetes Zitat um dieses Kapitel einzuleiten.
Die Erzieherinnen schienen nicht gerade erfreut über unseren Besuch, ganz im Gegenteil zu der Leitung des Kindergartens.
Gekonnt ignorierten sie jeden unserer Versuche Kontakt aufzunehmen. Stattdessen wurden uns Kinder in die Hand gedrückt, die dringend etwas Zuneigung brauchten.
Erdmee war der Name des fünfjährigen Jungen mit stark ausgeprägter infantiler Zerebralparese, der wohl der größte Fan sämtlicher Actionfiguren war. Die roten Socken trugen den Schriftzug von Spiderman, der seine Netze auch über Erdmees rot-blaue Hose spann. Der graue Pullover trug quer über die Brust ein Badman-Symbol und darüber befand sich ein über das gesamte Gesicht reichendes Grinsen. Ein fröhliches Lachen klang aus dem Mund des kleinen Mannes und brachte seine kleinen schwarzen Zähne zum Vorschein. Vor lauter Freude einen weiteren Mann im Haus begrüßen zu dürfen, schossen seine Arme weit auseinander, wie bereit zu einer Umarmung, der Kopf knallte auf die Brust und der Rumpf begann sich zu wölben.
Die ganze Euphorie hatte einen Krampfanfall ausgelöst. Innerlich total erschrocken, versuchte ich nach Außen gelassen zu wirken, als wären mir solche Situationen schon ständig passiert, wartete dabei auf eine Reaktion der Erzieherinnen, stellte dannaber fest, dass sich die Muskulatur von Spidy-Badman wieder entspannte und er sein Lächeln wieder aufgelegt hatte. Plötzlich sprang eine meiner neuen Kolleginnen hektisch auf, lief zur Tür und bekam Bat-Iredu gerade noch am Arm zu fassen. Das mobilste Kind der Gruppe war ständig auf der Flucht, was dazu führte, dass er die meiste Zeit des Tages festgebunden in seinem Stuhl saß. Seine schielenden Augen musterten mich misstrauisch, aber der bunte Ball in meiner Hand lockerte die Situation auf. Ich reichte ihn ihm und ehe ich mich versah, verschwand das bunte Spielgerät in seinem Mund, Sabberfäden folgten der Schwerkraft und durchnässten sein T- Shirt.
Er wirkte etwas verwirrt aber zufrieden, sodass ich mich dem nächsten Kind vorstellen konnte. Ein großer Kopf auf einem kleinen Körper. Ser- Od, der Junge mit dem Hydrozephalus, war ein ganz besonderes Kerlchen. Auch er freute sich über meine Anwesenheit. Ohne Scheu ergriff er meine Hand und führte sie zu seinem Mund, doch kurz vor dem Ziel stoppte ich seine Bewegung. Sichtlich unzufrieden öffnete er seine Lippen, ein einziger verfaulter Zahn kam zum Vorschein, bevor dieser von einer langen Zunge verdeckt wurde. Damit hatte ich nicht gerechnet und so erreichte er sein Ziel und inspizierte mich auf seine eigene Art und Weise. Wir sollten gute Freunde werden.
Aus einer Ecke im Raum erklang ein merkwürdiges Geräusch. Das einzige Mädchen der Gruppe, Bumbaihai, versuchte sich mitzuteilen. Die Augen fast komplett verschlossen, wand sie sich über die Seite auf ihre Knie, ihr Pferdeschwanz saß locker und einzelne Haare fielen auf ihre Schulter.
Erst jetzt bemerkte ich, dass sie deutlich größer als die anderen Kinder war. Sie schien nicht sehr interessiert an der Umwelt oder gar an mir zu sein und so entschloss ich mich, sie fürs Erste in Ruhe zu lassen und mich Tuvsho zuzuwenden. Tuvsho war mit acht Jahren der Älteste der Gruppe. Durch seine ausgeprägten Kontrakturen der Wirbelsäule, der kleinen Hände mit dünnen Fingern und seinem unschuldigen, hilfsbedürftigen Gesicht wirkte er allerdings jünger. Er lag auf der Seite, zusammengekauert wie ein Würmchen, mit einem Kissen zwischen den Knien. Seine großen Augen fixierten mich. Unseren ersten Blickkontakt erwiderte er mit einem Lächeln, zeigte dabei aber deutlich, dass er etwas mehr Zeit benötige, um Vertrauen zu entwickeln. Ich drehte mich um, weil ich das schwere Atmen, nein es war mehr als ein Atmen, es war ein krampfhaftes nach Luft schnappen, vernahm. Auf dem Boden lag Bat. Nur die linke Seite seines Hinterkopfes und die Fersen berührten noch den Boden, während er gegen seine Streckspastik ankämpfte. Das Gesicht schmerzverzerrt, die Hände im Krampf gen Himmel gestreckt, floss der Schweiß von seiner Stirn herab. Er kämpfte mit den Tränen, ließ aber nicht zu, dass auch nur eine seinen dunklen Augen wich. Noch bevor ich reagieren konnte, nahm ihn eine Erzieherin auf den Arm und offenbarte damit die Pfütze aus Schweiß und Urin, die sich aus dem Körper ergoss. Jampts komplettierte die Gruppe. Er trug eine dicke gefütterte Sweatjacke im rot- blauen Spidermanmuster und zeigte weder eine Reaktion auf meine Stimme, noch auf meine Berührungen. Er lag auf dem Boden, Arme und Beine weit von sich gestreckt und schien zu versuchen, sich zu bewegen, was ihm allerdings nicht gelang. Er war so beschäftigt mit sich selbst, dass ich ihn nicht weiter stören wollte und so sah ich wieder den aufgeweckteren Kindern zu und versuchte meinen neuen Bekanntschaften näher zu kommen. Ich musste eine Art Exot darstellen, da sie wahrscheinlich in ihren jungen Jahren noch nicht viele europäische Männer zu Gesicht bekommen hatten, was die Sache bei den Meisten deutlich erleichterte. Auch stellte die Sprache kein großes Hindernis dar, waren doch viele nicht in der Lage selber zu kommunizieren oder meine Versuche sie auf mongolisch zu begrüßen, erhellte ihre Stimmung so schnell, dass sie mir damit deutlich machten, dass ich noch viel üben musste.
Der Kulturschock ergriff mich, im Gegensatz zu Cindy, nicht schon beim Beziehen unserer neuen Wohnung, auch nicht bei dem gewöhnungsbedürftigen Essen, da bin ich sowieso sehr experimentierfreudig, und auch nicht beim Überqueren der chaotischsten Straße an der ich je gestanden habe, nein, sondern in dem Moment, als die volle und daher sehr aerodynamisch fliegende Windel auf meiner Hose einschlug. Zum Glück ohne Inhalt zu verlieren, aber trotzdem kein geeignetes Willkommensgeschenk, zumindest meiner Meinung nach. Ich hob erschrocken den Kopf und suchte im Raum nach dem Absender. Unmissverständlich streckte eine der Erzieherinnen ihren Zeigefinger Richtung Waschraum, der strenge Blick erklärte meine Aufgabe.
Cindy war im Nebenraum, wo schon das Frühstück serviert wurde. Auch sie machte sich unter den neuen Patienten schneller Freunde, als unter den neuen Kolleginnen.
Sei es mit der kleinen Aydara, die oft Husten musste und dabei schleimigen Auswurf über das Loch in ihrem Hals verteilte, welches als Überbleibsel einer Trachealkanüle mittlerweile nur noch von einem Baumwollhalstuch abgedeckt wurde. Oder mit Anand, dem Jungen mit dem Mikrozephalus, der, besonders in Ser-Ods Gegenwart, noch stärker auffiel, aber stets fröhlich mit einem Bein auf den Boden stampfte. Oder mit dem größten Junge der Gruppe, der seine letzten Wochen in der Einrichtung verbrachte, bevor er eingeschult werden würde. Dieses Privileg feierte er gefühlt jede Woche und kleidete sich dafür in einem viel zu großen Anzug, dafür aber mit perfekt gebundener Krawatte. Seine ausgeprägte Ataxie war der Grund für viele Stürze, die er gekonnt überspielte, indem er sich auf dem Bauch liegend den Kopf auf den Händen abstützte und so tat, als wartete er auf die lang ersehnte Einschulung oder die nächste Mahlzeit. Wer wusste das schon?
Eine schwere Tür auf der linken Seite des Treppenhauses führte in einen Vorraum, welcher nur zu Essenszeiten genutzt wurde.
Wenn man den Raum nicht durchschritt, blieb einem die kahle Holztür in der hinteren linken Ecke verborgen. Diese Tür öffnete wortwörtlich den Blick in eine andere Welt, die Welt der kleinsten Besucher der Kinderfördereinrichtung. Etwas Besonderes bot diese Gruppe noch. Neben dem kleinen Minjuur, der sich aufgrund seiner infantilen Zerebralparese nur robbend fortbewegen konnte, Armamend, der aus unerklärten Gründen einen ausgepägten Neglect (Vernachlässigung) seiner linken Körperhälfte hatte oder Inri, der süßeste Junge der Einrichtung und wahrscheinlich auch der ganzen Welt, aber leider mit einer starken Streckspastik geboren, waren Anar und ihre zwei Brüder Teil der kleinen mongolischen Kindergartenwelt. Anar war stark entwicklungsverzögert, aber ihre Brüder waren gesund. Für uns Deutsche leicht verhaltensauffällig, aber ohne körperliche Beeinträchtigungen, was unser Förderzentrum zu einem Vorreiter zum Thema Inklusion machte. Zu Beginn ahnten wir noch nicht, dass diese eigene kleine Welt unser Rückzugsort und liebster Platz im Kindergarten werden sollte.
4
„Der beständigste Teil eines Denkmals ist der Sockel“ – Harald Schmid
Das erste Wochenende in unserer vorübergehenden Heimat sollte uns zur Orientierung dienen. Durch die Gassen spazieren, die Menschen beobachten, gutes Essen finden. Aber wie bei jedem Abenteuer kam auch bei uns nicht alles wie geplant, aber das merkten wir bereits.
Statt durch hübsche kleine Gassen zu spazieren, schlenderten wir über eine mit Schlaglöchern, oder besser gesagt Schlaggruben, übersäte Straße, immer darauf bedacht, uns nicht die Knöchel zu verstauchen. Die Menschen beobachteten uns mit argwöhnischen Augen und die Suche nach gutem Essen stellten wir der Suche nach einer geeigneten Luftmatratze hinten an. Die Hüften und der Rücken würden es uns danken. Doch plötzlich vibrierte unser mongolisches Handy. Eine SMS.
„Kamile will mit russischen Freundinnen zur Reiterstatue 50km südöstlich. Möchtet ihr mit?“
Diese Einladung der Kindergartenleitung nach so kurzer Zeit mussten wir natürlich nutzen und schon kurze Zeit später stiegen wir zu dritt am Hauptbahnhof aus dem Taxi.
Kamile, eine klein gewachsene Frau mit starkem Übergewicht, einer schwarzen Bobfrisur und großzügig aufgetragenem roten Lippenstift, die weder Englisch noch Deutsch sprach, Cindy und ich. Doch es sollte nicht lange bei dieser Dreisamkeit bleiben. Beim Überqueren der Straße wurde ich von der Seite in gebrochenem Englisch angesprochen. Die Frage meiner Herkunft beantwortete ich wahrheitsgemäß, sehr zu Freuden von Jumbo, dem kleinen stämmig gebauten Mann, der seinem beißenden Mundgeruch zur Folge auch schon in den frühen Mittagsstunden gerne mal zur Flasche griff. Mit starkem Akzent, aber auf Deutsch, berichtete er mir über sein längst vergangenes Leben in Hamburg. Ich vermutete, dass der Alkohol für die ein oder andere Erzählung verantwortlich war, brachte trotzdem einige „Ahhs“, „Ohhs“ und „Wows“ zum Ausdruck und tat tief beeindruckt meine Bekanntschaft mit dem ehemaligen Masseur von Dariusz Michalczewski, Henry Maske und den Klitschko-Brüdern gemacht zu haben. Nach dem vergeblichen Versuch Jumbos Handynummer auswendig zu lernen, weder er noch ich hatten etwas zum Schreiben dabei, rollte die Transsibirische Eisenbahn von ihrer langen Reise aus Peking ein. An Bord zwölf russische Erzieherinnen mit gefühlten zwölf Tonnen Gepäck, die die Kindergärten in ihren Heimatstädten neu einrichten sollten. Kartons über Kartons, Teppiche mit Straßenverkehrsmuster, wie ich sie aus meiner Kindheit kannte, Rucksäcke, Koffer, Taschen. Kamiles Freundinnen mussten mehrere Abteile der Transsib angemietet haben, dachte ich mit jedem Koffer, der den Gepäckturm weiter wachsen ließ. Völlig unauffällig näherte sich uns ein kleiner Bus und wir konnten mit dem Verladen beginnen.





























