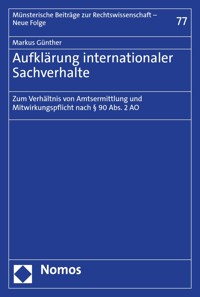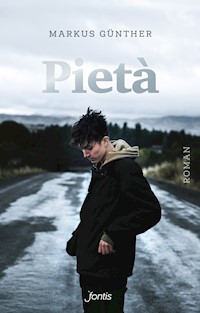
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was heißt schon Erwachsenwerden? Wo beginnt es, und wo hört es auf? Und was muss dabei geschehen? Markus Günther hat eine klassische «Coming of Age»-Geschichte geschrieben, und doch fällt sein Held Lutz Brokbals aus jedem literarischen Rahmen. Ja, er hadert mit sich selbst und seinen Gefühlen, er wartet sehnsüchtig auf die große Liebe und ein abenteuerliches Leben. Doch da ist noch etwas, was ihn quält und lähmt: die Frage nach den letzten Dingen, auch nach dem Tod. Alice Millers «Drama des begabten Kindes» hallt in dieser Geschichte ebenso nach wie Hermann Hesses Jugendroman «Peter Camenzind». Auch Lutz Brokbals kann seine widerstreitenden Gefühle kaum bändigen und lernt schließlich doch die wichtigsten Lektionen des Lebens, die Liebe und den Abschied. Der Riese, den Lutz besiegen muss, ist in keiner Fabelwelt zuhause, sondern in der Seele eines jeden Menschen. Erst wenn er zu Fall gebracht ist, weitet sich der Blick für die unendlichen Möglichkeiten der Liebe, der Freiheit, des Lebens. Dann wird aus Zweifel Zutrauen und aus Todesfurcht Lebenslust. STIMMEN ZUM BUCH: Markus Günthers Erzählung vom Erwachsenwerden des überempfindlichen Lutz Brokbals reiht die Momente einer allmählichen Verwandlung wie Perlen aneinander. Seine Poesie trägt die Prägungen bestimmter Orte und Jahre und beschwört doch jene Ängste und Sehnsüchte, die zu allen Zeiten Menschen bewegt haben. Ein packendes Buch, das den schwierigen und existenziellen Fragen des Lebens nicht ausweicht. Und das sich vielleicht gerade deshalb liest wie eine kraftvolle Ermutigung, sich zuversichtlich auf das Abenteuer Leben einzulassen. Markus Günthers Erzählung vom Erwachsenwerden des überempfindlichen Lutz Brokbals reiht die Momente einer allmählichen Verwandlung wie Perlen aneinander. Seine Poesie trägt die Prägungen bestimmter Orte und Jahre und beschwört doch jene Ängste und Sehnsüchte, die zu allen Zeiten Menschen bewegt haben. Ein Buch für alle Liebenden, für alle Trauernden und für alle, die noch wachsen wollen. “Ein ungemein fesselndes Buch“ Klaus Nachbaur, PUR-Magazin “Unbedingt empfehlenswert!“ Johannes Schröer, Domradio "Günther gelingen immer wieder eindrückliche sprachliche Bilder, denen man die Erfahrungstiefe, aus der sie kommen, anmerkt." Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung "Ein hellsichtiges Buch. Unbedingt empfehlenswert!" Johannes Schröer, Domradio „Ein ebenso intensiver wie mutiger Roman.“ Alexander Kissler, Cicero "Eine mutige Coming of Age-Erzählung auf hohem stilistischem Niveau." Stefan Meetschen, Tagespost
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Günther Pietà
Markus Günther
Pietà
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2020 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: SpoonDesign, Olaf Johannson, Langgöns Bild Umschlag: Gaspar Manuel Zaldo/unsplash E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-600-8
I
Der erste Tote, den ich sah, war Pater Gerwald. Eines Mittags, nachdem der Präfekt im Speisesaal mit der Tischglocke geläutet hatte und wir gerade zum Gebet hinter die Stühle getreten waren, wurde uns sein Tod in kurzen, ernsten Worten mitgeteilt. Wir schauten einander verdutzt an. Auf den Segensspruch, den wir dreimal am Tag lustlos aufsagten, folgte nun das Totengebet, das uns aus den täglichen Messen und Gebetszeiten vertraut war.
«Der Herr gebe ihm und all unseren Verstorbenen die Ewige Ruhe.»
Wir antworteten im Chor: «Und das Ewige Licht leuchte ihnen.»
«Herr, lass sie ruhen in Frieden!»
«Amen.»
Das schabende Geräusch von achtzig Stühlen auf dem stumpfen Linoleumboden beendete den stillen Augenblick des Totengedenkens. Das hässliche Geklapper von Besteck und Geschirr folgte sogleich und dazu das halblaute Gemurmel der vielen Stimmen, das über jeder unserer Mahlzeiten schwebte wie ein Bienenschwarm und niemals verstummte, bis die Tischglocke ein weiteres Mal läutete und wir geräuschvoll zum Dankgebet aufsprangen. Wir aßen unruhig, hastig und gedankenlos wie immer. Dabei sprachen wir mit vollem Mund über die unerwartete Neuigkeit.
Pater Gerwald war früh morgens gestorben, an «Herzschlag», wie es widersinnigerweise hieß. Er sollte auswärts eine Messe lesen und war in der Sakristei tot zusammengebrochen, nachdem er gerade die Albe angezogen hatte. Der Küster, der noch mit ihm gesprochen und dann die Sakristei verlassen hatte, um in der Kirche die Altarkerzen anzuzünden und die Kredenz herzurichten, fand ihn nur wenige Minuten später, als schon keinerlei Lebenszeichen mehr festzustellen war. Der Mönch war offenbar ganz ohne Todeskampf gestorben und hielt noch mit beiden Händen das Zingulum fest, das er gerade hatte umlegen wollen, als ihn aus heiterem Himmel der Tod ereilte.
Die Nachricht bedrückte uns nicht. Wir hatten wenig mit Pater Gerwald zu tun gehabt und kannten ihn eigentlich nur vom Ansehen her, da er weder Lehrer noch Präfekt war, sondern den größten Teil seiner Zeit entweder in der Klausur oder außerhalb des Klosters verbrachte, wo er als Seelsorger in einem nahe gelegenen Altersheim aushalf und in den Pfarreien der umliegenden Dörfer die Messen las und die Beichten abnahm. Ein großer Mann mit kräftiger Stimme, dessen schwarze Soutane über dem dicken Bauch auf das Äußerste gespannt war, wenn er, immer mit dem Schlüsselbund in der Hand, mit schnellen Schritten an uns vorbeieilte und uns dabei kaum Beachtung schenkte oder bestenfalls einen Gruß in unsere Richtung raunte oder uns eine verstaubte, onkelhafte Spruchweisheit zurief, zu der wir hilflos das Gesicht verzogen, Dinge wie «Ohne Fleiß kein Preis» oder «Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert».
Da er graue Haare hatte, zählte er für uns zu den Alten, auch wenn er, wie wir jetzt erfuhren, gerade erst Anfang sechzig gewesen war. Aber auch das erschien uns als stark fortgeschrittenes Alter, das dem Sterben nicht unangemessen war. Unsere Eltern fanden wir alt; wer noch älter war, war steinalt.
Pater Gerwalds Tod war in unserem Leben ein ganz undramatisches, aber immerhin interessantes Ereignis. Es durchbrach die Monotonie des Alltags in Schule und Internat, es riss uns aus unserem lustlosen Trott. Endlich war einmal etwas los!
In unserer kleinen Schul- und Klosterwelt, in der die Tage und Wochen sonst unbeirrt dem sturen Rhythmus folgten, den Stundenpläne und Glockenschläge vorgaben, brach nun eine rege Geschäftigkeit aus, die wir noch nie erlebt hatten. Requiem und Beerdigung mussten vorbereitet werden, Trauerbriefe wurden eingetütet, frankiert und verschickt, Pater Alban studierte mit der Schola nach dem Abendessen lateinische Choräle ein, die wir noch nicht kannten, die aber erhaben und feierlich klangen: «Hodie mecum eris in paradiso», hallte es mit den tiefen Stimmen der Primaner durch die offen stehende Tür des Musikzimmers hindurch bis ins Treppenhaus hinein.
Verwandte des Verstorbenen von auswärts kündigten sich an und sollten in einem stillgelegten Teil des Internats einquartiert werden, der nun rasch für die Trauergäste hergerichtet wurde. Pater Gerwald, so erklärte der Präfekt der Quartaner, werde für die Zeit bis zur Beerdigung in der Friedhofskapelle aufgebahrt. Allein dieses Wort erregte in uns einen angenehmen kleinen Schauer. Aufgebahrt! Wie das schon klang! Wann hatte man so etwas je erlebt?
Um kurz nach acht, als wir das leidige Ritual des Waschens unter Aufsicht an der Rinne mit eiskaltem Wasser hinter uns gebracht hatten und endlich auch das letzte Gebet des Tages verrichtet war, knipste Pater Wolfgang das Licht im Schlafsaal aus, und wir mussten nur noch warten, bis seine Schritte am Ende des langen Flures verklungen waren.
Wir horchten, bis Corky, der gleich neben der Tür schlief, munter rief: «Die Luft ist rein!»
Dann begannen wir zu reden. Wer von uns hatte schon einmal einen Toten gesehen?
Hudson erzählte von seiner Oma, konnte sich aber, weil er damals noch sehr klein gewesen war, nicht mehr genau erinnern, ob er sie nur todkrank oder wirklich tot gesehen hatte. Die Geschichte gab wenig her.
Katze hatte dagegen schon einmal eine Beerdigung mit allem Drum und Dran erlebt und erzählte von der flennenden Witwe am offenen Grab, die laut geschluchzt habe, als der Sarg hinabgelassen wurde – was er auf der Stelle so theatralisch nachahmte, dass wir alle sehr lachen mussten und uns nun gegenseitig darin überboten, ihr Schluchzen zu imitieren. Katze hatte aber beim Tod seines Großonkels nur den geschlossenen Sarg und nicht etwa den Toten darin gesehen. Auch das zählte nicht, befanden wir einstimmig.
Wir redeten weiter und ließen Lakritze, Esspapier und Limoflasche kreisen. Durch die fadenscheinigen blauen Leinenvorhänge fiel das Licht von den Laternen auf dem Schulhof hinauf in den Schlafsaal im zweiten Stock und auf unsere kindlich weichen Gesichter, in denen hellwache Augen funkelten. Niemand von uns war müde. Wir alle waren aufgeregt, gut gelaunt und sehr gesprächig an jenem Abend.
Ich selbst hatte noch keine Erfahrung mit dem Tod. Meine Großeltern lebten schon nicht mehr, als ich zur Welt kam. Die Mutter meiner Mutter, die letzte aus der Großelterngeneration, war wenige Wochen vor meiner Geburt nach nur zehn Tagen Bettlägerigkeit an einer bösen Infektion gestorben. Sie hat noch in ihren letzten Stunden ihre fieberheiße Hand auf den Bauch gelegt, in dem ich schon lebte und wuchs, und dabei mit geschlossenen Augen ein Gebet gesprochen.
In der Nacht darauf starb sie.
Meine Mutter saß neben dem Bett und hielt ihre Hand. Ich weiß es, das versteht sich von selbst, nur durch die Erzählung meiner Mutter, aber doch hat sich mir dieses Bild sehr früh schon eingeprägt, fast so, als wäre es doch meine eigene Erinnerung. Ich kann längst nicht mehr voneinander trennen, was meine Mutter erzählt hat und was ich mir dabei gedacht habe. Beides ist eins geworden. Deshalb steht mir noch heute dieser Moment erstaunlich klar vor Augen, ich sehe das Bett, Omas Hände, Mutters kugelrunden Bauch und die schmalen Lippen der Sterbenden, auf denen sich unhörbare Laute abzeichnen, die mir und meinem beginnenden Leben gelten, als flüstere sie mir in diesem Moment eine geheime Formel zu, die nur die Sterbenden kennen, die sie mir aber auf diese Weise verraten hat, damit ich so das Leben bestehe. Mich selbst sehe ich ebenso deutlich, wenn ich an diesen verschworenen Augenblick denke, in dem wir uns noch kurz begegnet sind, um einander zu grüßen und den Staffelstab des Lebens von der sterbenden in die werdende Hand gleiten zu lassen. Ich schwimme im warmen Fruchtwasser, das – wohl seines Namens wegen – in meiner Einbildung sehr angenehm duftet, nach Äpfeln und Pfirsichen, das Licht ist wohltuend gedämpft, ich spitze die Ohren und lausche aufmerksam durch die Bauchdecke, um mich an die Zauberformel der Großmutter später genau zu erinnern. Dann wird es still in meinem fabelhaft duftenden Teich, ihr Herz steht still, und unsere kurze Zeitgenossenschaft ist beendet. Jetzt hat sie es geschafft, und ich muss den Stab des Lebens weitertragen.
Sicher, da gehen nun die Pferde mit mir durch, und meine Phantasie überhöht den Moment weit hinaus über das Wenige, was durch die Berichte meiner Mutter verbürgt ist. Doch ich bestehe darauf, dass es so war. Meine Phantasie hat ihr eigenes Recht. Ich bin entschlossen, sie gegen jeden Einwand zu verteidigen.
Zuspruch und Berührung meiner sterbenden Großmutter waren nicht die einzigen Wege, auf denen mir der Tod schon damals sehr nahegekommen ist. Mein älterer Bruder, nur elf Monate vor mir in Steißlage entbunden, hatte nach einer ungewöhnlich schwierigen Geburt mit Zange und Saugglocke nur wenige Minuten außerhalb des Mutterleibes gelebt. Und auch mein Zwillingsbruder, der mit mir zusammen im Bauch herangewachsen war und, genau wie ich, von der sterbenden Großmutter den stillen Segenswunsch durch ihre aufgelegte Hand empfangen hatte, war noch in der Stunde unserer Geburt gestorben, da er, wie der Arzt meiner Mutter im Kreißsaal unumwunden erklärte, «einfach nicht lebenstüchtig» war.
In nicht einmal zwölf Monaten hatte meine Mutter, die schon vier Töchter hatte, drei Söhne zur Welt gebracht, von denen nur einer gesund war und die ersten Stunden und Tage überlebte. Johannes und Andreas dagegen hatten zwar noch kurz vor oder kurz nach ihrem Tod die Nottaufe und einen Namen empfangen, aber nicht einmal ein eigenes Grab bekommen, sondern waren bei Fremden anonym beigelegt worden, wie es in solchen Fällen üblich war. Ihre genaue Grabstätte war auch meiner Mutter nicht bekannt, was sie erst in späteren Jahren, als die Frage längst nicht mehr zu klären war, bekümmerte und in manchen Momenten gar als Schuld und Versäumnis quälte, wie es schien.
Die einzige augenfällige Erinnerung an die beiden Brüder in meinem späteren Leben waren ihre Namen, die ich nun hinter meinem Rufnamen trug und manchmal zur Verwunderung von Freunden oder Spielkameraden stolz und ein bisschen naseweis aufsagte: «Ich heiße Ludger Johannes Andreas Maria Brokbals.» Die Maria war noch am Tag meiner Taufe in letzter Minute dazugekommen. Mutter, die von der Wöchnerinnenstation im Morgenmantel aus blutrotem Frottee in die Krankenhauskapelle heruntergestiegen war, hatte den Priester, der gerade das Weihwasser über meinen Kopf gießen wollte, mitten im Taufritus unterbrochen und gebeten, auch noch den Namen der Gottesmutter anzufügen, weil ihre innigen Gebete, nicht auch noch den dritten Sohn zu verlieren, einstweilen erhört worden waren, und wohl auch, weil ja der für sie schicksalhafte Ort, das Marienhospital Bottrop, in dem ihr kurz hintereinander zwei Söhne und die eigene Mutter unter der Hand weggestorben waren, die angeflehte Heilige in seinem Namen trug.
Durch die sterbende Großmutter und die toten Brüder war mir der Tod schon sehr nahe gewesen, lange bevor ich den ersten eigenen Schritt getan oder das erste Wort gesprochen hatte, bevor ich wusste, was Freud und was Leid ist, ja genau genommen bevor ich überhaupt, wie es formelhaft und etwas kitschig heißt, das Licht der Welt erblickt habe.
In mancher Stunde, das ist wohl wahr, hänge ich heute den fragenden Gedanken nach, welche Spuren diese Todesfälle in den Landschaften meiner Seele hinterlassen haben mögen, ob eine Straße der Schwermut durch diese Landschaften führt, ob sich darin ein Tal findet, in dem die wortlose Traurigkeit einen Platz gefunden hat. Kann es sein, dass ein bedrohlicher Klang immerzu durch diese Landschaften hindurchweht wie der ferne Donner eines heraufziehenden Gewitters? Ist mein Leben schon auf der neunmonatigen Reise in die Welt hinein auf einen dunkleren Ton gestimmt worden als das all der anderen, die so sorglos und unbekümmert scheinen? Oder schimmern solche Fragen nur in der neunmalklugen Phantasie eines erwachsenen Menschen auf, der versucht, die Fäden seines frühesten Lebens zu entspinnen?
Ich weiß es nicht.
Gewiss ist, dass ich an all dies nicht die geringste bewusste Erinnerung habe. Ich kannte davon nur die sporadischen Erzählungen in unserer Familie und, schlimmer noch, den erschreckenden Ernst, der sich schlagartig auf das Gesicht meiner Mutter legte, sobald sie davon zu sprechen begann. Sie sah ganz fremd aus in diesen Augenblicken. Die Erinnerung schien aus ihr einen anderen Menschen zu machen, und ihre Traurigkeit breitete sich rasch im ganzen Zimmer aus wie die täglichen Rauchwolken der Overstolz-Zigaretten meines Vaters.
Ich wendete mich ab, wenn sie so sprach, verkroch mich im toten Winkel unter der Eckbank oder summte stumm in Gedanken ein Liedchen, während sie leise weiterredete und dabei auffallend oft schluckte. Bei nächster Gelegenheit versuchte ich stets, das Thema zu wechseln.
Ihre Worte waren eigenartig und klangen für meine Kinderohren wie das Vokabular einer unbekannten Fremdsprache – Worte wie Flehen, Bangen, Verzagen, Herrgott, Schicksal, Ergebung, Zorn und Verhängnis. In unserer Welt am Boyer Markt kamen solche Worte sonst nicht vor; sie hatten ihren Platz allein in der erzählten Familiengeschichte, die ich mir im Zuhören aneignete und mit meinen eigenen Phantasiebildern reichhaltig illustrierte, bis ich nicht nur die Großmutter und ihr Sterbezimmer, sondern auch mich selbst sehen konnte im Schoß meiner Mutter, Seite an Seite mit meinem Zwillingsbruder, dem ich immer aufmunternd zuflüsterte, bald werde es wohl losgehen und wir würden die Welt da draußen kennenlernen und unserer Mutter endlich ins Gesicht sehen können.
Trotz dieser frohen, hoffnungsvollen Bilder, die ich den Erzählungen hinzufügte, wohl um mir das Schwere erträglicher zu machen, war mir immer unwohl, Mutter von dieser Zeit reden zu hören. Und der Anblick ihrer niedergeschlagenen, wässrigen Augen, die sie manchmal für einen kurzen, versteiften Blick in ziellose Ferne hob, war kaum zu ertragen.
Geplagt hat es mich aber doch nur in manchen Augenblicken. Ich fiel nur selten auf durch Regungen, die andere Kinder nicht oder so nicht zeigten, etwa als ich einmal beim Anblick einer Bienenwachskerze am Christbaum, die flackernd mit dem Tode zu ringen schien und schließlich verlosch – ein feiner Rauchfaden, der in eleganten Serpentinen aufstieg, war ihr letztes Lebenszeichen und überwältigte mich vollends –, bitter weinen musste, und alle in der Familie lachten über meine mimosenhaften Reaktionen auf die einfachsten Alltagserscheinungen.
«Junge, sei nicht so eine Memme!», höre ich meinen Vater noch heute sagen, «es ist doch nur eine Kerze!»
Und Mutter sagte: «Du bist viel zu zartbesaitet und musst dickhäutiger werden. Wenn du schon um eine Kerze weinst, wirst du im Leben noch viel zu weinen haben, du Sensibelchen.»
Das half mir nicht, auch wenn sie mich dabei liebevoll anblickte und mit der Hand genau so über meine Wange strich, wie ich es am liebsten hatte.
Ich konnte mich lange nicht beruhigen, weinte immerzu und sagte schließlich: «Aber versteht ihr denn nicht? Die Kerze hat doch gelebt, und jetzt ist sie gestorben.» Meine ganze Familie schaute mich entgeistert an.
Und, auch das mag sein, es hat mich wohl härter als andere Kinder aus der Bahn geworfen, als ich in das Alter kam, in dem ein jedes Kind plötzlich um das Leben seiner Eltern fürchtet, weil es von der Erkenntnis ihrer Sterblichkeit zum ersten Mal mit ungebremster Wucht getroffen worden ist.
Die Angst griff mich an und ließ mich in mancher Nacht voller Grauen aufwachen. Ein ums andere Mal stellte ich mir vor, dass ich auch selbst mein Leben nicht mehr fortsetzen wollte, sollte meinen Eltern etwas zustoßen. Für den Fall, so war es in meinen kleinkindlichen Gedankenspielen bald als ganz handfester Plan erwachsen, würde ich mir eines unserer stumpfen Frühstücksmesser ins Herz rammen und dem ohne Vater und Mutter ohnehin wertlosen Leben die Fortsetzung mannhaft verweigern.
Ich durchlebte diese Gefühle womöglich schärfer als andere Kinder und quälte mich länger mit diesen Albträumen. Doch dann war die Phase eines Tages vorüber, die Träume verschwanden, und die Angst um meine Eltern löste sich in Luft auf. Ich war doch nicht sehr anders als andere Kinder. Das fanden meine Eltern, und zuzeiten fand ich es auch.
Jetzt, nach dem Tod von Pater Gerwald, gab es zum Kummer keinen Anlass. Die Dinge lagen ganz anders, dramatische Gefühle erlebten wir nicht, geschweige denn Trauer oder Todesängste. Im Gegenteil, wir fanden Gefallen an der Geschichte, die ein bisschen gruselig und gar nicht schlimm war. Deshalb war die Sache klar wie Kloßbrühe: Wir wollten die Leiche sehen! So beschlossen wir es spätabends in unserer heimlichen Lakritzrunde im Schlafsaal.
Wir waren ja nun schon zwölf Jahre alt, ich sogar zwölfeinhalb, um genau zu sein; wir waren also längst keine Kinder mehr. Meinen «Henrystutzen» hatte ich erst neulich für zwei Mark und fünfzig Pfennige an einen Sextaner verkauft. Ich brauchte ihn jetzt nicht mehr. Old Shatterhand war was für Knirpse. Stattdessen hatten wir vor kurzem einen Geheimbund mit dem verwegenen Namen Necropolis gegründet. Wie wir darauf kamen, weiß ich heute nicht mehr, wir wussten vermutlich noch nicht einmal, was das Wort heißt. Wir hatten es bestimmt im Latein- oder Griechischunterricht, vielleicht aber auch von einem älteren Schüler aufgeschnappt. Es klang geheimnisvoll, bedeutend und heldenhaft.
Necropolis!
Die Aufgaben und Ziele des Bundes waren vorläufig noch offen, aber die Mitgliedschaft war exklusiv. In Frage kamen nur die Besten, also zuverlässige, wagemutige und verschwiegene Jungs wie wir.
Wenn die Patres spätabends im Refektorium ihren Moselwein tranken und uns im Schlafsaal wähnten, erforschten wir den kleinen Luftschutzbunker neben der Aula und das endlose Labyrinth der Kriechkeller unter dem Kloster, das die ersten Mönche hier vor Menschengedenken angelegt hatten, weil das reichliche Wasser in den staunassen Böden des Weißen Venn keine mannshohen Keller erlaubte. Durch die winzigen Gänge hätten Erwachsene kaum hindurchgepasst, am allerwenigsten der dicke Pater Gerwald.
Hier unten fanden wir allerlei Kram aus alten Zeiten, versteckten unsere Errungenschaften oder genossen einfach die Heimlichkeit unserer nächtlichen Streifzüge und den Schabernack, den wir uns ausdachten. Wenn die Luft rein war, trauten wir uns auch hinüber in die Küche, die abends nach Ata, Priel und Schmierseife roch. Dann stahlen wir manchmal Knackwürste, Apfelsinen und eine Flasche «Sinalco» aus der Speisekammer.
Verwegene Kerle wie wir, so viel stand fest, durften vor dem Anblick eines Toten nicht zurückschrecken. «Ich bin dabei», sagten wir reihum und legten wie zum Schwur die Hände aufeinander. Keiner von uns zögerte.
Es war spät geworden, doch vermutlich hätten wir immer noch weitergeredet. Erst die Schritte Pater Wolfgangs auf dem Flur ließen uns verstummen, so dass wir schließlich doch allmählich zur Ruhe kamen und einer nach dem anderen einschlief.
Wir zogen am darauffolgenden Tag in der ersten Pause des Silentiums, also zwischen vier und fünf Uhr am Nachmittag, vom Kloster über den Bahndamm ins Dorf und weiter auf den Friedhof, der sich über einen kleinen Hügel erstreckte und früher sicher einmal außerhalb des Dorfes gelegen hatte. Jetzt aber umschloss das Dorf, das seit dem Krieg durch Heimatvertriebene und die ersten Pendler aus dem Ruhrgebiet kräftig gewachsen war, den Friedhof, als wäre er das Zentrum von allem und die Dorfbewohner hätten sich erst nach und nach um ihn herum angesiedelt.
Als wir kamen, war die Witwe Tenbohlen gerade mit Gießkanne und Harke am Grab ihres Mannes beschäftigt. Erst als sie endlich fertig war und davonzog, waren wir unbeobachtet.
Uns stockte vor Aufregung der Atem, als wir vor der Kapelle standen und die schmiedeeiserne Klinke der schweren Doppeltür herunterdrückten. Jetzt galt es, die Nerven zu bewahren und sich nichts anmerken zu lassen. Ich summte schon einmal in Gedanken ein Lied.
Doch die Kapelle war verschlossen.
Manni hatte wie immer einen Dietrich dabei, mit dem wir eine gute Weile im Schlüsselloch herumstocherten, aber es gelang uns partout nicht, die Tür zu öffnen. Katze stand am Friedhofstor Schmiere, während wir uns daranmachten, per Räuberleiter wenigstens einen Blick durch die Fenster der Kapelle zu ergattern. Ich zog mich für fünfzehn oder zwanzig Sekunden am Fenster hoch, einen Fuß in Hudsons gefalteten Händen, und sah durch die verstaubte Scheibe den offenen Sarg.
Viel war unter diesen Umständen nicht zu erkennen. Pater Gerwald lag sehr feierlich im sonntäglichen Habit der Mariannhiller Missionare da, die weinrote Bauchbinde immer noch über dem Bauch stramm gespannt, die weißen Haare kaum zu unterscheiden von der strahlend weißen Einfassung des Sarges, die aussah wie die fein bestickten Paradekissen mit meinen Initialen, auf denen ich als kleines Kind geschlafen hatte. Sein Gesicht sah ich nicht richtig. Üppige Sträuße weißer Nelken, mit Asparagus durchsetzt, standen links und rechts vom Sarg und versperrten mir die Sicht.
«Mach’ schon, Lutz, ich kann bald nicht mehr», rief Hudson stöhnend von unten zu mir hoch. Ich sprang herab, lehnte mich mit dem Rücken an die rot verklinkerte Wand, faltete die Hände zum Steigbügel und gab nun meinem Freund die Gelegenheit, den Toten durchs Fenster hindurch zu inspizieren.
«Der ist mausetot», sagte Hudson und rieb sich mit dem Ärmel den Rotz von der Nasenspitze, während er noch mit der anderen Hand oben am Fenstersims hing und ich seinen Fuß festhielt, «frage mich nur, wie die den Burschen in den Habit hineingekriegt haben. Da mussten sie ihm bestimmt ein paar Knochen brechen. Aber das ist ja nun auch egal.»
Auch die anderen bekamen ihn noch auf gleiche Weise zu Gesicht, aber wiederum ein paar Minuten später pfiff Katze durch zwei Finger den Pfiff der Necropolis, und wir verdufteten rasch durch den Hintereingang am Meisenweg.
Unsere Mission war erfolgreich gewesen. Wir hatten nun unseren ersten Toten gesehen und zogen in dem Triumphgefühl davon, gerade ein ungeheures Abenteuer bestanden zu haben, ja fast schon eine Reifeprüfung.
Die Erzählungen, wie er ausgesehen hatte, schmückten wir in den Tagen darauf immer weiter aus. Hudson behauptete steif und fest, er habe gesehen, wie dem Toten eine grünlich glänzende Fliege ins linke Nasenloch krabbelte, zudem sei durch die Fensterritzen ein scharfer Verwesungsgeruch von der Leiche nach außen gezogen, der ihn vor Ekel beinahe habe in Ohnmacht fallen lassen.
Das alles war gewiss gelogen. Aber es wertete die Geschichte auf und flößte den Jüngeren, bei denen wir damit fröhlich prahlten, zusätzlich Angst ein.
Am Tag der Beerdigung hatten wir alle kleine Aufgaben zu erledigen. Corky trug das Prozessionskreuz, Manni und Hudson ministrierten und kümmerten sich um Weihrauch und Weihwasser, womit der Sarg zu Beginn des Requiems eingeräuchert und besprenkelt werden sollte. Ich selbst musste die einzige Glocke der kleinen Trappistenkirche läuten, die nach der Totenmesse pünktlich zum Auszug aus der Kirche erklingen sollte.
Über diese Glocke, die noch aus der Urzeit des Klosters um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts stammte, als hier die ersten Mönche das bis dahin unwirtliche Sumpfgebiet mit einem Grabensystem einigermaßen trockengelegt und urbar gemacht hatten, gab es eine alte Geschichte, die wir alle kannten. Die alten Weiber im Dorf nämlich, mit denen wir manchmal ins Gespräch kamen oder die an Festtagen im Kloster zu Gast waren, sagten:
«Unsere Glocke ist etwas Besonderes, so etwas gibt es anderswo gar nicht. Sie hat zwei verschiedene Töne. Wenn sie für eine Beerdigung läutet, ist der Ton tiefer als sonst, und dunkler und trauriger klingt sie dann auch. An anderen Tagen ist dieser Ton nicht zu hören, dann klingt dieselbe Glocke hell und freundlich, obwohl eine Glocke doch nur einen Ton haben kann.»
Das meinten sie ernst, und die alte Frau Lütkecosmann, eine Bäuerin mit Kopftuch, Krückstock und wenigen Zähnen, die nichts als Plattdeutsch sprach, behauptete sogar, ein durchreisender Glockengießer aus Innsbruck habe einmal oben im Glockenturm nachgesehen und mit seinen Instrumenten einige «wetenschappelikke» Untersuchungen vorgenommen. Dabei habe sich das rätselhafte Phänomen, dass also am Beerdigungstag und nur dann ein anderer Glockenton erklingt, bestätigt, auch wenn sie auf unsere Nachfrage hin gar nicht in der Lage war zu sagen, wie es sich denn bestätigt haben sollte, wenn der Durchreisende nur an einem einzigen Tag in Maria-Veen war.
Weiß der Himmel, warum der Glockengießer gelogen hat, vermutlich, um sich bei den Dorfbewohnern einzuschmeicheln oder ein nettes Trinkgeld für seine Gefälligkeit zu ergaunern. Vielleicht hat die alte Frau Lütkecosmann die ganze Chose auch frei erfunden. Wir selbst haben das Weibergeschwätz natürlich nie geglaubt.
Als mir am Ende des Requiems Pater Otfried das vereinbarte Zeichen gab und der lange Tross der Zelebranten in den violetten Messgewändern mit der Schola und der Trauergemeinde den Ausgang der Kirche erreichte, begann ich sogleich, kräftig am Seil zu ziehen. Ich hörte genau hin. «Die Glocke klang wie immer, Jungs! Einen anderen Ton habe ich nicht gehört», sagte ich beim Mittagessen wenig später. Alles andere, da waren wir uns einig, war Kokolores.
II
In unser Leben zog bald nach der Beisetzung wieder der alte, gleichförmige Rhythmus ein. Es waren lange und oft öde Tage, die mit der Laudes, dem Morgengebet, begannen und mit der Komplet, dem Nachtgebet, endeten. Dazwischen Latein und Algebra, Turnen und Singen, Vokabeltests, Silentium, Fußball und noch mehr Silentium. Hin und wieder ein Ausflug zum Kaugummiautomaten und zum «Platten Jupp», dem ein englischer Tiefflieger noch in den letzten Kriegstagen das Dach weggeschossen hatte, so dass er seither ohne Dach und nur mit einer primitiven Abdeckung aus Holzlatten und Teerpappe auskommen musste, die einmal als Provisorium gedacht war, nun aber auch schon seit Jahrzehnten hielt. Bei ihm gab es Limo und Eis, und gleich nebenan kostete die Portion «Pommes Rotweiß» eine Mark und zehn Pfennige, was wir uns nicht täglich, aber etwa ein- bis zweimal wöchentlich leisten konnten.
Sehnsüchtig schaute ich während der langen Nachmittagsstunden am Pult aus dem Fenster, wie der Wind durch die Pappeln und die Kopfweiden wehte und die langen Kohlenzüge vom Ruhrgebiet aus nach Rheine und weiter in Richtung Nordsee fuhren. Wie beneidenswert! Auf dem Weg zum Meer! Wir dagegen waren höchstens auf dem Weg zum Speisesaal, zur Hauskapelle oder zur nächsten Strafarbeit.
Von Pater Gerwald sprachen wir noch oft. Wir sprachen jetzt sogar viel häufiger von ihm als zu seinen Lebzeiten. Die Begegnung mit dem toten Mönch in der Friedhofskapelle wurde zu einer Legende, die uns vor allem bei den Pimpfen im Internat eine gewisse Bewunderung sicherte. Und da wir sonst wenig erlebten, ragte diese Erfahrung heraus. Wir kamen uns nun auch viel erwachsener und männlicher vor. Immerhin, so glaubten wir, hatten wir dem Tod schon einmal ins Gesicht gesehen.
Die Patres meinten es gut mit uns. Wir erlebten keine Kindheit «unterm Rad», auch wenn ich später in manchen Augenblicken der Versuchung nicht widerstehen konnte, eine Leidensgeschichte zu erfinden, die Mitgefühl und Sympathien einbringt und eine halbwegs passable Erklärung für meine Eigenarten und Charakterschwächen bietet. Es passte später auch gut zum Ton der Zeit, sich als Opfer autoritärer Mächte zu fühlen, Eltern und Lehrer zu verteufeln und die Kindheit zur Knechtschaft umzudeuten.
Mit der Wahrheit hatte all das wenig zu tun. Tatsächlich waren die Lehrer und Präfekten gutmütig, nur waren sie zugleich unbeholfen, wenn es um die Erziehung von Kindern und Halbwüchsigen ging, und sie waren, wie jeder andere Mensch auch, gefangen in ihren eigenen Beschränktheiten. Sie alle – die jüngsten von ihnen waren in der Zwischenkriegszeit zur Welt gekommen und die ältesten in den letzten zehn Jahren des neunzehnten Jahrhunderts – sprachen auch ganz einfach eine andere, oft unverständliche Sprache, die zwischen ihnen und uns stand wie eine der mannshohen roten Backsteinmauern, die das Kloster in alle Richtungen vor der Welt da draußen abschirmten.
Sport war in ihren Worten kein Spaß, sondern eine «Leibeserziehung». Trieben wir Unsinn, so sagten sie, wir hätten «gefehlt». Unsere Prügeleien nannten sie «Händel» und unsere Jeans «Nietenhosen». Und wenn sie selbst einmal aus der Haut fuhren, alle guten Vorsätze vergaßen und nach Herzenslust fluchten, kam nicht mehr dabei heraus als «Zaperlot!», «Donnerkeil!» oder «Scheibenkleister!». Wenn sie uns unterweisen wollten in Betragen, Moral, Anstand, Benimm und Fleiß, klang in unseren Ohren jedes Wort wie chinesisch. Wir nickten brav und verstanden nichts. Ein «Lump» oder «Banause», lernten wir, war das Schlimmste, was es auf der Welt gab, und Gott behüte, dass wir selbst einmal so endeten. Einen tapferen Helden dagegen nannten sie einen «echten Kerl», was nun wirklich keinen Sinn ergab.
Ihr ganzes drolliges Vokabular schien eingefroren in der Zeit von Pole Poppenspäler und Effi Briest. Dabei hatten wir längst unseren eigenen Jargon, den sie aber erstaunlicherweise nicht verstanden und auch nicht lernen wollten, obwohl er doch modern und zeitlos war und Wort für Wort so unheimlich treffend klang. Alles, was uns gefiel, nannten wir «astrein», «spitze» oder «dufte». Waren wir sehr überrascht, sagten wir: «Ich schnalle ab!» War jemand traurig, sagten wir: «Er ist total down.» Wenn wir schon hinterm Mond leben mussten, wollten wir wenigstens sprachlich voll auf der Höhe der Zeit sein.
Auch die Predigten der Patres waren oft so eintönig und fad, dass wir die Ohren ganz einfach auf Durchzug stellten und unseren Tagträumen nachhingen, etwa der verlockenden Idee, beim letzten Tageslicht auf einen der Kohlenzüge aufzuspringen, die in der Hülstener Kurve einladend langsam fuhren und zweimal pfiffen, als wollten sie uns zum Mitfahren ausdrücklich ermutigen. Man hätte gut und gern aufspringen können, um dann am nächsten Morgen pechschwarz, aber glücklich und frei aus der Kohle herauszuklettern und in einem Nordseehafen zu stehen, wo man endlich das Meer sehen oder, noch besser, gleich auf einem Schiff anheuern könnte, um als Seemann in die Welt hinauszufahren. Stattdessen aber immer neue Andachten, Heiligenlegenden und Lesungen aus dem Evangelium.
Jedes Mal, wenn einer der Patres vorn am Ambo die Stimme erhob, hatte Jesus wieder etwas gesagt oder getan, was zwar zugegebenermaßen imposant war, aber nun wirklich nicht hier und heute, an einem trüben Oktobertag bei uns in Maria-Veen, stattfinden könnte. Dass der Erzengel Gabriel eines Morgens den Schlafsaal betreten würde, um ungeheure Neuigkeiten zu verkünden, war genauso wenig zu erwarten wie die Heilung eines Contergankindes im nahe gelegenen Benediktushof oder die Auferweckung eines Toten, der schon seit drei Tagen im Grab lag. Und der Gott der Liebe und des Verzeihens, der barmherzige Vater, der den verlorenen Sohn nicht einmal bestraft, sondern ihm erfreut entgegenläuft und ihn ohne alle Umstände wieder in die Arme schließt – all das war hier zwischen Studiersaal, Musikzimmer und Turnhalle sehr selten und auch dann nur in den vagesten Umrissen zu erkennen.