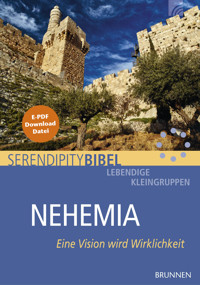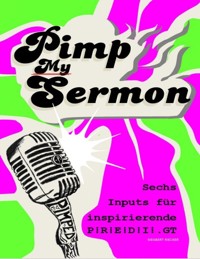
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zu oft scheitert die Predigt nach einem Marathon fleißiger Exegese auf den letzten Metern an der Präsentation des Vortrags. Was ist notwendig, damit Worte das Herz eines Menschen treffen? An einer akademischen Einrichtung erlebt und lernt der Theologe, wie Akademiker reden. Eine schlechte Voraussetzung, wenn man verstanden werden möchte. Darum richtet dieses Buch den Blick über den theologischen Tellerrand hinaus: Dort wissen andere gehaltvolles zu berichten: was lässt sich lernen von einem Strategieberater, von Predigern aus einer anderen Kultur und aus einem anderen Jahrhundert, von einem Journalisten, einem Rhetoriktrainer, einem Unternehmensberater?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sechs Inputs für
inspirierende
P⁞R⁞E⁞D⁞I⁞.GT ▓
Siegbert Riecker
2020
Morrisville NC
»Seid natürlich, seid natürlich, seid natürlich.«
Charles Haddon Spurgeon1
paperback edition ISBN 978-0-244-27521-1
hardcover edition ISBN 978-1-470-93872-7
Riecker, Siegbert:
Pimp My Sermon: Sechs Inputs für inspirierende PREDI.GT / Siegbert Riecker. – Morrisville, NC: Lulu, 2020.
© 2020 Siegbert Riecker
www.lulu.com
PACKENDWer hört schon gerne jemandem zu, der nicht echt ist? Erik Flügge und der Jargon der Betroffenheit
Der Unterhaltungswert – ein geistlicher Faktor?
Der Jargon der Betroffenheit
Exkurs zur Sprache Kanaans
Schöngeistig und existentialistisch
Leidige Tröster mit leerer Luft
Wir sind alle Siebenjährige
Nachahmer des großen Theologen Dr. Silberzunge
Voraussetzung für einen natürlichen Predigtstil
RELEVANTMenschen suchen nicht nach Wahrheit, sondern nach Entlastung. Rick Warren und die richtigen Fragen
»Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?«
»Wozu um alles in der Welt lebe ich?«
Die empirische Wende
Die ›lupenreine‹ Auslegungspredigt
Die Frage nach der richtigen Frage
Fragebogen zur Wirkung von Predigten
Exkurs: Die richtigen Fragen an das Alte Testament
Themenwelten für Lebensfragen – Das Beispiel von Joyce Meyer
Exkurs: Ausgewogen Predigen
Unausgesprochene Fragen – Das Beispiel von Gordon MacDonald
Welche Fragen beschäftigen Menschen im Verlauf ihres Lebens?
Fragen finden – Quellen der Inspiration
Checkliste Predigt – Ist alles drin? Ein Beispiel
ECHTDie mühsamste und wirksamste Predigtweise Charles Haddon Spurgeon und die freie Rede
Er stand da wie immer, der Meister jeder Versammlung
Vorgefertigt und gleichzeitig frei
Ohne Papier und doch nicht auswendig
Eine Rede ist keine Schreibe
Kleine Geschichte der freien Predigt
Kritik an der freien Predigt
Lampenfieber
Steckenbleiben und Blackout
Spurgeon über die Kanzel
DEUTLICHVon Goethe, Einsilbern und dynamischen Verben Wolf Schneider und das Drei-Sekunden-Fenster
Drei Sekunden – sechs Wörter – zwölf Silben
Nebensätze reduzieren
Den Teil für das Ganze sprechen lassen
Goethe, Einsilber und dynamische Verben
Exkurs: Angehängte Sätze mit oder ohne »und«
INTENSIVWas das Herz erreicht: Bilder, Geschichten und Gefühle. Matthias Pöhm und der bewegte Eisberg
Auf die Affektionen des Herzens ziehen zielen
Wie man einen Eisberg bewegt
Manipulation und Argumentation
Bilder
Der Schwebebalken
Geschichten
Gefühle
»Vergessen Sie alles über Rhetorik«, fast alles...
»Kennst du ihn?«
...Gib nicht zu früh auf: Zehn Jahre, die sich lohnen Malcom Gladwell und die 10.000-Stunden Regel
Talent und das Mittelmaß
Talent oder Training?
Der Gewinn eines schweren Anfangs
»Untalentierte« Meister der Worte
Die sinnvollste Arbeit der Welt
Was Prediger von Mozart und den Beatles lernen können
Was am Anfang aussichtslos erscheint
Die theologische Schule und die Sinnfrage
GEISTGELEITET•TEXTGEBUNDENEpilog
Literaturverzeichnis
Kommentiertes Verzeichnis mit Literaturempfehlungen zu Rhetorik
Anhang: Das lebensrelevante Thema der Predigt
Wozu ein solches Buch?
»Prüft aber alles, und das Gute behaltet.«
1. Thessalonicher 5,21
»Die Erscheinung, um die es geht, ist sehr verbreitet... Aber ich habe noch niemanden gefunden, der sich richtig darum gekümmert hätte.«
John Langshaw Austin2
»In der Bibel lesen wäre keine schlechte Idee... Bert[olt] Brecht hat jeden Tag darin gelesen, um sich an dieser Sprache zu schulen...«
Wolf Schneider3
Dieses Buch ist keine Einführung in die Rhetorik – weder in die klassische Rhetorik noch in die Rhetorik einer Predigt. Es geht um Inspiration.
Wer seinen Predigtstil nicht verändern möchte, der kann das Buch getrost zur Seite legen, es würde ihn nur ärgern!
Für alle anderen bietet es eine Chance: Denn jede Woche gut zu predigen fordert ein extremes Maß an Kreativität. Die wird aufgezehrt, wenn ich sie nicht ständig füttere. Und die gesündeste Nahrung für Kreativität ist eine vollwertige Mischung aus Liebe, frischer Luft... und Inspiration.
Wer merkt, dass seine sachkundigen Predigten keine Wirkung zeigen, zieht oft den falschen Schluss: »Daran ist die Bibel schuld! Kein Wunder, wir leben im 21. Jahrhundert. Die Bibel bringt’s nicht mehr. Jetzt müssen andere Quellen der Inspiration her...«
Ich bin jedoch davon überzeugt: Die Bibel ›bringt es‹ heute mehr denn je. Die Botschaft ihrer Worte ist einzigartig. Die Kraft ihrer Worte übertrifft unsere Vorstellungen. Die Schönheit ihrer Worte ist grandios. Sie tröstet die Leidenden, sie heilt die Zerbrochenen, sie befreit die Gefangenen. Die Hungernden macht sie satt, den Unterdrückten gibt sie Recht, den Abgeschobenen gibt sie Würde, den Einsamen gibt sie Geborgenheit, den Verzweifelten gibt sie Hoffnung. Kein religiöses Buch, keine Selbsthilfegruppe, keine Droge, kein Mentor, Psychiater, Sozialarbeiter oder Politiker hat ein solches Potential.
Nein, das Problem ist nicht die Bibel.
Das Problem ist die Theologie –
die Art und Weise, wie ich mich mit der Bibel beschäftige. In meinen zwanzig Jahren als Prediger habe ich eines immer wieder erlebt: zu oft scheitert die Botschaft meiner Predigt nach einem Marathon fleißiger Bibelexegese auf den letzten zehn Metern an dem mangelhaften Vortrag.
Natürlich gibt es das alles auch im Studium: Rhetorik, Homiletik, Theorie der Kommunikation. Aber das wirkliche Leben ist eben keine Theorie. Und da geht es um diese einfache Frage: wie bringe ich es praktisch am besten rüber? Was außer Gebet ist notwendig, damit die Worte das Herz eines Menschen treffen? Auch hier hat die Bibel etwas zu bieten, leider viel zu oft übersehen. Statt nur darauf zu achten, was Jesus predigt, sollte ich davon lernen, wie Jesus predigt. Darum noch einmal: Dieses Buch kann die intensive Auseinandersetzung mit der Bibel nicht ersetzen. Aber es soll verhindern, dass ihre mächtigen Worte in der Predigt die Dynamik und Energie verlieren.
Das Problem ist nicht die Bibel. Das Problem ist der beschränkte Erfahrungshorizont einer soziologisch geprägten akademischen Ausbildung. (Wenn Sie diesen Satz verstehen, dann haben Sie eine solche wahrscheinlich durchlaufen). An einer akademischen Einrichtung erlebe und lerne ich, wie Akademiker reden. Eine schlechte Voraussetzung, wenn ich verstanden werden möchte. Darum richtet dieses Buch den Blick über den Tellerrand hinaus. Jenseits der Grenzen theorielastiger Homiletik an deutschen Universitäten gibt es vieles zu entdecken! Wo sich die Theologie beredsam ausschweigt, wissen andere einiges und gehaltvolles zu berichten. Dieses Buch greift aus den unterschiedlichsten Bereichen je ein möglichst originelles Beispiel heraus.
Was lässt sich lernen...
...von einem politischen Strategieberater (Erich Flügge)?
– Eine Predigt kann packend sein!
...von einem Pastor in einer anderen Kultur (Rick Warren)?
– Eine Predigt kann relevant sein!
...von einem Prediger aus einem anderen Jahrhundert (Charles Haddon Spurgeon)?
– Eine Predigt kann echt sein!
...von einem Journalisten und Sprachkritiker (Wolf Schneider)?
– Eine Predigt kann deutlich sein!
...von einem populärwissenschaftlichen Rhetoriktrainer (Matthias Pöhm)?
– Eine Predigt kann intensiv sein!
...von einem inspirierenden Unternehmensberater (Malcom Gladwell)?
– Auch du kannst so predigen!
Eine Predigt kann packend sein, relevant, echt, deutlich und intensiv!
Einen herzlichen Dank an alle, die bei der Erstellung des Manuskripts geholfen haben, insbesondere Friederike Schulte für das geduldige Korrekturlesen!
Der Titel einer eine amerikanische Fernseh-Serie, in der es um das Tuning von schrottreifen Autos geht, heißt »Pimp My Ride«, zu Deutsch »Motz meine Karre auf«. Der Titel und das Format der Sendung haben bereits für einigen Spott und Persiflagen gesorgt.
Entgegen dem Eindruck, den sein Titel vermitteln könnte, geht es in diesem Buch gerade nicht darum, eine schlechte Predigt durch eine oberflächliche Rhetorik aufzumotzen. Es geht darum, einer guten Botschaft entsprechendes Gehör zu verschaffen. (Ob eine gute Botschaft entsteht, entscheidet sich am Verhältnis zum Bibeltext, siehe Epilog).
PACKEND
Wer hört schon gerne jemandem zu, der nicht echt ist?Erik Flügge und der Jargon der Betroffenheit
»Wollen die leeren Worte kein Ende haben? Oder was reizt dich, so zu reden?«
Hiob 16,3
»Ich glaube, dass es eine Sünde ist, Menschen mit der Bibel zu langweilen.«
Rick Warren4
Der Unterhaltungswert – ein geistlicher Faktor?
Unterhaltung – mehr noch das englische Gegenstück Entertainment – steht bei ernsthaften Theologen nicht hoch im Kurs. Unterhaltung ist seicht, nein das wollen wir nicht. Seriös muss es sein, mit gehobenem Anspruch. Doch woher kommt diese Abneigung?
Wer an Unterhaltung denkt, hat gewöhnlich drei Dinge vor Augen:
Die Aufmerksamkeit eines Menschen gewinnen und halten.
Freude und Vergnügen.
Oberflächlichkeit und Gehaltlosigkeit.
Das dritte Element ist zweifellos verantwortlich für den schlechten Ruf von Entertainment. Im Sinn einer Definition greift diese Liste jedoch zu kurz.5 Entertainment an sich heißt nicht Oberflächlichkeit. Der Unterhaltungswert hat mit dem Gehalt einer Botschaft absolut nichts zu tun. Es gibt unterhaltsame, gehaltvolle Predigten – genauso wie es langweilige, gehaltlose Predigten gibt.
Unterhaltung hat oft sehr ernsthafte (auch religiöse!) Absichten. Die Spiritualität von Hollywood beschäftigt Theologen seit langem. Wer genauer hinblickt, erkennt: in vielen Fällen geht es darum, auf dem Weg der Unterhaltung Einsichten und Wissen zu vermitteln.
Es gibt kein wirkungsvolleres Klima für Lernen und Wachstum, als die Kombination von Aufmerksamkeit und Freude.
Eine langweilige Predigt dagegen ist ein geistliches Problem:
Wenn Gottes Wort uninteressant vermittelt wird, dann denken die Menschen nicht einfach, dass der Prediger langweilig ist, sondern sie denken, Gott sei langweilig! Wir bringen Gottes Charakter in Verruf, wenn wir in einem geistlosen Stil oder ermüdenden Tonfall predigen.6
Der amerikanische Pastor und Bestseller-Autor Rick Warren sagt hier nichts Neues. Vor ihm haben bereits Prediger wie Howard Hendricks und Jim Rayburn7 ähnlich geurteilt. Diese Idee ist der Predigtlehre seit langem vertraut.
Für Rudolf Bohren, einen der großen deutschen Praktischen Theologen der Nachkriegszeit, ist die Langeweile eine der sieben Laster oder Untugenden eines Predigers. Er nennt:8
Korrektheit: »dem Prediger ist es wichtiger, richtig zu predigen, als daß Menschen zur Freiheit kommen und über dem Evangelium froh werden.«9 Das Gegenteil von Korrektheit ist in diesem Sinn nicht Schlampigkeit, sondern Freiheit. Es sind Predigten ohne befreiende Kraft, die aus dem Evangelium ein Gesetz machen.Mutlosigkeit: Mutlose Predigten sind harmlos, haben keine Kraft, die Angst zu überwinden und zur Freude zu gelangen. »Der Mutlose vermag nie zu sagen, was Gott jetzt und hier tut.«10Langeweile: »Wenn es eine Intoleranz gibt, die christlich ist, dann die gegen die Langeweile.«11 Wenn der Prediger nichts zu sagen hat und doch reden muss, dann wird er zum Langweiler. Bohren empfiehlt als Gegenmaßnahme, fleißig »am richtigen Ort das Richtige für seine Predigt zu stehlen«,12 sich also positiv formuliert von den Ideen anderer inspirieren zu lassen.Bequemlichkeit oder Faulheit äußert sich üblicherweise in scheinbarer Überbeschäftigung, »Hast und Unrast« (vgl. Spr 13,4), die die notwendige Zeit für Meditation und Ruhe bei der Predigtvorbereitung raubt.Geschwätzigkeit: »Wer sich nicht die Zeit nimmt für das Wort, wird wortreich.«13Selbstgefälligkeit: Der Hochmütige und der Feige haben eines gemeinsam: ihnen ist die Gottesfurcht abhanden gekommen. »Echte Demut verdrängt das Selbstbewußtsein nicht, stellt es aber unter die Gnade.«14Gefallsucht, der Hang, den Menschen gefallen zu wollen. Der Prediger dient nicht Jesus, sondern verkauft sich selbst an den Zuhörer (vgl. Gal 1,10; 1.Thess 2,4).Doch kann man wirklich behaupten, dass langweiliges Predigen Sünde ist? Oder andersherum gefragt: Ist der Unterhaltungswert ein geistlicher Faktor? Ist diese Behauptung von Rick Warren nicht vielmehr ein typisches Kind der modernen Unterhaltungsindustrie, wo alles spannend, interessant und außergewöhnlich sein muss, wenn es überhaupt noch gehört werden will?
Die Bibel hat zu dieser Frage auf den ersten Blick recht wenig zu sagen. Am nächsten kommt der Frage nach dem Unterhaltungswert vielleicht noch die Aufforderung in Kolosser 4,6: »Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt«. Allerdings geht es hier nicht um das Predigen, sondern um das christliche Zeugnis im Gespräch: »...dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt«. Auch muss nicht unbedingt eine würzende Note im Blick sein (das Gegenteil von »fade«, Mt 5,13). Salz wurde damals auch als Konservierungsmittel verwendet (das Gegenteil von »faulig«, Eph 4,29).15 Die Neue Genfer Übersetzung bringt das Salz sogar mit Weisheit in Verbindung: »Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz ´der Weisheit` [ergänzt] gewürzt sein«.
Der Apostel Paulus bezeichnet seine Predigt in Korinth rückblickend als ein Produkt aus Schwachheit und Furcht. Er verzichtet bewusst auf rhetorische Techniken der Überredungskunst:
Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; 4 und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft (1.Kor 2,3f).
Dennoch ist seine Predigt alles andere als langweilig, sie ist geisterfüllt und kraftvoll. Um die Frage nach dem Unterhaltungswert zu verstehen, lohnt es sich, ein Stück tiefer bei den Motiven des Predigers anzusetzen.
Eine ansprechende Predigt ist in erster Linie das Ergebnis von Liebe, von Liebe zu Gott, seinem Wort und zum Hörer.16 Helge Stadelmann, Autor eines der meistgelesenen zeitgenössischen Lehrbücher zur Predigtlehre in deutscher Sprache,17 verwendet hier den Begriff der Liebes-Mühe. »Liebesmühe« drängt dazu, »das biblische Wort anschaulich, dynamisch und lebensnah zu kommunizieren«.18 Wer liebt, der gibt sich Mühe. Liebe ohne Mühe ist leere Gefühlsduselei. Mühe ohne Liebe ist kaltherzige Streberei. Jeder Prediger braucht auch ein gesundes Maß an Eigenliebe. Doch entscheidend ist die Liebe zu seinen Zuhörern:
Weil ich mich selbst liebe,...
werde ich immer versucht sein, so zu predigen, dass ich mich nicht überfordern oder verbiegen muss. Ich tendiere dazu, mich nicht mit mehr Mühe zu belasten als wirklich nötig. Auch möchte ich mit Vorliebe über das reden, was ich selbst interessant finde.
Weil ich meine Zuhörer liebe,...
werde ich versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Ich gebe mir Mühe, damit sie zuhören. Warum? Das Hören ist ein absolut entscheidender Faktor, wenn es um die Rettung geht! »Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?« (Röm 10,14). Ob der Hörer zuhört, das ist zum Teil seine eigene Entscheidung. Zu Teilen liegt es aber auch in meiner Verantwortung als Redner. Es macht Mühe, sich in den Zuhörer hineinzudenken. Es macht Mühe, so zu reden, dass es das Interesse weckt. Doch ohne diese Mühe geht es nicht. Eine langweilige Rede hat zur Folge, dass der Hörer nicht hört. Die Gedanken schweifen ab, der Hörer schaltet ab. Das ist nicht das Ziel der Botschaft. Die Predigt ist wirkungslos vorübergezogen, der Auftrag ist nicht erfüllt.19
Der Jargon der Betroffenheit
Am 19. April 2015 verfasst der Strategieberater Erik Flügge einen Blogbeitrag unter dem Titel »Die Kirche verreckt an ihrer Sprache«. Flügge ist kein Gegner der Kirche, im Gegenteil: er war jahrelang in der katholischen Jugendarbeit tätig und fühlt sich innerlich eng mit seiner Kirche verbunden. Aus dem Blogbeitrag entsteht ein Buch, welches es immerhin zwei Wochen lang auf die Bestsellerliste »Paperback Sachbücher« des Spiegel schafft.20 Blog und Buch beginnen mit den Worten:
Sorry, liebe Theologen, aber ich halte es nicht aus, wenn ihr sprecht. Es ist so oft so furchtbar. Verschrobene, gefühlsduselnde Wortbilder reiht ihr aneinander und wundert euch, warum das niemand hören will. Ständig diese in den Achtzigern hängen gebliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach dem wer ich bin und werden könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich schon längst war. Hä? – Ach bitte, lasst mich doch mit so was in Ruhe.21
Es ist interessant, dass Flügge mit seiner Kritik in erster Linie nicht die sogenannte »Sprache Kanaans« angreift, einen u.a. durch die Luther-Übersetzung der Bibel geprägten Sprachstil.
Exkurs zur Sprache Kanaans
Vor der »Sprache Kanaans« wird heute in fast jedem Lehrbuch zur Predigt an irgendeiner Stelle gewarnt. Der langjährige Journalist Gerd Rumler verfasste sogar ein fast 100seitiges Synonym-Wörterbuch, um »altverbrauchte christliche Klischees« loszuwerden.22 Der Rhetorik-Dozent Eberhard Wagner untersucht die Ursachen für die Entstehung der Sprache Kanaans und gibt einige Beispiele:
Es ist Gott ein Kleines, ...
Der Herr hat Gnade dazu gegeben.
Er hat die Welt wieder liebgewonnen.
Es ist uns geoffenbart.
Wir haben einen Erretter.
Wir haben hier keine bleibende Stadt.
Ich habe dort einen Dienst.
Liebe Geschwister!
Bruder Schmidt, wollen Sie uns bitte im Gebet leiten?
Wer hat noch ein Anliegen?
Leben Jesu
Leiden Christi23
Wagner unterscheidet von der Sprache Kanaans eine Sonderform des sogenannten »Neukanaanäisch«: damit bezeichnet er eine Art Ghetto-Sprache, die sich in frommen Kreisen etablieren kann. Als Beispiele nennt er unter anderem Redewendungen wie:
Wir freuen uns über dieses Grüßen.
Teure Freunde!
Ich diene Ihnen nun mit dem Wort.
Wir sollten ins Gebet gehen.
Ist das vielleicht ein Fingerzeig Gottes?
Du mußt Dich darunterstellen.
Nun wollen wir stille werden.
Das ist die Retterliebe Jesu.
Haben Sie Freudigkeit, den Gottesdienst in Marburg zu halten?
Wir haben sein Hindurchtragen verspürt.
Er ist mir zum Segen geworden.
Wir müssen ihn nun umbeten.
Ich will an Sie denken.
Schau nach Golgatha!24
Schöngeistig und existentialistisch
Erik Flügge wendet sich nicht gegen die Sprache Kanaans, sondern gegen ein neueres Phänomen. Diese Art zu predigen lässt sich als Programm verstehen, welches mit einer bestimmten Wortwahl verbunden ist. Das Gesamtkonzept wird in der Predigtlehre von Wolfgang Klippert, Dozent an der Biblisch-theologischen Akademie Wiedenest, sehr treffend als »schöngeistige« Predigt umschreibt:
Der Verkündiger möchte seine Zuhörer in eine meditative Stimmung versetzen und sie mit ruhiger Stimme und getragenem Ton auf eine innere Reise mitnehmen. Die Gedanken kreisen um das Bibelwort, ohne allzu konkret zu werden. Wunderschöne, nachdenkliche Formulierungen und Anspielungen sollen in dem Hörer Bilder und Vorstellungen wecken, die ihn aus dem Alltagstrubel herausführen und ihn zu sich selbst finden lassen.25
Die Sprache dieser Art von Predigt ist der existentialistische Jargon der Gebildeten. Sie lässt sich beschreiben als »abgehoben, unpersönlich und vor allem unverbindlich«.26 Es ist erstaunlich einfach zu durchschauen, mit welchen »Techniken« hier die natürliche Alltagssprache künstlich verfremdet wird: Mit Hilfe von Wortendungen wie »-heit«, »-keit«, und »-sein« werden Verben und Adjektive substantiviert. Das beraubt die Sprache ihrer Klarheit und Lebendigkeit. Die Substantive werden dann noch möglichst im Plural verwendet, um zu verallgemeinern und zu verschleiern.
Diese existentialistische Sprache wird an der Universität nicht nur von Theologen, sondern auch von Soziologen, Philosophen, Psychologen und anderen auf geisteswissenschaftlichem Gebiet tätigen Akademikern gehegt und gepflegt. Man verbreitet einen »gepflegten Eindruck«. Man ist persönlich wenig greifbar – und damit auch wenig angreifbar. Einige Beispiele verdeutlichen, wie das Ganze dann konkret aussieht:27
Schuld wird erlebt als
das Hineingenommensein
das Gehaltensein
das Woher unseres Geworfenseins
die Vorläufigkeit
die Geschöpflichkeit
das Daß des Gekommenseins
an seinem Sosein
die schlechthinnige Abhängigkeit
das Sich-Gerufen-Wissen
die Grunderfahrung
das Betroffensein
etwas zur Sprache bringen
sich ein Stückweit mit hineinnehmen lassen
das Angenommensein
das Jetzt und Hier
die Angewiesenheit
der Erfahrungshorizont
Dieses Wort ist bereits negativ belegt; wir müssen es mit neuem Inhalt füllen.
Die Betroffenheit vom Widerfahrnis ist ja der Anfang des Weges, der zum Verstehen führt.
Eine solche geschraubte Sprache erinnert an die ironische Vision einer systematischen Schlagwort-Maschine (»The Systematic Buzz Phrase Projector«).28 Entworfen wurde sie von Phil Broughton, ein frustrierter Beamter des US-amerikanischen staatlichen Gesundheitswesens. Dieses halbautomatische Schnellformuliersystem produziert sinnlose ›Imponiervokabeln‹ mit dem Potential, die Zuhörer oder Leser zu beeindrucken oder einzuschüchtern. Durch eine beliebige Kombination dreier Ziffern lässt sich eine Vokabel zusammenstellen, welche ihre Wirkung nicht verfehlen sollte...
0. konzentrierte
1. integrierte
2. permanente
3. systematisierte
4. progressive
5. funktionelle
6. orientierte
7. synchrone
8. qualifizierte
9. ambivalente
0. Führungs-
1. Organisations-
2. Identifikations-
3. Drittgenerations-
4. Koalitions-
5. Fluktuations-
6. Übergangs-
7. Wachstums-
8. Aktions-
9. Interpretations-
0. -struktur
1. -flexibilität
2. -ebene
3. -tendenz
4. -programmierung
5. -konzeption
6. -phrase
7. -potenz
8. -problematik
9. -kontingenz
Leidige Tröster mit leerer Luft
Der leidende Hiob im Alten Testament wird von seinen drei Freunden besucht, die ihn trösten möchten. Doch im Verlauf ihrer Suche nach geistlichen Ursachen für Hiobs Leid werden ihre Worte zu einer immer stärkeren Belastung für den Geplagten. Auf die zweite Rede von Elifas hin kommt Hiob schließlich zu dem Urteil: »Ihr seid allzumal leidige Tröster!« Der Grund ist, dass sie nicht bereit sind, sich wirklich in seine Situation hineinzuversetzen: »Auch ich könnte wohl reden wie ihr, wärt ihr an meiner Stelle.« Statt wahren Trost bieten sie ihm – so wörtlich – nur »windige Worte« ohne Wirkung (vgl. Dtn 32,47), leere Luft: »Wollen die leeren Worte kein Ende haben?« Ironisch merkt er an, dass wohl eine innere ›Reizung‹ in der Magengegend den Elifas dazu gebracht haben muss, seinen Mund zu öffnen, denn zu sagen hat er nichts: »Oder was reizt dich, so zu reden?« (Hiob 16,2-4).29
Auch das Neue Testament kennt in Zusammenhang mit dem Reden eine Luft-Metapher. Wenn Paulus von »Aufgeblasenen« redet, kann man sich einen Ballon vorstellen, der mit heißer Luft gefüllt ist. Gemeint ist dabei weniger die Wirkungslosigkeit, sondern der Stolz der Rede.30 Der Jargon der Betroffenheit lässt sich als Versuch deuten, den eigenen Worten einen niveauvollen und akademischen Anstrich zu verleihen. Es wäre sicherlich nicht gerecht, bei einer hochtrabenden Sprache pauschal Motive wie Stolz und Eitelkeit zu unterstellen. In dem überwiegenden Teil der Fälle wird den Ausschlag wohl eher die Furcht geben, mit einer natürlichen, griffigen und ungeschützten Sprache bei den Akademikern unter den Zuhörern einen beschränkten Eindruck zu hinterlassen. Dennoch ist der Preis dafür zu hoch. Denn dieses Gut-dastehen-wollen ist ein Verrat am einfachen Predigthörer.31
Wir sind alle Siebenjährige
Eine akademische Sprache und intellektuelle Ambitionen sind aus einem weiteren Grund problematisch. Der schwedische Literaturwissenschaftler Göran Hägg verweist auf die Regel der amerikanischen Werbeindustrie, dass man den Verstand eines Siebenjährigen ansprechen muss, um von allen verstanden zu werden:
»Man kann das auch so ausdrücken, daß, wenn eine Masse wie ein Individuum mit einer Art eigenem Bewußtsein auftritt, dieses Bewußtsein dann auf dem niedrigsten gemeinsamen intellektuellen Niveau liegen wird. Der kleinste gemeinsame Nenner, sozusagen. [..]
Was Sie auch immer glauben mögen, es versteht nicht einmal ein Publikum aus Professoren mehr als einen kleinen Teil von dem, was Sie sagen. Es ist fast unmöglich, das Auffassungsvermögen von Menschen zu unterschätzen.«32
Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Zuhörer herablassend, therapeutisch oder pädagogisch behandeln lassen. Siebenjährige sind ein äußerst anspruchsvolles Publikum. Sie verachten Erwachsene, die sich auf ihr Niveau ›herablassen‹.33
»Die Leute verstehen nicht einmal die Hälfte von dem, was Sie sagen. Und sie vergessen gleich wieder, was Sie gesagt haben. Aber gleichzeitig verstehen sie doch ziemlich oft, was Sie sagen wollten. Worauf Sie hinaus wollten.«34
Was für Motive es auch sein mögen – die Zuhörer werden merken, wenn es mir um etwas anderes geht als darum, eine Botschaft zu vermitteln. Wer in der Kirche seine eigene Gelehrigkeit beweisen will, verhindert Kommunikation und hinterlässt bei der breiten Masse einen fragwürdigen Eindruck.
Nachahmer des großen Theologen Dr. Silberzunge
Wer sich hinter Worten versteckt, hat meist auch etwas zu verbergen. Flügge fordert: »Sprecht doch einfach über Gott, wie ihr beim Bier sprecht. Dann ist das vielleicht noch nicht modern, aber immerhin mal wieder menschlich, nah und nicht zuletzt verständlich.«35 Die Idee ist nicht neu.
Schon der Kirchenvater Augustinus (354-430) – ein ausgebildeter Rhetoriker – untersucht den Sprachstil verschiedener Bibeltexte36 und stellt dabei fest, dass die Evangelien einen ›niederen‹ Sprachstil pflegen, obwohl sie von den ›höchsten Dingen‹ reden. Offensichtlich ist dies kein Widerspruch. Der Marburger Literaturwissenschaftler Erich Auerbach führt dies auf den Gedanken der Inkarnation zurück: Gott wird Mensch in Jesus, das »paßte weder zum Stil der erhabenen Beredsamkeit noch zu dem der Tragödie oder des großen Epos.«37
Martin Luther rät in Bezug auf die Bibelübersetzung:
man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den einfachen Mann auf dem Markt danach fragen, und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden, und danach übersetzen, so verstehen sie es denn, und merken, daß man deutsch mit ihnen redet.38
Charles Haddon Spurgeon (1834-92), einer der größten Prediger des 19. Jahrhunderts, bemühte sich im »Pastor’s College« (heute: »Spurgeon’s College«, London) um die Ausbildung von jungen Predigern. 28 seiner Vorlesungen wurden in dem vierbändigen Werk Lectures to my Students (1875-1905) gedruckt, 21 sind in Ratschläge für Prediger auf Deutsch übersetzt worden (1920). Eindringlich warnt Spurgeon seine Schüler vor dem »affektierten Kanzelton«, erkünstelter Rede und falschem Ton:39
Sprecht mit eurer natürlichen Stimme. Seid keine Affen oder Papageien, sondern Männer, die in allen Dingen ihre eigene, persönliche Art haben. [..] Der Schauspieler gehört ins Theater [..]. Wenn ich fürchtete, ihr könntet die Regel vergessen, würde ich sie euch bis zum Überdruß wiederholen: Seid natürlich, seid natürlich, seid natürlich! Eine unnatürliche Stimme, die Nachahmung des großen Theologen Dr. Silberzunge oder auch eines geliebten Lehrers, wird euch unfehlbar Verderben bringen. Weg mit aller knechtischen Nachahmung! Erhebt euch zu männlicher Selbständigkeit.40
Voraussetzung für einen natürlichen Predigtstil
Spurgeon deutet an, dass Echtheit grundlegend mit Charakter und Persönlichkeit zu tun hat. Eine zweifache Voraussetzung muss gegeben sein, damit der Prediger echt sein kann. Er muss wissen: ich bin hier wirklich die richtige Person! Und: ich habe wirklich etwas zu sagen!
Für seine Berufung und für seine Botschaft hat er den Blick unabwendbar auf Gott gerichtet.41 Gott hat ihn als Person bevollmächtigt und sendet ihn, um das Evangelium zu predigen. Gott hat sein Wort gegeben, eine Botschaft, die er verstanden hat und weitergeben möchte. Ein dritter Faktor wiegt hier noch schwerer. Über Berufung und Botschaft steht das Wissen um Gottes Gegenwart und Wirken am Hörer während der Predigt.42
Doch wie steht es um den vierten Faktor der Rhetorik?Muss der Prediger sich nicht auch seiner eigenen rhetorischen Fähigkeit