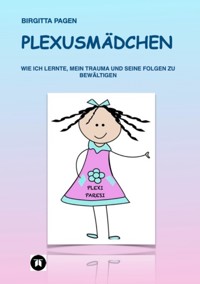
5,99 €
Mehr erfahren.
Bei ihrer schwierigen Geburt erleidet die Autorin durch eine Überdehnung des Plexusnervs eine erhebliche Verletzung des rechten Armes. Was sie zunächst nicht stört, wird im Laufe ihres Lebens zum Desaster: Sie entwickelt schwere Begleit- und Folgeerkrankungen, die vor allem psychischer Natur sind. Als sie sich Hilfe sucht, ist keine Fachkraft dazu in der Lage. Mit der Entdeckung ihrer Hochsensibilität vor wenigen Jahren setzt sich ein Stein ins Rollen. Diese wahre Geschichte erzählt, wie sie sich eigenständig und zielstrebig von allen Lasten befreit hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Birgitta Pagen
Plexusmädchen
Birgitta Pagen
Plexusmädchen
Wie ich lernte, mein Trauma und Seine Folgen zu bewältigen
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Vorwort
1 Wie alles begann
2 Schwimmen
3 Tabu
4 Süßkram
5 Geschichte und Deutsch
6 Beobachten
7 Klassenfahrt
8 Spiegel
9 Schämen
10 Wie die anderen sein
11 Der verhasste Arm
12 Fresssucht/Kopfschmerzen
13 Schulstrapazen
14 Klavier
15 Geliebte Ruhe
16 Schreibmaschine
17 Kurze Ärmel
18 Der heilige Süßkram
19 Zweifel an allem
20 Die ganze Wahrheit
21 Der Tanzkurs
22 Autosuggestion
23 Wer bin ich?
24 Neubeginn
25 Therapieversuche
26 Mentaltraining
27 Der Anfang der Lösung
28 Selbstliebe
29 Opfer
30 365 Sprüche
31 Träume leben
32 Rückkehr
33 Neues Leben
34 Alleinsein
35 Spaghettiträger
36 Die Suche geht weiter
37 Das Wunder
38 Achtsamkeit
39 Plexus-Recherche
40 Ein neues Körpergefühl
41 Heute
42 Klinikum der Uni Aachen
43 Rückblick
44 Fazit
Dank, Anhang und weiterführende Links:
Plexusmädchen
Cover
Titelblatt
Vorwort
Dank, Anhang und weiterführende Links:
Plexusmädchen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Vorwort
Ein Mädchen bin ich schon lange nicht mehr, doch ein Plexusmädchen werde ich immer bleiben.
Die sogenannte Kindliche Plexusparese wird bei Wikipedia so beschrieben:
»Bei der kindlichen Plexusparese, auch Geburtsassoziierte (obstetrische)
oder geburtstraumatische oder infantile Armlähmun g / Plexus brachialis Verletzung / Plexuslähmung, handelt es sich um eine Verletzung des Armnervengeflechtes (Plexus brachialis) unter der Geburt. Sie führt zu einer Störung der Armbewegung und -sensibilität unterschiedlicher Ausprägung. Je nach Anzahl der beteiligten Nervenwurzeln und der Schwere der Schädigung ist die Ausprägung der Lähmung umfangreich und langanhaltend. Bei schweren Verletzungen kommt es zu einer dauerhaften Einschränkung der Beweglichkeit des Armes, zu bleibenden Gefühlsstörungen, zu einem veränderten Wachstum der Extremität und zu einer eingeschränkten Gebrauchsfähigkeit mit sekundären psychosozialen Folgen.«
Sucht man im Internet nach diesem Thema, wird deutlich, dass man sich meistens mit Plexusschädigungen bei Kindern befasst; das ist auch von unglaublicher Wichtigkeit, wie ich später noch erläutern werde.
Es gab diese aber auch früher schon, was bedeutet, dass es entsprechend viele Erwachsene gibt, die darunter leiden, entweder, weil sie auch eine geburtsbedingte Plexusparese erfahren haben oder durch Unfälle (häufig Motorradunfälle) betroffen sind.
Daher möchte ich als Erwachsene hier meine Geschichte erzählen, die sich insofern ungewöhnlich darstellt, weil ich Dinge erfuhr, die aus heutiger Sicht undenkbar sind. Der Umgang mit meiner Körperbehinderung beziehungsweise deren Nichtbeachtung hatte für mich schlimme Folgen, für die ich mich sehr schämte und in höchstem Maße gegen mich selbst kämpfte. Als ich mich entschloss, Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen, war mir dies nicht vergönnt.
Ganze vier Mal.
Unglaublich?
Leider wahr.
Wie ich es danach eigenständig schaffte, meine Ängste, Depressionen und weitere schwere Lasten aus meinem Leben zu verbannen, zufrieden und glücklich zu werden, davon handelt diese wahre Geschichte.
Ich habe mit der Niederschrift 2017 begonnen, sie in den Folgejahren mehrmals zu verschiedenen Varianten verändert, mal als Tatsachenroman, mal als Sachbuch. Während dieser Zeit habe ich meinen Text auch Literaturagenturen und Verlagen vorgestellt, was leider erfolglos blieb. Nach jeder Ablehnung schrieb ich den Text um, weil ich dachte, er würde mit einigen Veränderungen besser ankommen.
Diese Versuche benötigten leider sehr viel Zeit, was ich durchaus verstehe; Agenturen und Verlage haben ja nicht nur ein Manuskript auf dem Tisch. Üblicherweise erhält man keinen Grund für die Ablehnung, doch eine Agentur schrieb mir zurück: »Dafür gibt es keine Zielgruppe.«
Darüber dachte ich lange nach. Es ist durchaus schwierig, eine Zielgruppe zu finden für eine Sache, die man im Vorfeld nicht wissen kann.
Eine Plexusparese ist, wie alle anderen (Unfall)-Schäden auch, nicht vorhersehbar. Dass eine Geburt auch Risiken birgt, ist hinlänglich bekannt. Allerdings bin ich der Meinung, dass man sich als schwangere Frau bewusst machen muss, dass es aus verschiedenen Gründen zu einer Kindlichen Plexusparese kommen kann; sei es durch unvorhersehbare Komplikationen bei der Geburt oder gar durch Gewalteinwirkung.
Ja, die gibt es bei Geburtsvorgängen tatsächlich, wobei es schon damit beginnt, dass die Gebärende von Hebamme, Arzt oder Pflegepersonal angeschrien wird. Das muss nicht einmal absichtlich geschehen; diese Personen stehen – aus welchem Grund auch immer - in solchen Fällen besonders unter Stress, Druck oder persönlichen Belastungen, was sich negativ auf den Geburtsvorgang auswirken und es zu unsachgemäßen Handlungen kommen kann, bei denen schlimmstenfalls das Neugeborene eine Plexusparese erleiden kann.
Manchmal sind es auch die sogenannten Kunstfehler, die dieser Erkrankung vorangehen. Inzwischen gibt es Anwälte für Geburtsrecht. Mir sind Fälle bekannt, die, ähnlich wie oben beschrieben, vorgefallen sind, und in denen Schmerzensgelder geflossen sind.
Es gibt aber auch die Fälle, wo es zu Komplikationen während der Geburt kommt, die im normalen Rahmen liegen und es einfach keine andere Möglichkeit gibt, als das Risiko einer Plexusparese einzugehen. Die ist von niemandem gewollt, es muss auch nicht immer so kommen, es kann aber so kommen – wie bei mir geschehen.
Ich bin der Meinung, dass Schwangere sich bei allen anderen Risiken auch diesem Risiko bewusst sein sollten.
Diese Dinge werden gerne ausgeblendet, doch man kann der Geburt ja nicht davonrennen. Sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, halte ich für sehr wichtig; denn natürlich freut man sich, wenn man weiß, dass im Bauch ein gesundes Kind heranwächst. Welch ein Schock ist es, wenn auf dem Weg ins Licht der Welt etwas geschieht, das das Kind sein ganzes Leben lang prägen wird?
Und selbst wenn es passiert, kann sich niemand vorstellen, welche Belastung es im weiteren Verlauf des Lebens sein kann, und wie das Kind oder die später erwachsene Person damit zurechtkommt. Heute werden solche Sachen noch eher diskutiert als damals, als es bei mir passierte.
Daher ist es mir wichtig, die Kindliche Plexusparese und insbesondere die heutigen Möglichkeiten näher zu bringen, die den betroffenen Kindern ein vielfach besseres Leben bescheren können, als es bei mir der Fall war, als diese alle noch nicht bekannt waren.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Verhältnis zu meinen Eltern nicht mit dem vergleichbar ist, was man heutzutage darunter versteht. Damals gab es viele Tabus, über die man heute sprechen würde. Rückblickend kann ich meinen Eltern nichts vorwerfen, sie wussten es nicht besser, und die seinerzeitige Gesellschaft war eine andere. Ein richtig inniges Verhältnis hätte ich mir gewünscht, doch dazu kam es nie, was daran liegen mag, dass meine Mutter zum Zeitpunkt meiner Geburt bereits siebenunddreißig Jahre alt war. Was heute kein Problem ist, war damals außergewöhnlich, auch was die Stellung der Frau in der Gesellschaft betraf.
Meine Plexusparese ist in diesem Buch das vorrangige Thema, doch auch ein weiteres betrifft mich und wird hier behandelt: die Hochsensibilität, der noch viel Aufmerksamkeit gebührt, und die für mich untrennbar mit meiner körperlichen Beeinträchtigung verbunden ist. Genaueres dazu später; ich selbst erfuhr davon auch erst vor nicht allzu langer Zeit.
Bis zur Entscheidung und der Umsetzung, meine Geschichte aufzuschreiben, und was währenddessen passierte, war es ein langer Weg voller Irrungen, Wirrungen, Scham, Angst, Mutlosigkeit, besonders Hass gegen das Leben, gegen mich selbst, bis etwas Überraschendes geschah, mit dem ich all diese Dingen abschließen konnte.
Für die Maßnahmen, die mir erfolgreich halfen, möchte ich hier eindeutig nicht werben. Eine Empfehlung, es in ähnlichen Fällen zu versuchen, möchte ich jedoch deutlich aussprechen.
Mein hochsensibles Gespür für gewisse Dinge sagt mir, dass genau diese erfolgreiche Eigenständigkeit, in eine gesunde Spur zu kommen, der wahre Grund für die erfahrenen Ablehnungen meines Manuskripts sein könnte.
Hätte ich die erhoffte professionelle Hilfe bekommen, wie sie nötig gewesen wäre – wer weiß, dann hätten Sie von diesem Buch vielleicht schon eher gehört.
Letztlich hat das Leben so entschieden, dass es war, wie hier beschrieben; auch das muss einen Grund gehabt haben.
Doch lesen Sie bitte selbst.
1 Wie alles begann
Meine Geschichte beginnt 1960, also zu einer Zeit, als Fotos noch überwiegend schwarz-weiß waren.
Die Wirtschaftswunderzeit war in vollem Gange und tauchte das Leben in einen bunten Taumel nach den grauen Jahren des Krieges, elektrische Haushaltsgeräte eroberten und erleichterten die Hausarbeit. Konrad Adenauer war Bundeskanzler; an eine Mauer dachte noch niemand, und die Medizin war noch längst nicht so entwickelt wie heute, doch wurde getan, was in besonderen Fällen nötig und möglich war.
Ich stamme also aus einer Zeit, die fast schon vergessen ist, und gebe hier meine Erinnerungen sowie damals geltende Antworten auf meine Fragen preis.
Meine Mutter erwähnte die Umstände nicht gerne, die mit Schwangerschaft oder Geburt einhergingen. In ihrer Generation schickte es sich nicht, über solche Dinge zu sprechen, auch nicht mit der eigenen Tochter. Daher waren die Informationen, die ich auf meine Fragen erhielt, entsprechend dürftig, was mich wiederum von weiteren Fragestellungen abhielt.
Als ich neun Jahre alt war, erzählte sie mir, dass sie erst im fünften Monat erfuhr, schwanger zu sein. Sie konnte es nicht weiter erklären, es war einfach so gewesen. Da ich sie nur als rundliche Frau kannte, stellte ich mir vor, dass ich mich zwischen ihren Pfunden versteckt gehalten hatte.
»Du wurdest erst nach fast zehn Monaten geboren«, sagte sie weiter, »danach bist du mit Blaulicht in ein Kinderkrankenhaus gekommen, wo du notgetauft wurdest.«
Notgetauft? Was war das? War das so schlimm gewesen? Ich traute mich nicht, nachzufragen, weil es mich gedanklich überforderte, was ich soeben erfahren hatte. Mutter hatte diese wenigen Informationen eher beiläufig ausgesprochen, sodass ich spürte, sie würde weitere Fragen nicht hören wollen. Also schwieg ich.
Dass etwas mit meinem rechten Arm nicht stimmte, interessierte mich in der Zeit vor der Schule nicht. Alles machte ich nach meinen Möglichkeiten und dachte darüber nicht im Entferntesten nach, warum auch? Ich hatte keine Schmerzen, bastelte, malte und zeichnete mit links, was für mich völlig normal war. Die rechte Hand nahm ich zu Hilfe, um beispielsweise ein Blatt Papier oder die kleinen Figuren, die ich aus Knete mit links bearbeitete, festzuhalten.
Beim Aus- und Anziehen half mir meine Mutter – also gab es keinen Grund, irgendetwas an meinen Gewohnheiten anzuzweifeln.
Kurz vor Schulbeginn sah ich mit meinen Eltern eine Quizshow im Fernsehen an, in der Menschen um Geld spielten, das am Ende der Aktion Sorgenkind zugutekommen sollte. Dabei kam mir etwas seltsam vor: Es wurden kurze Filme eingespielt von Kindern, die teilweise an Krücken gingen, im Rollstuhl saßen, oder deren Hände an den Schultern angewachsen waren, sie hatten gar keine Arme. So etwas hatte ich noch nie gesehen; diese Bilder berührten mich auf seltsame Weise. Die Kinder taten mir so sehr leid, dass ich fast weinen musste. Da erst fiel mir die Ähnlichkeit dieser Kinder zu mir auf. Ich hatte zwar zwei Arme und Hände, aber der rechte Arm war kürzer als der linke. Er war dazu nicht so stark, sodass ich fast alles mit der linken Hand machte, was für mich normal war. Nun hatte ich gesehen, dass es nicht normal war. Normal waren zwei gleich lange Arme, die beide gleich funktionsfähig waren.
Ohne viel nachzudenken, drehte ich mich zu meiner Mutter um und fragte: »Mama, bin ich auch ein Sorgenkind?« Sie erschrak leicht und fragte zurück: »Warum meinst du das?«
Ich zeigte mit meiner linken Hand auf den rechten Arm und sagte: »Darum.«
Entschieden wehrte sie das ab und meinte: »Nein, du bist kein Sorgenkind.«
Das verstand ich nicht, immerhin hatte ich doch gerade die Filme gesehen von den armen Kindern. So bohrte ich weiter: »Aber, was ist das denn?«
Ihrer Miene nach schien sie zu überlegen, dann antwortete sie: »Du wurdest bei der Geburt verletzt, darum ist der Arm gelähmt. Mehr weiß ich auch nicht.« Sie unterstützte ihre Antwort mit einem Schulterzucken.
Mit diesen Informationen konnte ich nicht viel anfangen, gerne hätte ich weiter gefragt, aber Mutter wusste ja nicht mehr.
Zumindest wusste ich nun, was gelähmt bedeutete.
Bisher ging ich in den Kindergarten, wo mir der Unterschied nicht aufgefallen war, offenbar den anderen Kindern auch nicht, denn es hatte nie irgendein anderes Kind dazu etwas gesagt. Doch dachte ich seither oft darüber nach, wie es mit einem nicht gelähmten rechten Arm gewesen wäre, wenn ich meinen Lieblingsbeschäftigungen, dem Malen, Zeichnen, und dem Ausschneiden von Dingen aus einem abgelaufenen Katalog, nachging. Vorstellen konnte ich es mir nicht; schließlich kannte ich es ja nicht anders, und für mich war alles gut so.
Nach den Ferien sollte ich in die Schule kommen. Die wurde mir schon dadurch zuwider, dass Mutter mich Wochen zuvor zum Frisörsalon schleppte, wo mir mein wunderschön glänzendes und bis zur Hüfte reichendes Haar abgeschnitten wurde, weil sie es aufgrund der vielen Knoten und meinem damit verbundenen Geschrei nicht mehr bürsten wollte.
So kam ich mit einem Haarschnitt heim, den üblicherweise Jungs trugen. Ich war zutiefst traurig und weinte viel, wenn ich allein war. Die schönen Zeiten, die ich auf Mutters Schoß verbrachte, das wunderbare Gefühl, von ihr die Haare geflochten und den Nacken massiert zu bekommen, war auf einmal Vergangenheit. Zum ersten Mal blickte ich bewusst in einen Spiegel und war erschüttert von dem, was ich sah: Ein Kind mit traurigem Blick und kurzen Haaren, was unmöglich aussah und mein abstehendes linkes Ohr zum Blickfang machte, dazu zwei Arme, die ungleich herunterhingen – so sollte ich in die Schule gehen und mich anderen Kindern zeigen? Die würden mich sicher auslachen, war ich überzeugt. Ich begann, Spiegel, Glastüren oder Schaufenster zu hassen und beschloss, nicht mehr hineinzuschauen, weil es sehr schlimm war, mich dort sehen zu müssen.
Mutter bekam diese Situation mit und sah meine Tränen. »Warum heulst du denn? Du siehst doch gut aus? Ein richtig schickes Mädchen.«
Ein Mädchen? Wie konnte sie so etwas sagen? Mädchen trugen lange Zöpfe und keine so kurzen Haare. So richtig hatte ich das abstehende Ohr vorher noch nie gesehen. Ich fragte Mutter, warum das so war. Sie antwortete: »Als du noch ganz klein warst, hast du viel auf der linken Seite gelegen, da hat sich das verdreht.« Nun bei dem Haarschnitt war es nicht mehr zu übersehen. Es war schlimm. Sah sie denn nicht, was ich sah? Warum verstand sie mich nicht?
Ich ersparte mir weitere Worte und rannte zu meinen Teddys, die ich über alles liebte. In meiner Fantasie lebten sie und sprachen mit mir. Ihnen war es egal, welchen Haarschnitt ich trug. Puppen mochte ich nie, was meine Mutter nicht verstand. Sie meinte, ich müsse doch Spaß daran haben, ihnen verschiedene Kleider anzuziehen und nähte zu Weihnachten heimlich Puppenkleidung – natürlich ohne mein Wissen. Aber meine plüschigen Freunde waren mir lieber. Sie zeigten mir bereits früh stellvertretend meine unerschütterliche Liebe zu Tieren.
Als Mutter sah, dass ich mich nicht beruhigte und immerzu über diesen blöden Haarschnitt schimpfte, meinte sie: »Komm, nimm ein Schokolädchen als Trostpflästerchen, dann ist es bald wieder gut.«
Das machte ich, doch mein Leid wurde dadurch nicht besser, die Haare waren deshalb nicht wieder da. Aber ich kam auf den Geschmack. Das war so lecker, und wenn diese cremige Schokolade in meinem Mund schmolz - es war ein noch nie dagewesener und unvergleichlicher Wohlfühlmomentsgenuss; ein Geschmack, an den ich mein Herz verlor, wie man heute sagen würde.
Meine Mutter merkte es und bescherte mir seither ganz viele Wohlfühlmomente, wenn sie mir vom Einkaufen die verschiedensten Schokoladensorten und Kartoffelchips mitbrachte, die mein Herz ebenso höher springen ließen. Bei Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken waren zudem die feinsten Pralinen in allen möglichen Varianten üblich.
Um mich daran zu bedienen, brauchte ich nicht zu fragen; es war immer von allem da, wenn ich Verlangen danach spürte.
2 Schwimmen
Ich malte und zeichnete gerne, oder schnitt Dinge aus einem abgelaufenen Versandhauskatalog aus, um sie in neuer Konstellation auf ein Papier zu kleben. Das machte mir viel Spaß. So formte ich eine neue Welt, förderte auf alle Fälle meine Kreativität.
Meine Art, dies zu tun, gefiel meinem Vater nicht, denn er maßregelte mich oft, doch die rechte Hand dafür benutzen zu müssen, weil sie die schönere Hand sei. Das verstand ich nicht. Meine linke Hand war schöner, schon allein, weil die all das konnte, was mit der rechten nicht möglich war. Außerdem sah der hübsche Ring aus dem Kaugummiautomaten an der linken Hand viel besser aus als an der rechten, weil die Finger etwas dünner waren. Warum sollte ich nun die Schere mit rechts halten, obwohl das nicht ging? Sah er das denn nicht? Um es ihm zu beweisen, steckte ich die Finger der rechten Hand durch die Löcher der Schere, konnte aber die nötige Kraft sowie die ideale Haltung nicht aufbringen, auch wenn ich mich noch so sehr anstrengte. Dabei erst fiel mir richtig auf, wie unbeweglich das rechte Handgelenk war.
»Du musst das nur üben«, sagte Vater, »üben, üben, üben. Dann kannst du das.«
Als er mich wieder alleinließ, wechselte ich die Schere in die linke Hand und fuhr wie gewohnt mit meiner Bastelei fort. Nein, wusste ich, ich würde das nicht üben, weil mir klar war, dass es nicht ging; er hingegen konnte das nicht wissen, weil er zwei normal funktionierende Hände hatte. Genauso hielt Vater es hinsichtlich der bevorstehenden Schule. Wenn ich dort Schreiben lernen würde, müsse ich auf jeden Fall mit rechts schreiben, weil die rechte Hand die schönere sei. Das sah ich anders. Aber mein Vater ließ auch hier keine Ausreden zu. So übte ich, mit der rechten Hand einen Stift zu halten und zu schreiben. Es ging, doch nach kurzer Zeit ging nichts mehr. Das Handgelenk fühlte sich steif an. Ich musste danach die Hand ein paar Mal auf und ab bewegen, dann konnte ich weitermachen.
Meine Eltern kamen aus einer Zeit, wo man einfach das machte, was sein musste, und es so zu machen war, wie es schon immer gemacht wurde. Da fragte niemand nach, warum. Alles wurde immer so gemacht, ohne nachzufragen. Alles im Leben wurde mir so vermittelt. Doch in mir war von Anfang an ein Widerstand, mit dem ich als Kind nicht weiterkam, schon allein wegen dieses kurzen Arms. Vielleicht würde sich etwas ändern, wenn ich erwachsen war, dachte ich. Ich wollte ganz viel anders machen, als man es nun von mir forderte, das war mir bereits klar, doch der blöde Arm würde bleiben.
Mit der Zeit gewöhnte ich mich daran, einen Stift in der rechten Hand zu halten, doch so gut fühlte es sich nicht an.
Ich hasste es, etwas tun zu MÜSSEN. Da hörte ich noch später immer wieder den Druck meiner Eltern. Ich wollte lieber das tun, was ich WOLLTE. Das jedoch war zu dieser Zeit keine Option. »Was sollen denn die Leute denken?«, war der Lieblingssatz meiner Mutter, ganz gleich, ob es um die Pflege des Gartens, um Hausarbeiten oder eben um das Ansehen ging, das so zu sein hatte, dass niemand etwas darüber sagen konnte; das bezog auch mich mit ein.
Schämten sie sich etwa wegen mir und des kurzen Arms? Dafür aber konnte ich doch nichts? Ich fragte nicht nach, und sie sagten dazu auch nichts, es war nur so ein unbehagliches Gefühl.
So war ich auf die Schule vorbereitet, wo ich Schreiben mit einem Griffel auf eine Schiefertafel lernte. Außerdem wollte ich nicht aus der Reihe tanzen, so machte ich es, wie es gefordert wurde, wobei es mich sehr störte, dass der Stift nicht sanft, wie ein Kugelschreiber auf Papier, sondern hart, holprig und manchmal quietschend über den Untergrund fuhr. Schrecklich. Erwartungsgemäß war das Schreibergebnis genauso schrecklich. Und nach einer halb vollgekritzelten Reihe versteifte sich das rechte Handgelenk wie gewohnt, dass es sogar leicht wehtat. Ich bewegte daraufhin reflexartig die Hand auf und ab, bis es leicht knackte.
Zu Hause hatte ich mit einem Bleistift auf Papier geübt; das war mir leichter gefallen. Erst im zweiten Schuljahr schrieb ich mit einem Füller in ein Heft. Von der Technik her war es viel angenehmer als der Griffel, doch meine Schrift war auch in den weiteren Schuljahren nicht als Schönschrift zu bezeichnen. Es fing stets relativ leserlich an, doch mit der Zeit wurden die Buchstaben krakeliger, weil es die komplette Hand anstrengte und sich mein Handgelenk immer bald versteifte, wie bereits vorher oft geschehen.
Mit links zu schreiben, wie es heute akzeptiert wird, war damals keine Option.
Im fünften Schuljahr war ein Mädchen in meiner Klasse, das mit links schrieb, und ich fragte mich, warum ich das nicht auch gedurft hatte. Um nun noch zu wechseln, war es zu spät; ich hätte es erst mit links neu lernen müssen.
Zurück zu meinen schulischen Anfängen. Da erfuhr ich den ersten Schwimmunterricht, der den Grundstein für meine persönliche Katastrophe setzte.
Mit der ersten Schwimmstunde hielten Hänseleien Einzug in mein Leben. Heute würde man das als Mobbing bezeichnen. Doch, was haben Kinder mit Mobbing am Hut? Wir alle wissen, wie direkt und verletzend sie sein können.
Genau das musste ich erfahren, als die Lehrerin uns nach den Trockenübungen am Beckenrand ins Wasser schickte. Diese Übungen hatte ich nur mit dem linken Arm durchführen können, was sie nicht registriert hatte. Ich hatte gleich gemerkt, dass ich nicht schwimmen können würde, und machte mir schon die vielfältigsten Gedanken, wie ich das erklären sollte.
Alle sprangen ins Wasser, außer mir. Ich hatte Angst, weil ich etwas nicht so konnte wie die anderen, und vor der riesigen Menge an Wasser, das mir zu viel war und eklig nach Chlor stank.
»Na los, spring rein«, forderte die Lehrerin mich auf.
Ich begann zu weinen. »Ich kann das mit dem Arm doch nicht«, schluchzte ich.
»Unsinn. Natürlich kannst du das«, beharrte sie.
Bevor ich mich weiter zur Wehr setzen und Worte der Erklärung finden konnte, hörte ich die anderen Kinder lachen und spürte plötzlich einen Stoß im Rücken, woraufhin ich nach vorne fiel und im Wasser landete.
Alles wurde schwarz um mich herum. Echte Todesangst durchflutete mich. Ich stellte mir vor, dass dies das Sterben war, von dem ich schon mal gehört hatte. Ich strampelte panisch mit den Beinen, schluckte dabei das ekelhafte Wasser. Es war der schlimmste Moment in meinem bisherigen Leben.
Glücklicherweise spürte ich auf einmal wieder den Boden unter meinen Füßen, konnte stehen. Schwer atmend und noch immer weinend musste ich erst einmal realisieren, was mir da passiert war.
Ich lebte also noch.
Und die Kinder lachten noch immer.
»So«, hörte ich die Lehrerin rufen, »und jetzt mach die Übungen von vorhin.«
Ich war entsetzt. Was hatte sie an meiner Erklärung nicht verstanden? War ich immer dazu verdammt, meine Unfähigkeit unter Beweis zu stellen? Na gut, dachte ich, soll sie sehen, dass ich nicht gelogen hatte, und versuchte es. Was nicht funktionierte, wusste ich vorher: Der rechte Arm ließ sich nicht anheben, er hing samt der Schulter und dem halben Kopf unter Wasser. So nützten mir die Schwimmübungen mit dem linken Arm rein gar nichts.
»Es geht nicht«, rief ich und watete unter Tränen zum Ausgang, ohne eine Antwort von ihr abzuwarten. Sollte man mich doch auslachen, ich war so wütend, dass ich es bewusst überhörte. Danach erzählte ich der Lehrerin, Schmerzen am Bein zu haben, da durfte ich mich bis zum Ende des Unterrichts auf die Bank setzen.
Das war so ein furchtbares Erlebnis, das mich prägte. Doch dem nicht genug. Ich erfand jede Woche neue Schmerzen, um nicht nochmal so sinnlos ins Wasser zu müssen.
Dabei vergaß ich, dass mein viele Jahre älterer Bruder an der Grundschule als Musiklehrer tätig war. Die Sportlehrerin wusste es und verpetzte mich.
So erfuhren es dann meine Eltern.
Die hatten tatsächlich kein Verständnis für mich. Über meinen kurzen Arm wurde nie gesprochen; der tat ja nicht weh. Ich sollte funktionieren, eine gute Schülerin sein und gute Noten nach Hause bringen, egal in welchem Fach, am besten in jedem. Wie oft hatte ich mir anhören müssen, dass sie beide die Möglichkeit nicht hatten und zur damaligen Zeit nur Lesen, Schreiben und Rechnen lernen konnten.
Das nützte mir wenig, denn ich verstand nicht, wofür ich überhaupt Schwimmen lernen sollte, wo es mir sowieso nicht möglich war.
Nach einer Woche des Überlegens stellte meine Mutter mir doch eine Befreiung für den Schwimmunterricht aus. Es war eine große Erleichterung für mich, denn wie schlimm ich mich gefühlt hatte, als man mich zum Gespött gemacht hatte, hatte ich für mich behalten; es war mir zu peinlich, es zu erwähnen. Auch hätten meine Eltern es nicht verstanden, das wusste ich, wenn Mutter schon so lange brauchte, um mir den befreienden Zettel auszustellen.
Man kann darüber denken, was man will. Heute werden Kinder mit körperlicher Einschränkung individuell geschult und gefördert. Das war zu meiner Zeit kein Thema. Ich war ja nicht geistig behindert, Arme und Beine hatte ich auch, also konnte ich eine normale Schule besuchen, was theoretisch eine gute Sache war, eine andere Möglichkeit hätte es auch nicht gegeben.
Ich hatte doch zwei Arme, warum machte ich dann nicht alles mit? Das war wohl – wenn überhaupt - die einzige Frage, die sich die anderen stellten, bevor sie entschieden, mich auszulachen. Niemand fragte sich, wie es mir dabei ging, nicht einmal meine Eltern. Niemand kam auf die Idee, sich vorzustellen, wie verletzt und bloßgestellt ich mich fühlte.
Vor dieser Sache hatte ich mich von meinem Arm nicht beeinträchtigt gefühlt. Danach änderte sich das.
Es war ja nicht nur, dass ich nicht schwimmen konnte. Das Anziehen danach war auch nicht besser, denn auf feuchter Haut rutscht die Kleidung nun mal nicht gut. Eine neue und fremde Erfahrung für mich, denn daheim half mir meine Mutter nach dem Baden, in den Schlafanzug zu schlüpfen.
Ich fühlte mich extrem blamiert, als ich eine Mitschülerin um Hilfe bitten musste, weil mein Pullover an meinen Schulterblättern hing und ich ihn nicht heruntergezogen bekam. Ich hatte so leise wie möglich gefragt, und doch hatten es andere mitbekommen und kicherten hinter vorgehaltenen Händen.
Heute bin ich in der Lage, meine Kleidung meiner Einschränkung anzupassen; sie muss entsprechend weit sein. Kleidung, die über Kopf anzuziehen ist, ist schwierig und bei mir selten. Des Weiteren vermeide ich, dass Stoff auf Stoff liegt, also lange Ärmel eines Pullovers und darüber eine ungefütterte Jacke, weil es einfach nicht rutscht. Während andere sich in diesem Fall mit beiden Händen auf dem Rücken behelfen und die Arme aus den Ärmeln ziehen können, ist mir das nicht möglich. Daher achte ich bei Jacken darauf, dass die Ärmel mit Futterstoff ausgestattet sind, oder ich darunter etwas Kurzärmeliges trage, um dieser Problematik aus dem Weg zu gehen.
3 Tabu





























