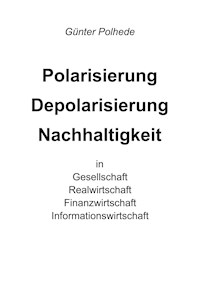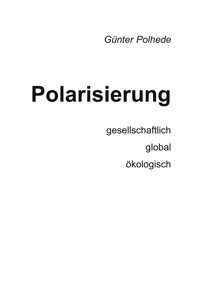
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch beleuchtet polarisierend wirkende Einflüsse, deren Folgen und mögliche Minderungen. Es werden verschiedene Erscheinungsformen von Polarisierung behandelt. Sie zeigen sich zwischen: - Überfluss und Hunger - Reichtum und Armut - genügend und nicht mehr ausreichenden Ressourcen wie Rohstoffe, Energie und Umwelt. Im Vorlauf zur Betrachtung zentraler Begriffe der Polarisierung ist eine erste Entwicklungsstufe der Polarisierung zu erläutern. Sie ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass Menschen oft unterschiedliche Einkommen erhalten. So entsteht für Menschen mit geringeren Einkommen ein Anreiz, höhere Einkommen zu erzielen. Dadurch kann die Realwirtschaft Wachstum erfahren. Weitergehend werden verschiedene Varianten von Polarisierung aufgezeigt und Polarisierung mit ihren Beziehungen zu anderen Begriffen. - Gesellschaftliche Polarisierung: Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass Einkommen und Vermögen von Bevölkerungsteilen so weit auseinanderdriften, dass mangelhafte Ernährung und Überfluss bzw. Armut und Reichtum entstehen können. - Globale Polarisierung zwischen Ländern - Ökologische Polarisierung: Sie kann sich zwischen den Zeitpunkten noch ausreichender bzw. schon zu geringer Ressourcenvorräte bei Rohstoffen, Energie und Umwelt zeigen. - Polarisierung und ihre Beziehung zur Demokratie - Polarisierung und ihre Beziehung zum Ressourcenvorrat - Polarisierung und ihre Beziehung zu autoritärer Führung - Polarisierungsmindernde Aktivitäten: Diese finden im Rahmen der Polarisierung oft in nicht ausreichendem Umfang statt. Das rührt daher, dass viele reiche Staaten die von ihnen mitverursachten Polarisierungsfolgen wie Hunger und Armut mit Hilfe von Meeren, Zäunen und Mauern aussperren können und sich für sie eine direkte Polarisierungsbekämpfung somit teilweise erübrigt. Weitergehend profitieren reiche Staaten von der Armut anderer Länder, weil letztere relativ wenig Ressourcen verbrauchen können und sich so der Ressourcen-Verbrauchshorizont reicher Länder vergrößert. Eine Sonderstellung nehmen Klima und Meere ein, weil deren Verbrauchs- und Verschmutzungsfolgen Grenzen weitgehend ignorieren. In diesem Zusammenhang vollzieht sich eventuell kontinuierlich eine Umweltschädigung, begleitet durch ökonomische, technische und militante Konstellationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
In diesem Buch werden verschiedene Erscheinungsformen von Polarisierung behandelt. Sie zeigen sich zwischen:
Überfluss und Hunger
Reichtum und Armut
genügend und nicht mehr ausreichenden Ressourcen wie Rohstoffe, Energie und Umwelt.
Im Vorlauf zur Betrachtung zentraler Begriffe der Polarisierung ist eine erste Entwicklungsstufe der Polarisierung zu erläutern. Sie ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass Menschen oft unterschiedliche Einkommen erhalten. So entsteht für Menschen mit geringeren Einkommen ein Anreiz, höhere Einkommen zu erzielen. Dadurch kann die Realwirtschaft Wachstum erfahren. Weitergehend werden verschiedene Varianten von Polarisierung aufgezeigt und Polarisierung mit ihren Beziehungen zu anderen Begriffen.
Gesellschaftliche Polarisierung ist dadurch gekennzeichnet, dass Einkommen und Vermögen von Bevölkerungsteilen so weit auseinanderdriften, dass mangelhafte Ernährung und Überfluss bzw. Armut und Reichtum entstehen können. Angetrieben wird eine solche Entwicklung durch zu starke asymmetrische und somit auch prozentuale Verteilung von Wachstumserfolgen.
Globale Polarisierung zeigt sich zwischen Ländern. Unterschiede zwischen ihnen werden u. a. durch zu große Leistungsbilanzunterschiede hervorgerufen.
Ökologische Polarisierung kann sich zwischen den Zeitpunkten noch ausreichender bzw. schon zu geringer Ressourcenvorräte bei Rohstoffen, Energie und Umwelt zeigen.
Polarisierung und ihre Beziehung zur Demokratie: Es gibt Vorgehensweisen, die innerhalb demokratischer Staatsformen auf realwirtschaftlich begründete Zufriedenheit der beteiligten Menschen setzen und auf deren Zukunftssicherung durch Nachhaltigkeit. Mit folgenden Vorgehensweisen soll Polarisierung gemindert werden: Begrenzung existenzieller Unterschiede, Recycling, Bereitstellung regenerativer Energie und Umweltschutz.
Polarisierung und ihre Beziehung zum Ressourcenvorrat: Viele Menschen, die geringe Entgelte für ihre Produkte bzw. geringe Einkommen erhalten, bleiben eher arm. Sie können den Ressourcenvorrat somit nur wenig schmälern. Für die reicheren Menschen halten die Ressourcen dann länger vor. Diese Menschen profitieren von Polarisierung.
Polarisierung und ihre Beziehung zu autoritärer Führung: Manche Staaten orientieren sich in Richtung autoritärer Führung, wenn sich eine Polarisierung zwischen eher ärmeren und eher reicheren Menschen zeigt. Das kann wie folgt ablaufen: Beim Auftreten negativer Polarisierungsfolgen bei den ärmeren Menschen versuchen die Vorteilsnehmer logischerweise, mit Hilfe autoritärer Führung Stabilität zu gewährleisten.
Polarisierungsmindernde Aktivitäten finden im Rahmen der Polarisierung oft in nicht ausreichendem Umfang statt. Das rührt daher, dass viele reiche Staaten von ihnen mitverursachten Polarisierungsfolgen wie Hunger und Armut mit Hilfe von Meeren, Zäunen und Mauern aussperren können und sich für sie eine direkte Polarisierungsbekämpfung somit teilweise erübrigt. Weitergehend profitieren reiche Staaten von der Armut anderer Länder, weil letztere relativ wenig Ressourcen verbrauchen können und sich so der Ressourcen-Verbrauchshorizont reicher Länder vergrößert. Eine Sonderstellung nehmen Klima und Meere ein, weil deren Verbrauchs- und Verschmutzungsfolgen Grenzen weitgehend ignorieren. In diesem Zusammenhang vollzieht sich eventuell kontinuierlich eine Umweltschädigung, begleitet durch ökonomische, technische und militante Konstellationen.
Dieses Buch beleuchtet polarisierend wirkende Einflüsse, deren Folgen und mögliche Minderungen.
Inhaltsverzeichnis
A Überblick
A 1 Überblick - Roter Faden
A 2 Überblick - Alle Individuen befinden sich auf einer globalen Treppe des Wettbewerbs - u. a. zwischen Hunger und Überfluss
A 3 Überblick - Vom Individuum zur Sicherung von Ressourcen
A 4 Überblick – Von Idealen bis zum Einfluss gegen Folgen von Polarisierung
B Güter, Geld und Tauschbeziehungen
B 1 Finanzielle Mittel und Tauschbeziehungen
B 2 Qualitative Güter und Tauschbeziehungen
B 3 Quantitative Güter und Tauschbeziehungen
B 4 Das Zusammenwirken quantitativer und qualitativer Güter
B 5 Zusammenfassung: Güter und Tauschbeziehungen
C Treiber der quantitativen Realwirtschaft
C 1 Zentraler realwirtschaftlicher Treiber: Bedarfsbefriedigung mit quantitativen Gütern
C 2 Direkter realwirtschaftlicher Treiber: Arbeitskräfte
C 3 Direkter realwirtschaftlicher Treiber: Überschuss in der Leistungsbilanz
C 4 Indirekter realwirtschaftlicher Treiber: Güterverschwendung
C 5 Begleitender realwirtschaftlicher Treiber: Ressourcenverbrauch
C 6 Realwirtschaftlicher Treiber auf höherer Versorgungsstufe: Innovative Produkte
C 7 Realwirtschaftliche Treiber auf höherer Versorgungsstufe: Statussymbole und Statusgüter
C 8 Realwirtschaftliche Treiber: Umweltschutz, Verwendung erneuerbarer Energie und Recycling
C 9 Wachstumsbegleitender realwirtschaftlicher Treiber: Investitionen
C 10 Zeitverzögerter realwirtschaftlicher Treiber: Bildung
C 11 Ausgleichende realwirtschaftliche Treiber: Ersparnisse und Kredite
C 12 Eher wachstumsneutraler realwirtschaftlicher Treiber: Umverteilung zwecks Erfüllung staatlicher Gemeinschaftsaufgaben
C 13 Zusammenfassung: Quantitative Realwirtschaft und ihr Wachstum mit Hilfe realwirtschaftlicher Treiber
D Realwirtschaft und ihre Mitspieler
D 1 Quantitatives realwirtschaftliches Wachstum und Geldwertstabilität
D 2 Quantitatives realwirtschaftliches Wachstum und qualitatives Wachstum
D 3 Quantitatives realwirtschaftliches Wachstum, Stabilität und Demokratie
D 4 Tauschbeziehungen mit qualitativen Gütern - Stabilität von Tauschgesellschaften
D 5 Zusammenfassung: Realwirtschaft und ihre Mitspieler
E Grenzen der realwirtschaftlichen Treiber bei quantitativem realwirtschaftlichem Wachstum
E 1 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „quantitative Güter“
E 2 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Arbeitskräftebedarf“
E 3 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Leistungsbilanzüberschuss“
E 4 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Güterverschwendung“
E 5 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Ressourcenverbrauch“
E 6 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Innovative Produkte“
E 7 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Statusgewinn“
E 8 Grenzen der realwirtschaftlichen Treiber: Umweltschutz, Einsatz erneuerbarer Energie und Recycling
E 9 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Investitionen“
E 10 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Bildung“
E 11 Grenzen der realwirtschaftlichen Treiber: Ersparnisse, Kredite und direkt an Unternehmen vergebenes Geld
E 12 Grenzen des realwirtschaftlichen Treibers „Umverteilung zur Erfüllung staatlicher Gemeinschaftsaufgaben“
E 13 Zusammenfassung: Grenzen der Wirksamkeit realwirtschaftlicher Treiber
F Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit realwirtschaftlicher Treiber
F 1 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „quantitative Güter“
F 2 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Arbeitskräfte“
F 2.1 Gering bezahlte Tätigkeiten
F 2.2 Gering bezahlte Qualifikationen
F 2.3 Individuelles Verhalten und gesellschaftliche Entwicklung
F 2.4 Ehrenamtliche Arbeit
F 2.5 Die Verunglimpfung von falsch Qualifizierten
F 3 Beeinflussungen von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Leistungsbilanzüberschuss“ durch Exportsicherung
F 4 „Gutes tun“ als Marketingstrategie gegen Güterverschwendung, die aber auch ein realwirtschaftlicher Treiber ist
F 5 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Ressourcenverbrauch“
F 6 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „innovative Produkte“
F 7 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Statusgewinn“
F 8 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit der realwirtschaftlichen Treiber: Umweltschutz, Einsatz erneuerbarer Energie und Recycling
F 8.1 Auflösen individueller Dilemmas durch Bildung von Meinungspools
F 8.2 Unterschiedliche Gruppeninteressen
F 8.3 Interessen - im Laufe der Zeit
F 9 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Investitionen“
F 10 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Bildung“
F 11 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit der realwirtschaftlichen Treiber „Ersparnisse und Kredite“
F 12 Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit des realwirtschaftlichen Treibers „Umverteilung“
F 13 Zusammenfassung: Beeinflussung von Grenzen der Wirksamkeit realwirtschaftlicher Treiber
G Ideen für die Einschränkung von Polarisierung zur Sicherung von gesellschaftlicher und staatlicher Stabilität sowie von Demokratie
G 1 Zukunft sichernder Umgang mit Ressourcen, insbesondere mit der Ressource Umwelt
G 1.1 Planung des Ressourcenbedarfs durch Planung des Gütermarktes
G 1.2 Ressourcensparende Technologien
G 1.3 Umweltschutz und Recycling
G 1.4 Nachhaltige Realwirtschaft
G 2 Gewährleistung von genügend Arbeitsplätzen, die ausreichend bezahlt werden
G 2.1 Automatisierung und Rationalisierung sowie deren Einfluss auf die Anzahl erforderlicher Arbeitskräfte
G 2.2 Eigendynamik des Arbeitsmarktes
G 2.3 Strategie zur Gewährleistung von genügend Arbeitsplätzen, die ausreichend bezahlt werden
G 3 Rentabilität von investiv eingesetztem Geld
G 3.1 Investition in quantitatives realwirtschaftliches Wachstum kann zu stockendem quantitativem realwirtschaftlichem Wachstum führen
G 3.2 Unwägbarkeiten von Investitionen in technischen Fortschritt
G 3.3 Marktgesteuerte Investitionen in technischen Fortschritt
G 4 Dämpfung gesellschaftlicher Polarisierung durch Einkommensgestaltung
G 4.1 Die Aufsplittung in Gruppen mit prosperierenden und schwächelnden Einkommen
G 4.2 Die scheinbare Eigenverantwortung für die Zugehörigkeit zu einer Einkommensgruppe
G 4.2.1 Anerkennung aufgrund der Zugehörigkeit zur Gruppe mit höheren Einkommen
G 4.2.2 Hoffnungsverlust aufgrund der Zugehörigkeit zur Gruppe mit niedrigen Einkommen
G 4.3 Menschen und ihre Zugehörigkeit zu Einkommensgruppen
G 4.4 Länder mit eher reicher oder eher armer Bevölkerung
G 5 Umverteilung und Alternativen zur Umverteilung zwecks Erledigung staatlicher Aufgaben
G 5.1 Umverteilung – Zufriedenheit – Stabilität
G 5.2 Staatsverschuldung als Alternative zur Umverteilung durch den Staat
G 5.3 Alternativen zur Staatsverschuldung
G 5.3.1 Staatsverschuldung und ihr Verbot
G 5.3.2 Staatliche Aufgaben und deren alternative Finanzierung
G 5.3.3 Ergänzung der Realwirtschaft durch Spekulation
G 5.3.4 Trennung der wirtschaftlichen Kreisläufe in realwirtschaftliche und rein spekulativfinanzwirtschaftliche Kreisläufe
G 5.3.5 Der Zeitaspekt beim spekulativen Handel
G 5.3.6 Spekulation – von der Minderheitsmeinung zur Mehrheitsmeinung
G 5.3.7 Besteuerung spekulativen Handels
G 5.4 Mehr gleiche und weniger prozentuale Erhöhung von Löhnen und Gehältern
G 5.5 Besteuerung von Gelderträgen
H Minderung gesellschaftlicher bzw. globaler Polarisierung durch korrigierendes quantitatives realwirtschaftliches Wachstum im Zusammenspiel mit der Verbrauchsminderung bei Ressourcen - insbesondere bei der Umwelt
I Informationen – Informationstechnologie
I 1 Informationen im Zusammenspiel mit Gütern
I 2 Individuelle Informationen
I 3 Gesellschaftsorientierte Informationen
I 4 Politische Informationen
I 5 Informationstechnologie
I 5.1 Informationstechnologie - Verletzbarkeit der Vernetzung
I 5.2 Informationstechnologie - Zusammenwirken zwischen Generationen
I 5.3 Informationstechnologie - Orientierung auf dem Arbeitsmarkt
I 5.4 Informationstechnologie - Güterbereitstellung
I 5.5 Informationstechnologie Güteranbieter und Güternachfrager
I 5.6 Informationstechnologie - Auflockerung der Geheimhaltung
I 5.6.1 Abbau von Geheimhaltung bei Einkommensstrukturen
I 5.6.2 Abbau von Geheimhaltung im rein spekulativ-finanzwirtschaftlichen Bereich
I 5.7 Informationstechnologie – Orientierungshilfe für Flüchtlinge
J Wirtschaft im gesellschaftlichen Zusammenspiel
J 1 Besitzstandswahrung – Demografie
J 2 Realwirtschaft – rein spekulative Finanzwirtschaft – Wirtschaft des Bettelns
J 3 Geburtenzahl – Ressourcen
J 4 Demokratie – Freiheitlichkeit / Liberalität
J 4.1 Demokratie und Freiheitlichkeit / Liberalität gehören zusammen – treiben aber auseinander
J 4.2 Demokratie, Freiheitlichkeit / Liberalität und Varianten der Polarisierung
K Zwischenergebnis
L Handlungsmöglichkeiten – zusammengefasst
L 1 Instrumente für die Depolarisierung
L 2 Instrumente für Nachhaltigkeit
L 3 Was nun?
Beschreibung zentraler im Buch verwendeter Begriffe
Abbildung: Realwirtschaftliche Treiber in einem Netzwerk
Veröffentlichungen des Autors
Der Autor
-
A Überblick
A 1 Überblick - Roter Faden
Die Begriffe Kapitalismus, wirtschaftliches Wachstum und Konsum spielen in der gesellschaftlichen Diskussion eine wichtige Rolle. Sie sind Ausgangspunkte für Kritik an gesellschaftlichen Zuständen. Die Kritik besagt, dass es Menschen gibt, die zu viel Geld besitzen, die zu viel wirtschaftliches Wachstum zu verantworten haben oder auch die zu viel Konsum realisieren. Es handelt sich um die Beschreibung von Unterschieden zwischen wohl vermuteten Normalzuständen und abweichenden kritisierten Zuständen. Die angesprochenen Abweichungen kann man als Polarisierung bezeichnen, sofern sie große Ausmaße annehmen. Dazu seien einleitende Überlegungen angestellt.
Wenn durch die Realisierung fortlaufenden Bedarfs an Gütern quantitatives realwirtschaftliches Wachstum initiiert wird, werden die dabei erhaltenen Konsum- und Investitionsgüter aus Wachstumserfolgen bezahlt, als da sind Löhne, Gehälter und Gewinne.
Wenn sich Wachstumserfolge nicht in so ausreichendem Umfang realisieren lassen, dass die Erwartungen aller Beteiligten erfüllbar sind, erfolgt die Realisierung von Erwartungen eines Teils der Bevölkerung oft auf Kosten eines anderen Teils der Bevölkerung.
Gewünschtes Wachstum wird ab einem gewissen Grad auch auf Kosten des knapp werdenden Ressourcenvorrats erwirtschaftet.
Obige angedeutete negative Entwicklungen zeigen bereits, dass Polarisierung entstehen kann, dargestellt durch Armut und Reichtum, Hunger und Überfluss und unterschiedlich guten Zugang zu sich verknappenden Ressourcenvorräten. Es gibt Polarisierungen in Gesellschaften und zwischen Ländern. Dazu wird eine differenzierte Betrachtung vorgenommen.
Wenn Menschen ihr Leben nur mit ihrer Hände Arbeit zu gestalten hätten, wären sie damit zeitlich und kräftemäßig ausgelastet. Im Laufe der Zeit haben Menschen sich aber Verstärkungsfaktoren zugelegt, und zwar u. a. durch den Einsatz von:
angewandter Bildung
Energie
Rohstoffen
Maschinerie
Informationstechnologie
Mit Hilfe von Verstärkungsfaktoren können Menschen ihr Leben zunehmend besser gestalten. Mit deren Anwendung kann quantitatives realwirtschaftliches Wachstum zum Vorteil vieler Beteiligter angetrieben werden. Zur Auffächerung des realwirtschaftlichen Wachstums werden folgende Variable betrachtet:
Güter
Arbeit
Leistungsbilanzüberschuss
Güterverschwendung, z. B. bei Lebensmitteln
Ressourcen wie Energie, Rohstoffe und Umwelt
Innovative Produkte
Statussymbole
Recycling und erneuerbare Energie
Investitionen
Bildung
Ersparnisse und Kredite
Umverteilung für Gemeinschaftsaufgaben
Wenn Wachstumserfolge stark asymmetrisch an die beteiligten Menschen verteilt werden, sind zunächst gesellschaftliche und auch globale Polarisierung möglich.
Diese Varianten der Polarisierung können die Aufspaltung des eigentlich für die Realwirtschaft erforderlichen Finanzmarktes in einen realwirtschaftlichen und einen spekulativen Teil fördern. Die Aufspaltung findet z. B. statt, wenn zunehmend mehr Menschen so viel Geld haben, dass sie es nicht mehr nur realwirtschaftlich einsetzen, sondern auch spekulativ. Wenn der spekulativ orientierte Teil des Finanzmarktes stark zunimmt, kann das Vertrauen in die Beständigkeit des Geldwertes zu sehr geschwächt werden. Sobald Geld als Informationsträger zusammen mit seinen zugehörigen Informationen zu sehr an Vertrauen in seine Wertbeständigkeit verliert, tut sich für später die Frage auf, inwieweit Geld eventuell durch andere Informationsträger und Informationen ersetzt wird.
Die gesellschaftliche bzw. globale Polarisierung sind die ersten Varianten der Polarisierung. Dabei profitieren die beteiligten Menschen sehr unterschiedlich von den Wachstumserfolgen auf Gütermärkten.
Die ersten Varianten der Polarisierung können eine weitere Variante hervorbringen. Das ist die ökologische Variante. Die wird durch Ressourcenverbrauch getrieben und ist somit im ökologischen Bereich angesiedelt. Man kann sich ihr Entstehen zwischen zwei Zeitpunkten wie folgt vorstellen.
Umso mehr Menschen an Wachstumserfolgen auf den Gütermärkten teilhaben, desto mehr kann das durch den begleitenden Ressourcenverbrauch auf Kosten des Ressourcenvorrats bei Rohstoffen, Energie und bei der Umwelt gehen. Bei der durch Ressourcenverbrauch getriebenen ökologischen Variante der Polarisierung können wir von einem ursprünglichen Zustand ausreichender Ressourcenvorräte ausgehen. Diese können bei zunehmendem Ressourcenverbrauch knapper und auch zu knapp werden. Die durch Ressourcenverbrauch getriebene ökologische Polarisierung zeigt sich im Stadium der Knappheit, in dem Bevölkerungsteile oder Länder einen abnehmend guten Zugang zu manchen Ressourcen haben. Der Zustand der Knappheit zeigt sich extrem, wenn der Ressourcenvorrat unumkehrbar so sehr vermindert wurde, dass er nicht mehr für alle Menschen ausreicht. Dieser Vorgang betrifft insbesondere die Umwelt.
Vor diesen Hintergründen der durch asymmetrische Verteilung von Wachstumserfolgen oder durch Ressourcenverbrauch getriebenen Polarisierungen erfolgt eine komplexe Analyse:
Es zeigt sich, dass es bezüglich gesellschaftlicher bzw. globaler Polarisierung Vorteilsnehmer und Benachteiligte gibt, deren Rollen zu differenzieren sind.
Polarisierung wirkt für Menschen im Wettbewerb mit anderen zunächst als Antrieb, auch so viel Wachstumserfolge erreichen zu wollen wie die anderen. Mit der Zeit gebiert dieser Vorgang bei asymmetrischer Verteilung von Wachstumserfolgen neben Reichtum jedoch auch Armut.
Weiterhin stellt sich bei realwirtschaftlichem Wachstum im Laufe der Zeit tendenziell zu großer Umweltverbrauch ein.
Manche Menschen haben als Vorteilsnehmer der verschiedenen Varianten von Polarisierung offensichtlich ein Interesse daran, negative Folgen für Benachteiligte einer solchen Entwicklung ggf. zu ignorieren oder gar zu leugnen.
Die Analyse versucht herauszufinden, wie negative Folgen der verschiedenen Varianten der Polarisierung und deren gesellschaftliche Sprengkraft begrenzt werden können.
Es wird betrachtet, inwieweit verschiedene Arten der Polarisierung durch Umverteilungen reduziert werden können oder inwieweit informationstechnologisch agierende Gruppierungen von Individuen demokratisch legitimiert versuchen könnten, per Depolarisierung zu agieren.
Weiterhin wird sich die Analyse damit beschäftigen, inwieweit eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen durch Einsatz erneuerbarer Energie, Recycling und Umweltschutz die ökologische Polarisierung maßgeblich mindern kann.
A 2 Überblick – Alle Individuen befinden sich auf einer globalen Treppe des Wettbewerbs – u. a. zwischen Hunger und Überfluss
Märchen über die Zukunft könnten so anfangen:
Wenn alle Menschen …
satt zu trinken und zu essen hätten,
warm und trocken wohnen könnten,
Krankheiten möglichst gut behandeln lassen könnten,
sich angemessenen Komfort leisten könnten,
so viel Geld hätten, dass sie das bezahlen könnten,
in ausreichendem Umfang bezahlte Arbeit hätten,
die Vorräte an Ressourcen nur insoweit verbrauchen würden, dass diese langfristig ausreichen könnten,
die Umwelt nur insoweit verbrauchen würden, dass diese sich angemessen regenerieren könnte,
… dann gäbe es kaum Anlässe für Polarisierung zwischen arm und reich, Hunger und Überfluss und zwischen Zuständen wie noch genug oder schon zu wenig Umwelt, die Verteilungskämpfe provozieren.
In der Realität sehen wir aber, dass es Polarisierung gibt. Da sind z B Länder mit vielen armen und wenigen reichen Menschen, mit eher armen und eher reichen Menschen oder auch mit vielen relativ reichen und wenigen relativ armen Menschen. Polarisierung zeigt sich nicht nur innerhalb von Ländern, sondern global auch zwischen Ländern. Zum thematischen Einstieg wird Polarisierung im Zusammenhang mit realwirtschaftlichen Phänomenen behandelt.
Polarisierung als Zusammenspiel von realwirtschaftlichem Wachstum, Automatisierung, Rationalisierung und asymmetrischer, speziell prozentualer Verteilung von Einkommen.
In einem frühen realwirtschaftlichen Entwicklungsstadium wird für die Herstellung von Gütern primär menschliche Arbeitskraft eingesetzt. Das sind Güter, die die Menschen selbst verwenden, verkaufen und kaufen wollen. Die menschliche Arbeitskraft wird weitergehend auch für die Durchführung von Automatisierung und Rationalisierung gebraucht, um mit deren Hilfe mehr Güter erzeugen zu können und um mit denen weitergehende Nachfrage zu befriedigen.
Für das Geld, welches für den Einsatz menschlicher Arbeitskraft bezahlt wird, können hergestellte Güter gekauft werden. Wenn dann mit Hilfe von Automatisierung und Rationalisierung Produktion und Einkommen fortlaufend zunehmen, herrscht quantitatives realwirtschaftliches Wachstum.
Hier ist der Gedanke einzuflechten, dass Einkommen wie Löhne und Gehälter meistens asymmetrisch zunehmen. Eine Spezialform ist die prozentuale Steigerung. Menschen mit hohen Einkommen erhalten dabei einen höheren Betrag als Zuschlag als Menschen mit geringen Einkommen.
Die Menschen, die z. B für Automatisierung und Rationalisierung benötigt werden, können gut verdienen - und auch sparen.
Im Laufe der Zeit erhält ein Teil der Menschen, der auf Grund von Automatisierung und Rationalisierung in abnehmendem Umfang für die Güterherstellung benötigt wird, eher weniger Geld.
Dem realwirtschaftlichen Kreislauf wird bedingt durch Sparen und zu geringem Verdienst eventuell zu wenig Geld zugeführt.
Wenn es so zu abnehmendem Konsum, abnehmender Nachfrage und zu einem Überangebot von Gütern und menschlicher Arbeitskraft kommt, können Menschen arbeitslos werden, oder sie verdienen weniger. Entsprechend können solche Menschen zusätzlich weniger kaufen und die Nachfrage geht zusätzlich zurück. Als Folge sich selbst verstärkender Nachfrageschwächung kann das realwirtschaftliche Wachstum schwächeln.
Weiterhin gibt es arme Länder, in denen sehr viele Menschen kaum genug Geld für ein menschenwürdiges Leben erhalten
Jeder Einzelne ist offensichtlich Teil einer Entwicklung, die von Polarisierung in und zwischen Ländern geprägt ist.
Anschließend wird die durch Ressourcenverbrauch getriebene ökologische Polarisierung betrachtet.
Auf einer symbolischen globalen Treppe – Wettbewerb – Verstärkungsfaktoren – Ressourcenverbrauch – ökologische Polarisierung
Alle Menschen der Erde kann man sich auf einer sinnbildlichen Treppe vorstellen. Da sind hungernde und im Überfluss lebende sowie ganz arme und ganz reiche Menschen. Die Anzahl hungernder, im Überfluss lebender, armer und reicher Menschen und der Grad des Hungers, Überflusses, der Armut und des Reichtums sind in den verschiedenen Ländern wie auch zwischen Ländern sehr unterschiedlich.
Die Menschen auf der Treppe stehen in Wettbewerb miteinander. Es geht ums Überleben, etwas Komfort, Wohlstand und letztendlich auch wohl um Status und Macht. Menschen versuchen mit Hilfe von Bildung, technischem Fortschritt, Maschinerie, Automatisierung, Rationalisierung, Energie, Rohstoffen und Informationstechnologie ihre Arbeitskraft zu verstärken. Sie legen sich einen Verstärkungsfaktor zu und sind bemüht, diesen fortlaufend zu vergrößern. Dadurch hoffen sie, zunehmend mehr Güter für den Gebrauch und den Verkauf herstellen zu können, mehr zu verdienen und sich mehr leisten zu können.
Mit Hilfe des menschlichen Verstärkungsfaktors werden aber nicht nur zunehmend mehr Güter hergestellt, sondern parallel dazu werden immer mehr Ressourcen wie Energie, Rohstoffe und Umwelt verbraucht. Insofern zerstört Wettbewerb als Antrieb der Realwirtschaft für diese die Grundlage, wenn zu viel Ressourcen verbraucht werden. Das gilt zuvörderst für die Ressource Umwelt. Dabei sind zwei Zustände maßgeblich, zwischen denen die so genannte ökologische Polarisierung stattfindet. Im Zustand 1 ist noch genügend Umwelt vorhanden. Im Zustand 2 ist deren Verbrauch so sehr fortgeschritten, dass die menschliche Existenz global unumkehrbar gefährdet sein kann.
Interessengruppen und Verteilungskampf
Zusammenfassend kann man sagen, dass Automatisierung und Rationalisierung im Zusammenspiel mit asymmetrischer Verteilung von Wachstumserfolgen wie z. B. den Einkommen ein Antrieb für Polarisierung sind. Im Laufe dieser Entwicklung vergrößert sich die Lücke zwischen Armut und Reichtum sowie zwischen Hunger und Überfluss.
Wenn als Antwort auf eine solche Entwicklung die Wachstumserfolge auf alle Beteiligte eher gleichverteilt werden, dann erhalten im Vergleich zur asymmetrischen Verteilung der Wachstumserfolge die ärmeren Menschen größere Zuschläge und die reicheren Menschen erhalten kleinere Zuschläge. Die ärmeren Menschen haben dann mehr Geld für den Konsum und den Antrieb der Realwirtschaft und indirekt für den Ressourcenverbrauch und die Ressourcenverknappung. Die reichen Menschen erhalten dann weniger Geld zum Sparen und damit zum Entzug aus den realwirtschaftlichen Kreisläufen. Wenn die ärmeren Menschen bei mehr Gleichverteilung der Wachstumserfolge den globalen Ressourcenverbrauch wesentlich steigern, nimmt der Zeitraum der Ressourcenverfügbarkeit für alle Beteiligten, also auch für die reichen Menschen ab.
Für die eher reichen Menschen liegt es damit nahe, die armen Menschen finanziell, bezüglich Konsummöglichkeiten und bezüglich Ressourcenverbrauch zu schwächen, um so den Zeitraum für sich selbst zu verlängern, in dem es für sie noch genügend Ressourcen gibt.
In diesem Zusammenhang zeigt die realwirtschaftliche Entwicklung, dass es viele Menschen gibt, die um ein Minimum an Lebensstandard kämpfen und deren Weg auf der globalen Treppe nicht nach oben, oft aber nach unten führt. Viele Menschen auf der Erde haben in ihrem Leben nie eine Chance, im Kampf ums Überleben die untersten Stufen der Treppe zu verlassen. Es bilden sich potentielle Unruheherde, begleitet von Verteilungskämpfen, Verteilungskriegen und Flucht.
Parallel dazu gibt es auch die Menschen, die auf der globalen Treppe zu mehr Lebensstandard, zu mehr Einkommen und zu mehr Vermögen kommen, damit auf der Treppe aufsteigen und die polarisierungsgetriebenen Spannungen erhöhen.
In diesem Buch werden Gesichtspunkte herausgearbeitet, die das Spannungsfeld u. a. zwischen Hunger und Überfluss, ganz arm und ganz reich, Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeit oder auch zwischen Umweltschutz und Umweltverbrauch aufzeigen sollen. Diese Gesichtspunkte könnten die Transparenz für Individuen, Gruppen, Gesellschaften, Länder und Staaten verbessern. Vielleicht kann so einer etwas anderen Entwicklung Vorschub geleistet werden, um polarisierungsbedingte Konflikte, Kämpfe und Kriege zu mindern.
A 3 Überblick - Vom Individuum zur Sicherung von Ressourcen
Dieser Abschnitt spannt den Bogen über folgende Begriffe: Individuum - Demokratie - ausreichendes Wirtschaftswachstum – stabiler Staat - mangelhaftes Wirtschaftswachstum - Sicherung von Ressourcen.
Individuum und Gesellschaft
Demokratie und Gemeinschaftsaufgaben
Realwirtschaft, Konkurrenz und Geheimhaltung
Quantitatives realwirtschaftliches Wachstum und Gemeinschaftsaufgaben
Wachstumswirtschaft - Brückenbau zwischen Realwirtschaft, Demokratie und stabilem Staat
Mangelhafte Wachstumserfolge und Ressourcenvorräte
Individuum und Gesellschaft
Jeder einzelne Mensch ist als Individuum auch Teil einer Gesellschaft. Er wirkt als Akteur an der Gestaltung der Gesellschaft mit. Alle Akteure zusammen verändern die Gesellschaft. Das Verhalten der einzelnen Akteure stellt sich fortlaufend neu auf das Ergebnis ihrer aggregierten Aktivitäten ein.
Trotz der Komplexität des Zusammenwirkens von Individuen und Gesellschaft wird versucht, das Zusammenspiel von individueller Zufriedenheit mit Realwirtschaft, Demokratie und staatlicher Stabilität zu einem Denkgebäude zusammenzufügen.
Dabei wird beleuchtet, wie die individuellen, realwirtschaftlichen und demokratischen Aktivitäten zusammenwirken. Diese Betrachtung erfolgt insbesondere unter den Gesichtspunkten so genannten ausreichenden quantitativen realwirtschaftlichen Wachstums einerseits und so genannten mangelhaften quantitativen realwirtschaftlichen Wachstums andererseits.
Ausreichendes quantitatives realwirtschaftliches Wachstum gilt als vorhanden, wenn fast alle arbeitsfähigen Menschen genügend Arbeit haben können und genügend Geld verdienen können, um ihren Lebensunterhalt angemessen bestreiten zu können. Mangelhaftes quantitatives realwirtschaftliches Wachstum ist gegeben, wenn für einen wesentlichen Teil der arbeitsfähigen Menschen solche Zustände nicht gegeben sind.
Die Betrachtungen zu ausreichendem und mangelhaftem quantitativem Wachstum werden zunächst zusammen mit deren jeweilige Wirkungen auf die Realwirtschaft vorgenommen. In ihr dienen Konsumgüter und Investitionsgüter zusammen mit Geld der Versorgung der Bevölkerung.
Gefahren drohen dieser Realwirtschaft u. a. durch Arbeitslosigkeit, Marktsättigung, Rohstoffknappheit, Energieknappheit, Umweltknappheit, partielle Verselbständigung des Geldes in spekulativen Finanzmärkten und durch fehlendes Geld.
Die partielle Verselbständigung des Geldes kann auftreten, wenn vorhandenes Geld teilweise nicht mehr zur Aufrechterhaltung realwirtschaftlicher Kreisläufe benötigt wird. Dann stellt sich die Versuchung ein, mit realwirtschaftlich nicht benötigtem Geld spekulativ zu agieren, um dadurch zusätzliches Geld verdienen zu wollen.
Das Fehlen von Geld in der Realwirtschaft kann dadurch verursacht werden, dass es zu viel Menschen gibt, die zu wenig Geld zur Gewährleistung ihres Lebensunterhaltes haben.
Parallel dazu gibt es oft Menschen, die so viel Geld haben, dass sie mit einem Teil ihrer Einkommen spekulieren können. Anderen Menschen fehlt Geld für einen angemessenen Lebensunterhalt. Dieses Auseinanderfallen der Einkommen verschiedener Menschengruppen kann durch asymmetrische Verteilung der Einkommen verursacht und verstärkt werden. Eine Spezialform der Asymmetrie ist die prozentuale Verteilung. Ein Bevölkerungsteil erhält somit bei der Verteilung von Wachstumserfolgen größere Zuschläge und ein anderer bekommt kleinere Zuschläge.
So kann sich eine Polarisierung zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen entwickeln. Global betrachtet entstehen einerseits hungernde, ganz arme und arme Gruppen und andererseits hinreichend versorgte, reiche oder auch superreiche Gruppen. Dementsprechend haben sie unterschiedliche Mengen an Geld zur Verfügung, um an der Realwirtschaft teilhaben zu können. Da sind also einerseits Gruppen, die zu wenig Geld für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung haben. Andererseits bilden sich Menschengruppen heraus, die eine bestimmte Menge ihres Geldes nicht zum Erwerb von Gütern einsetzen, sondern es für den rein spekulativen Bereich einsetzen.
Je weiter Polarisierung zwischen Menschengruppen voranschreitet, desto größer werden Gefahren der Unzufriedenheit, gesellschaftlichen Unruhe und Unregierbarkeit, ausgehend von Menschen, die zu wenig Geld haben, um genügend Güter zum Überleben und für einen gewissen Komfort kaufen zu können.
Vor diesem Hintergrund werden später Überlegungen angestellt, wie eine durch Polarisierung angetriebene selbstzerstörerische Entwicklung korrigiert oder zumindest gemindert werden könnte.
Demokratie und Gemeinschaftsaufgaben
In einem demokratischen Staat dienen Wahlen u. a. dazu, über Lösungsvorschläge für Aufgaben abzustimmen, die der Realisierung des Gemeinwohls dienen, weil solche Aufgaben nicht gut durch Einzelpersonen erfüllt werden können. Diese Aufgaben werden als Gemeinschaftsaufgaben bezeichnet. Dazu gehören z. B. der soziale Ausgleich in der Bevölkerung sowie die innere und äußere Sicherheit.
Für die Realisierung der Gemeinschaftsaufgaben benötigt der demokratische Staat Geld. Dieses muss von der Realwirtschaft bereitgestellt werden und damit von den in der Realwirtschaft beschäftigten Menschen, die auch Träger der Demokratie sind
Demokratische Wahlergebnisse sollten möglichst weitgehend umgesetzt werden. Dabei sind einerseits die Mehrheitsinteressen und andererseits auch Minderheitsinteressen zu berücksichtigen. Das demokratische Geschehen sollte möglichst transparent sein, um das Vertrauen in den Staat zu untermauern.
Realwirtschaft, Konkurrenz und Geheimhaltung
Nachfragen und Angebote bilden Interessen und Aktivitäten von an der Realwirtschaft Beteiligten ab, als da z. B. sind: Arbeitnehmer, Unternehmen, Konsumenten und Investoren.
Realwirtschaft ist wesentlich durch Konkurrenz gekennzeichnet. Es handelt sich um Konkurrenz beim Verkaufen und Kaufen von Gütern. Konkurrenzorientiertes Verhalten der Beteiligten wirkt als Antrieb zum Erreichen von Wettbewerbsvorteilen. Diese werden dadurch realisiert, dass Menschen versuchen, mehr als andere Menschen zu verdienen und zu kaufen, bzw. mehr als andere Menschen zu verkaufen und Gewinn zu erzielen.
Um Vorteile gegenüber der Konkurrenz erreichen zu können, wird oft Geheimhaltung praktiziert. So sollen Arbeitnehmer oft nicht voneinander wissen, wieviel die jeweils anderen verdienen. Damit kann bei Menschen mit geringem Einkommen das Gefühl von Unzufriedenheit oder Scham verhindert werden. Unternehmen halten ihre Marktstrategie und Produktplanung geheim, um mögliche Vorteile nur für sich nutzen zu können und so Fundamente für weitere unternehmerische Aktivitäten errichten zu können. Besitzer von Vermögen können den Umfang ihres Vermögens geheim halten, um Neiddiskussionen vorzubeugen.
Durch Geheimhaltung erreichte Wettbewerbsvorteile können das Fundament für weitere realwirtschaftliche Aktivitäten legen, die im Wettlauf mit anderen Unternehmen eventuell neues quantitatives realwirtschaftliches Wachstum mit sich bringen können und damit vielleicht die Wachstumswirtschaft zumindest partiell beflügeln.
Auf den ersten Blick liegt es nahe, dass Wettbewerbsvorteile von manchen Menschen eventuell auf Kosten anderer Menschen gehen. Wenn in einer realwirtschaftlichen Wachstumsphase aber eine große Menge von Wachstumserfolgen zur Verteilung bereitsteht, ist es naheliegend, dass fast alle Menschen einer Gesellschaft Wachstumserfolge realisieren und damit auch ausreichend versorgt sein können. Eine solche Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass Güterstrom und der dazugehörende Geldstrom auf Käufer- und auf Anbieterseite ausreichend zunehmen.
Was geschieht, wenn die Wachstumserfolge abnehmen und sich damit die Möglichkeit zur zufriedenstellenden Versorgung der Beteiligten mit Gütern reduziert oder wenn mangelnde Wachstumserfolge ein Dauerzustand sind? Diese Phänomene werden später insbesondere unter den Gesichtspunkten schwächelnder Realwirtschaft, deren Ursachen und deren Bekämpfung betrachtet.
Quantitatives realwirtschaftliches Wachstum und Gemeinschaftsaufgaben
Menschen sind logischerweise bestrebt, Güter und Geld zu erhalten, und zwar über das für das Überleben erforderliche Maß hinaus. Sie können dann vielleicht Komfort genießen, Statussymbole erwerben oder auch die Zukunft als gut gesichert betrachten. Als Antrieb für die Erlangung von Geld und Gütern dient oft der Wettbewerb, in dem sich Unternehmen, Konsumenten, Investoren und Kreditgeber wie Banken befinden. Durch einen solchen Antrieb kann quantitatives realwirtschaftliches Wachstum entstehen. Die realwirtschaftlichen Akteure können so an Wachstumserfolgen teilhaben.
Es gibt aber auch Menschen, die als Behinderte wegen körperlicher oder geistiger Benachteiligungen nicht angemessen an der wettbewerbsorientierten Realwirtschaft teilhaben können. Für diese übernimmt der demokratisch legitimierte Staat im Rahmen seiner Gemeinschaftsaufgaben sinnvollerweise Ausgleichszahlungen. Zu den Gemeinschaftsaufgaben gehören auch innere und äußere Sicherheit, Infrastruktur, Bildung usw.
Das erforderliche Geld für die Erledigung der Gemeinschaftsaufgaben nimmt der Staat aus dem Topf der Wachstumserfolge, die von den realwirtschaftlichen Akteuren erwirtschaftet werden. Es handelt sich um eine Umverteilung von der Realwirtschaft zum Staat.
Das umverteilte Geld verlangt von denen kaum Opfer, die es erwirtschafteten, solange deren Wachstumserfolge in akzeptablem Umfang größer sind als der Umfang der Umverteilung.
Als Gegenleistung für die Umverteilung erhalten die Mitglieder der Gesellschaft die Vorteile staatlicher Stabilität, die durch die Erledigung von Gemeinschafsaufgaben untermauert wird. Für die Stabilität eines Staates dient als weiteres Standbein die demokratische Mitbestimmung. So können die Menschen in demokratischen Wahlen die Gemeinschaftsaufgaben des Staates mitbestimmend festlegen und ihm vor diesem Hintergrund das Geld für die zu erledigenden Arbeiten zur Verfügung stellen. Sie sind also mitbestimmend bei Festlegung der Gemeinschaftsaufgaben, Nutznießer der erledigten Gemeinschaftsaufgaben und der resultierenden individuellen Zufriedenheiten sowie der dadurch begründeten staatlichen Stabilität.
Hier sei ein Dilemma angedeutet. Die Mitglieder eines demokratisch organisierten Staates sind gleichzeitig auch Teilnehmer der dazugehörigen Realwirtschaft.
Der Staat nimmt zwecks Umverteilung Geld aus dem Pool der Wachstumserfolge. Er sollte diesen Pool nicht überstrapazieren, damit genügend Wachstumserfolge für die realwirtschaftlichen Akteure zu deren Verfügung bleiben.
Die Mitglieder des demokratischen Staates sollten den Pool des vom Staat zwecks Umverteilung eingenommenen Geldes ebenfalls nicht überfordern, weil es sonst Staatsschulden geben muss, die die Zukunft belasten.
Teilnehmer der Realwirtschaft mehren gern ihre Vorteile. Sobald die gleichen Menschen in ihrer Funktion als Mitglieder des demokratisch organisierten Staates gegenüber diesem Staat ebenfalls realwirtschaftliches Verhalten an den Tag legen, kann der so entstehende staatliche Aufgabenkatalog bald die von der Realwirtschaft bereitstellbaren Wachstumserfolge überschreiten und den Staat überfordern.
Wachstumswirtschaft - Brückenbau zwischen Realwirtschaft, Demokratie und stabilem Staat
Außer den Behinderten und Benachteiligten können im Rahmen einer ausreichend wachsenden Realwirtschaft fast alle Menschen direkt an wachsenden Einkommen, Gewinn und Gütern teilhaben. Wenn diese Teilhabe fortlaufend ausreichend zunimmt, gibt es genügend Gründe, mit dem durch dieses Wachstum getragenen demokratisch legitimierten Staat zufrieden zu sein, vorausgesetzt er kommt seinen Gemeinschaftsaufgaben nach, wie z. B. den Ausgleichzahlungen für Behinderte und Benachteiligte und der Gewährleistung von Bildung, der inneren und äußeren Sicherheit usw. Diese Konstellation im Rahmen einer Wachstumswirtschaft bewirkt offensichtlich den Brückenbau zwischen Realwirtschaft und Demokratie als Voraussetzung für einen stabilen Staat.
Mangelhafte Wachstumserfolge und Ressourcenvorräte
Was geschieht, wenn Erwartungen von Mitgliedern der Gesellschaft bezüglich des Erhalts von Wachstumserfolgen z. B. in Form von Einkommen und Gewinnen, bezüglich der Güterversorgung und bezüglich der Ressourcenversorgungssicherheit nicht angemessen erfüllt werden und eventuell gesellschaftliche Unzufriedenheit und Verteilungskämpfe drohen. Hier drängen sich Überlegungen zur Verhinderung solcher Situationen auf.
Zur Lösung von Versorgungsproblemen wird oft realwirtschaftliches Wachstum vorgeschlagen, um über zu erzielende und zu verteilende Wachstumserfolge die beteiligten Menschen zu befrieden. Die oft praktizierte asymmetrische Verteilung von Wachstumserfolgen treibt ab einem gewissen Niveau jedoch die Polarisierung an, die die gesellschaftliche Unzufriedenheit fördert.
Neben der Gewährleistung von Wachstumserfolgen ist die Sicherheit der Ressourcenversorgung das zweite wichtige Thema. Diese könnte auf den ersten Blick verbessert werden, wenn im Rahmen asymmetrischer Verteilung von Wachstumserfolgen der Reichtum von wenig Menschen und die Armut von viel Menschen zunehmen. So könnte die Zunahme des Ressourcenverbrauchs beschränkt werden, weil viel arme Menschen kaum noch Ressourcenverbrauch betreiben können. Für die reichen Menschen würden so Ressourcen wie insbesondere die zum Verbrauch bereitstehende Umwelt länger zur Verfügung stehen. Diese ökologische Polarisierung würde so allerdings verstärkt werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die verschiedenen Varianten der Polarisierung auf angemessen niedrigen Niveaus zu halten.
Erstens muss zu diesem Zweck die asymmetrische Verteilung von Wachstumserfolgen mehr zur Gleichverteilung übergehen, um die gesellschaftliche und globale Polarisierung zu mindern. Dadurch würde der Ressourcenverbrauch zunehmen.
In der Logik dieses Gedankens muss der Ressourcenverbrauch durch nachhaltiges Wirtschaften begrenzt werden. Die Nachhaltigkeit betrifft den Einsatz erneuerbarer Energien, das Recycling von Rohstoffen und die maßgebliche Minderung des Umweltverbrauchs. So könnte und müsste die ökologische Polarisierung klein gehalten werden.