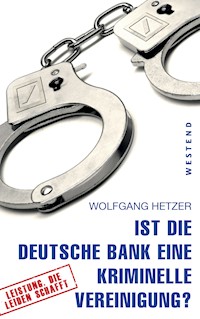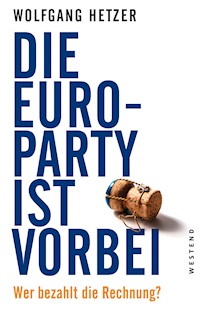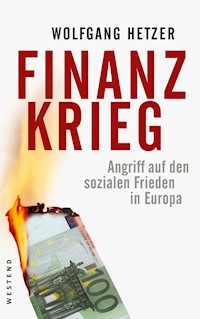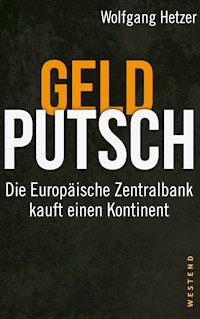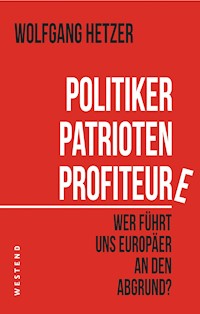
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Europäische Union ist ihrer größten Belastungsprobe seit Beginn der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt. Nicht nur geht das Gespenst des Nationalismus wieder um, auch die anhaltende globale Finanzkrise, die Turbulenzen innerhalb der Europäischen Währungsunion, eine historisch hohe Arbeitslosenquote und wachsende Zuwanderung stellen den Gemeinsinn in Europa auf die bislang größte und schwierigste Probe. Wolfgang Hetzer zeigt mit bislang unerreichter strategischer Klarheit, welche wirtschaftlichen und friedensbedrohenden Folgen in der gegenwärtigen Lage allen Menschen eines ganzen Kontinents drohen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
WOLFGANG HETZER
Politiker,Patrioten,Profiteure
WER FÜHRT UNS EUROPÄERAN DEN ABGRUND?
eBook Edition
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-587-6© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2015Satz: Publikations Atelier, DreieichDruck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, LeckPrinted in Germany
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Spaltpilze
Marsch durch die Institutionen
Zumutung und Zutrauen
Erdbeben und Abschied
Pöbelpolitiker
Feuilletonistische Verirrungen
Auf die Barrikaden!
Südliche Sehnsüchte
Lektionen
Geschichtsklitterung
Melkkuh
Rechenfehler
Risikofaktor Währungsunion
Keine marktkonforme Demokratie
Eliten zwischen Verantwortung und Inkompetenz
Protest und Provokation
Ratlosigkeit
Schlussbemerkungen
Abkürzungen
Anmerkungen
Literatur
»Die Bewegung (Pegida, Anm. d. Verf.) ist … aus dem Erleben der Wirtschafts- und Finanzkrise erwachsen. Die Leute haben die Demokratie als schwach wahrgenommen …, weil sie die Finanzmärkte anscheinend nicht kontrollieren kann … Keine Partei hat es geschafft, den Bürgern Europa als demokratische und soziale Identität zu vermitteln. Fast überall stand die Wirtschafts- und Währungsunion im Vordergrund.«
(Andreas Zick, Adorno hätte seine Freude, in: Der Spiegel, 10. Januar 2015)
»Mir war aber bereits klar geworden, dass sich der seit Jahren verbreiternde, inzwischen bodenlose Graben zwischen dem Volk und jenen, die in seinem Namen sprachen – also Politiker und Journalisten –, notwendigerweise zu etwas Chaotischem, Gewalttätigem und Unvorhersehbarem führen musste. Frankreich bewegte sich, wie die anderen Länder Westeuropas auch, auf einen Bürgerkrieg zu, das lag auf der Hand.«
(Michel Houellebecq, Unterwerfung, 2015, S. 101)
Vorwort
Spätestens seit Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) könnte jedermann wissen, dass die Legitimation von Autorität die Kernfrage der Politik ist. Sie stellte sich schon vor zweihundert Jahren mit besonderer Dringlichkeit. Der Wiener Kongress hat seinerzeit nicht nur getanzt. Er stiftete in Europa eine Ordnung, die den gesamten Kontinent bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs immerhin fast hundert Jahre lang prägen sollte. Die damaligen Großmächte Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien hatten sich nach dem Sieg über Napoleon zusammengefunden, um die Verheerungen der französischen Feldzüge durch eine neue Ordnung zu ersetzen. Dabei kam es jedoch zur Restauration alter Strukturen. Ihr Ziel war die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den Staaten Europas, das eine möglichst dauerhafte Stabilität sichern sollte. Das ist trotz mancher militärischer Scharmützel zwar gelungen.1 Die damals (wieder)geborene Welt ist aber im Inferno der Schlachten zwischen 1914 und 1918 untergegangen.
Mit den Verhandlungen des Versailler Vertrags wurde im Unterschied zur Schlussakte des Wiener Kongresses kein lang anhaltender Frieden zwischen den Völkern Europas geschaffen. Der Zweite Weltkrieg führte Europa in eine jahrzehntelange Agonie. Der Wiederaufbau des »Hauses Europa« konnte nicht in kurzer Zeit nach einigen durchtanzten Ballnächten gelingen. Die Milderung und teilweise Aufhebung der Spaltung eines ganzen Kontinents erforderten das ständige Bemühen von verantwortlichen Politikern und die Versöhnungsbereitschaft der europäischen Völker.
Der Umbruch von 1989 eröffnete neue ungeahnte Chancen für eine europäische Einigung, die über das Format des Wiener Kongresses hinausgeht. Die Europäische Union (EU) wird die gegebenen historischen Möglichkeiten jedoch weitaus entschlossener als bisher nutzen müssen. Es hat sich zwar noch nicht die allgemeine Angst verbreitet, dass wir am Vorabend eines dritten Weltkriegs stehen. Man kann aber seit einiger Zeit eine Besorgnis beobachten, die sich aus mehreren Quellen speist. In Europa hat eine Debatte über angebliche hegemoniale Bestrebungen Deutschlands begonnen. Die europakritische Haltung der Briten wird 2017 womöglich im Austritt aus der EU kulminieren. Die Entwicklung in der Russischen Föderation und die gewaltsame Politik ihres Präsidenten Wladimir Putin gegenüber manchen seiner Nachbarstaaten sowie die Einschätzung des amerikanischen Präsidenten Barack Obama, dass Russland nur eine »Regionalmacht« sei, deuten zudem an, dass wir heute allesamt von der staatspolitischen Klugheit der Teilnehmer am Wiener Kongress vor zweihundert Jahren noch weit entfernt sind. Tödliche terroristische Angriffe im Herzen Europas fordern die Solidarität aller Europäer heraus.
Hundert Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs scheint in Europa wieder einmal eine Zeit anzubrechen, in der immer mehr Menschen den Atem anhalten. Manche sehnen sich vielleicht sogar in paradoxer Weise nach der »Sicherheit« des Kalten Kriegs zurück. In mehr oder minder abgeschotteten Sphären konnten sich in West wie Ost damals politische, militärische und wirtschaftliche Strukturen bilden, die über Jahrzehnte die jeweiligen Bedürfnisse in einer geteilten Welt befriedigten. Sie haben aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Chancen für den Aufbau einer neuen und freiheitlichen prosperierenden Weltordnung versperrt und einen wahnwitzigen Rüstungswettlauf provoziert.
Erst die 1989 einsetzende Neuorientierung der russischen Politik (»Glasnost«, »Perestroika«) erweckte in Europa die Hoffnung auf den Bau eines »Hauses Europa«, das genügend Zimmer hat, in denen jeder nach seiner Façon wohnen könnte.
Was für die einen Aufbruch zu neuen Lebenschancen und wirtschaftlich liberalen Betätigungsmöglichkeiten war, ist aber für andere eine der größten Katastrophen der neueren Geschichte. Teile der russischen Nomenklatura scheinen bis heute an einer Art narzisstischen Kränkung zu leiden. Andere Mitglieder der damals herrschenden Machtcliquen haben die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt. Sie nutzten die neuen Freiheiten, um eine ganz spezifische Art des Kapitalismus in Russland aufzubauen. In der damaligen Aufbruchsstimmung war das Legalitätsprinzip nicht immer handlungsleitend.
Im Gegenteil: Vieles war von der Fähigkeit zum raschen und häufig brutalen und in jedem Fall eigensüchtigen Zugriff bestimmt. Insbesondere im Bereich der Wirtschaft fanden Umstrukturierungen statt, die mit revolutionären Prozessen vergleichbar waren. In ihnen »bewährten« sich häufig die Mitglieder der alten Nomenklatura, die immer wieder zu den ersten Mitgliedern der neuen Nomenklatura avancierten. Es entstand ein kaum durchdringbares Geflecht aus Absprachen, Konzessionen und korrupten Vereinbarungen, das auch zu einer Neugestaltung der Beziehungen zwischen politischen Machthabern und Wirtschaftspotentaten führte.
In den Interaktionen der Systeme und Subsysteme in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Militär, Sicherheitsbehörden und Organisierter Kriminalität sind Opportunität, Machtgier und Eigennutz immer wieder wirkungsmächtiger als das Gesetzlichkeitsprinzip.
Die Herstellung von Legalität degenerierte zum Reparaturbetrieb, der häufig zu spät begann und selten zuverlässig funktionierte. An der Tagesordnung war zunächst das paradoxe System einer unvollständig gesteuerten Anarchie. In dieser Zeit schien selbst der Ausbruch eines Bürgerkriegs nicht mehr ausgeschlossen. Der Machtübergang von Jelzin auf Putin war ein Deal besonderer Art, der nicht immer und nicht in allen Teilen von einer korrupten Konspiration zu trennen war. Die Sorge um die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit verdrängte rechtsstaatliches Denken – soweit überhaupt vorhanden – und erforderte ein sich ständig erneuerndes »Power Play«. Im Windschatten politischer Ambitionen konnte sich ein Wirtschaftssystem entfalten, in dem die Akteure zunächst kaum einer Kontrolle unterlagen und sich im Rahmen einer allgemeinen Bereicherungseuphorie hemmungslos aus dem Volksvermögen bedienten, bis sich eine in Teilen obszöne Schicht von Neureichen herauskristallisierte.
In der russischen Zivilgesellschaft gab es zunächst keine Mechanismen, mit denen man die asozialen Selbstbedienungsorgien rechtzeitig hätte beenden oder zumindest moderieren können. Der lange Zeit unbefriedigte Lebenshunger, das Schwelgen in Saus und Braus bedingte andere Prioritäten. Gemeinsinn wurde zum Müll der Geschichte gekehrt. Mit Normtreue und Anstand war nicht mehr zu reüssieren. Moralische Verkommenheit, Brutalität und Gewaltsamkeit waren erfolgversprechender. Die staatliche Autorität geriet immer mehr ins Hintertreffen. Korruption, Kapitalflucht und Steuerhinterziehung wurden endemisch.
Die entsprechenden Erfahrungen führten zu einer Sehnsucht nach dem »großen und starken Führer«, der den Stall ausmisten würde. Sozialpsychologisch hat Putin manche der damit einhergehenden Erwartungen und Bedürfnisse zwar erfüllt. Es ist ihm aber nicht gelungen, in wichtigen Bereichen der Wirtschaft Strukturen zu schaffen und zu fördern, die sich an weltweiten und konkurrenzstarken Produktionsprozessen beteiligen und international wettbewerbsfähige Dienstleistungsbetriebe schaffen. Die vorhandenen Bodenschätze wirkten wie ein süßes Gift.
In dieser anhaltenden Situation ist die Sanktionspolitik des Westens von besonderer Bedeutung. Sollte sie darauf abzielen oder auch nur die objektive Folgewirkung haben, dass Russland noch weiter wirtschaftlich in die Knie gezwungen wird, wäre das alles andere als ein Beitrag zur europäischen Sicherheit, schon gar nicht zur Stabilisierung der Ukraine. Auch wenn man den Gedanken an den Ausbruch eines großen Krieges immer noch von sich weist, wird man anerkennen müssen, dass die Schwächung Russlands über ein bestimmtes Maß hinaus zur großen Gefahr für das östliche und mittlere Europa werden könnte. Michail Gorbatschow warnte zur Jahreswende 2014/2015 sogar schon vor der Möglichkeit größerer direkter militärischer Auseinandersetzungen. Ein hochrangiger russischer Soldat drückt es unverhohlener aus: Russland wird eine Vernichtung der Bevölkerung im Donbass nicht zulassen. Bei einer drohenden Niederlage wird sich das Land richtig einmischen und muss dann Kiew einnehmen. Die Nato wäre in einer schwierigen Lage, weil man dann einen Dritten Weltkrieg beginnen müsste.2
Gegen Ende des Jahres 2014 belief sich der Schaden für die russische Wirtschaft durch Sanktionen, Kapitalflucht, einbrechende Investitionen, den Verfall des Rubels und den niedrigen Ölpreis schon auf mindestens 140 Milliarden Dollar. Geht das so weiter, wird der Weg zu einer neuen verlässlichen und friedlichen Weltordnung nach dem Kalten Krieg jedenfalls immer länger werden.
Die vom Westen ausgehende Weltfinanzkrise erhöht die Spannung. In dem dadurch entstandenen Klima hemmungsloser Selbstbereicherung und angesichts der Korrumpierung der angeblichen Leistungseliten im Finanzkapitalismus wächst die Neigung zu politischer Radikalität, aber auch zu krimineller Kompensation.
Es ist derzeit nicht zu beurteilen, ob sich in Russland ein revolutionärer Elan entwickeln wird, der mit der Französischen Revolution und der napoleonischen Konsequenz kriegerischer Angriffe auf die europäische Staatengemeinschaft vergleichbar ist. Die Einigkeit Europas wird derzeit eher durch interne Faktoren in Frage gestellt. Dazu gehört auch die jüngste Entwicklung in Griechenland.
Nach jüngsten Umfragen des Marktforschungsnetzwerks WIN/ Gallup unter 12 750 Personen in 13 Ländern wächst in vielen Staaten Europas die Europa-Skepsis und immer mehr Europäer gehen auf Distanz zur Europäischen Union. Der Grund für das zunehmende Misstrauen ist die Wirtschaftskrise. Die Hauptverantwortung für die Krise liegt nach Ansicht von 29 Prozent der Befragten bei den Banken. In Deutschland sind sogar 33 Prozent dieser Auffassung. Rund 20 Prozent nennen die Schwächen einzelner Länder wie Griechenland oder Portugal. Lediglich 11 Prozent gaben dem Euro die Hauptverantwortung für die Krise.3
In Großbritannien würden derzeit 51 Prozent der Befragten die europäische Staatengemeinschaft am liebsten verlassen. Dieses Land ist allerdings das einzige, in dem sich mehr Menschen den Austritt aus der EU wünschen als den Verbleib. Diese Haltung nehmen ansonsten 30 Prozent aller Befragten in 13 europäischen Staaten ein, zu denen auch die Nicht-EU-Mitglieder Island und Schweiz gerechnet wurden. In Deutschland haben immerhin 27 Prozent der Befragten für einen Austritt aus der EU votiert. 26 Prozent aller befragten Menschen fühlen sich derzeit »weniger europäisch« als noch vor zwölf Monaten. Nur 14 Prozent gaben an, sich »Europa näher« zu fühlen. In Deutschland sehen sich 21 Prozent weiter von Europa entfernt. In Griechenland besteht die größte Distanz. Dort erklärten 52 Prozent, sich weniger europäisch zu fühlen. In Großbritannien waren es 43 Prozent (Frankreich: 35 Prozent, Belgien: 27 Prozent, Irland: 26 Prozent). Nur in Dänemark, Island und Finnland überwog die Zahl der Menschen, die sich Europa stärker verbunden fühlen, die Zahl derjenigen, die sich weniger europäisch fühlen. Übrigens haben auch 26 Prozent der Schweizer ein distanziertes Verhältnis zu Europa.
Die folgenden Überlegungen skizzieren Voraussetzungen, Entwicklungen und mögliche Folgen der besorgniserregenden Lage, die sich nach den griechischen Wahlen vom 25. Januar 2015 weiter verschärfen könnte. Die hierzu unter hohem Zeitdruck erforderlichen Anstrengungen hätten ohne Susanne überhaupt nicht erbracht werden können und wären ohne Beate und Markus so und jetzt nicht möglich gewesen. Dafür sei ihnen allen mehr gedankt, als hier sagbar ist.
Einleitung
Europa war immer mehr als ein geographischer Ort. Der Kontinent ist mittlerweile Lebensraum für mehr als 500 Millionen Menschen. Dort besteht ein Wirtschaftsverbund mit einem Wohlstandsniveau, das zu den höchsten dieser Erde zählt. In Europa hat sich ein politisches System etabliert – die EU –, das unter anderem durch den Aufbau eines gemeinsamen Binnenmarkts seit vielen Jahrzehnten erfolgreiche Beiträge zur Gewährleistung des Friedens zwischen Staaten geleistet hat, die sich zuvor über Jahrhunderte immer wieder in verheerenden Kriegen bekämpften. Mittlerweile ist Europa zum »Sehnsuchtsort« für unzählige Menschen auch aus anderen Kontinenten geworden. Sie riskieren sogar ihr Leben, um dort zu landen. Die europäische Kulturgeschichte hat zu Höhepunkten in der geistigen Entwicklung der Menschheit geführt. Dazu zählen vor allem der »Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit« (Immanuel Kant), also die Aufklärung, und die Idee der Menschenrechte. Gleichwohl stößt Europa heutzutage bei immer mehr Menschen auf Skepsis.
Vor der politischen Konstitution einer europäischen Gemeinschaft war es den Nationalstaaten gelungen, eine »Meistererzählung« zu schaffen. Die »Volksgemeinschaft« war nicht nur eine Organisationsform, sondern geriet zum Kollektiv mit fast transzendenter Zielsetzung. Jedermann wusste, wo er hingehört. Heimatgefühl und Identität waren wesentliche Teile gesellschaftlicher Praxis. Sie vermittelten fast schon eine philosophische Orientierung. Im nationalstaatlichen Rahmen gelang es sogar, die Ideen der Liberalität zu verwirklichen und Freiheitssicherung auf die Agenda der Politik zu setzen. Manche halten die identitätsstiftende Wirkung von Nationalstaaten aber für eine optische Täuschung und behaupten, dass das Regionale insoweit stärker sei.1
Nach den Ergebnissen der Europa-Wahlen 2014 scheint das Nationale eine reaktionäre Kraft zu entwickeln. In Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Ungarn, Österreich, den Niederlanden, Finnland und in anderen Mitgliedstaaten der EU gewannen Parteien erheblich an Stimmen, die sich europakritisch bis europafeindlich äußern und eine stärkere Verfolgung nationaler Interessen fordern. Das ist nicht nur verwunderlich. Wir haben zwar europäische Institutionen, aber keine europäischen Emotionen. Die EU gilt nach wie vor als elitäres und pragmatisches Projekt ohne jeden ideologischen Anspruch. Es ist ihr bis heute nicht gelungen, eine europäische Identität zu schaffen. Das ist beunruhigend, wenn es denn stimmte, dass das Angebot eines entsprechenden neuen »Narrativs« und eine stärkere politische Integration notwendig sind, weil kein einzelner Staat in Europa die globalen Herausforderungen allein zu meistern vermag. Diese Einsicht ändert nichts daran, dass das Missvergnügen an der EU auch deshalb wächst, weil die politischen Prozesse dort bei weitem noch nicht so transparent sind, wie sie sein müssten. Die geringe Beteiligung an europäischen Wahlen ist Indiz und Warnung zugleich. Solange die Bürger nicht erkennen, dass es auf ihre Stimme tatsächlich ankommt, wird sich nichts ändern. Erst wenn ihre Stimmabgabe in den »Vereinigten Staaten von Europa« einen demokratischen Mehrwert ermöglicht, mag die Akzeptanz eines politisch geeinten Europas steigen.
Gegenwärtig stehen wir aber noch vor einem Dilemma zwischen Eliten- und Basisdemokratie.2 Eliten sind zwar nötig, um bestimmte Prozesse voranzutreiben. Sie dürfen aber nicht verabsäumen, zumindest im Nachhinein die demokratische Zustimmung des aus mehreren Staaten kommenden Souveräns einzuholen, der sich zu einem »europäischen Staatsvolk« verbinden soll.
Die mangelnde Beteiligung der Bürger in der EU ist sehr bedauerlich. Sie ist ein Ergebnis des Handelns und der Unterlassungen der Mächtigen, die sich vor kaum etwas mehr fürchten als vor Kontrollverlust. Im schlimmsten Fall wird demokratische Teilhabe nach Maßgabe aktueller Bedürfnisse der etablierten Politik moderiert oder gar lizenziert. Damit wird das demokratische Prinzip auf den Kopf gestellt. Das Projekt einer europäischen Verfassung im Jahre 2005 war nicht das Werk einer frei gewählten verfassungsgebenden Versammlung, sondern ein bürokratisch erarbeitetes Dokument unter der redaktionellen Oberherrschaft eines französischen »Mandarins« (Valéry Giscard d’Estaing).
Die Krise der Staatsfinanzen in den Mitgliedstaaten der EU und der Währungsunion, die fälschlicherweise als »Euro-Krise« bezeichnet wird, führt zu einer dramatischen Bedrohung des europäischen Integrationsprojekts. Sie ist zu einer Nagelprobe für Solidarität geworden. In etlichen Mitgliedsländern der Euro-Zone ist die Ablehnung der EU auch gewachsen, weil harte Reformprogramme als Gegenleistung für finanzielle Unterstützung gefordert werden. Dabei wird verkannt, dass der Begriff Euro-Krise kurzschlüssig ist. Der Euro beziehungsweise die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sind nicht schuld daran, dass fast alle Staaten der westlichen Welt seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse leben und gigantische Schuldenberge angehäuft haben. Er besitzt dennoch einen gewissen Erklärungswert. Die gemeinsame Währung hat doch in fast dramatischer Weise die Unterschiede zwischen der Leistungsfähigkeit der nationalen Volkswirtschaften und der unterschiedlichen Seriosität der staatlichen Fiskalpolitiken ans Licht gebracht. Die Illusion einer gleichgerichteten Entwicklung in der Euro-Zone ist spätestens 2008 geplatzt. Es kam zu einer Krise mit politischer Dimension, die mit internen Abwertungen (»Austerität«) bewältigt werden soll. »Sparen« und »Strukturreform« gerieten zu Leitmotiven.
Es folgten die »Rettungsschirme«, eine Bankenunion und vor allem eine »unkonventionelle« Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit ihrer Gründung sollte das vermeintlich »strenge« Regiment der Deutschen Bundesbank abgeschüttelt werden. Sie hatte sich faktisch zur europäischen Zentralbank entwickelt und bestimmte die Geldpolitik der anderen europäischen Zentralbanken.3 Die mittlerweile aufgekommene Kritik, insbesondere aus französischer Sicht, ähnelt einer Neuauflage der alten Kritik an der Bundesbank. Auch das ist nicht überraschend, glaubten französische Politiker doch anfangs, sie könnten auf die EZB mehr Einfluss nehmen, um ihre nationalen Interessen zu fördern.
Viele Franzosen denken mittlerweile, dass sie mit dem Euro und der EZB vom Regen in die Traufe gekommen sind. Die deutschfranzösische Zusammenarbeit ist seit der deutschen Wiedervereinigung im »Krisenmodus«. Das ist deshalb besonders beunruhigend, weil die EU quasi um Deutschland und Frankreich herumgebaut ist. Der europäische Motor läuft auf der Achse Paris–Berlin. Ein Ausscheiden Großbritanniens wäre zwar verkraftbar. Fiele der deutsch-französische Motor aus, wäre dies aber möglicherweise das Ende der EU.4 Deutschland hat geradezu feindselige Reaktionen provoziert, weil sich die Bundesregierung besonders nachhaltig für eine Politik der »Austerität« einsetzt und Sparanstrengungen fordert. Eine Fortsetzung dieser Politik könnte zum Ruin der EU führen.
Kurz nach der Europa-Wahl 2014 war der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel auf einmal zu dem Ergebnis gekommen, dass die reine Sparpolitik gescheitert sei. Möglicherweise gehen auch die Zeiten zu Ende, in denen derjenige das Sagen hatte, der auf der größten Kasse saß. Das würde allerdings bedeuten, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel in absehbarer Zeit auch nicht mehr den Takt in Europa weiterhin so ungestört vorgeben kann, wie das in den bisherigen Krisenjahren möglich war. In Frankreich und Italien mehren sich die Anzeichen, dass Merkel den Regierungen und den Bürgern zu dominant ist und Europa in die falsche Richtung schob. Immer weniger scheint man bereit zu sein, den vereinbarten Stabilitätspakt zu respektieren. Im Interesse der Wachstumsförderung wächst im linken politischen Spektrum die Entschlossenheit, präzise Vorgaben (Prozentgrenzen für Staatsschulden und Haushaltsdefizite) »flexibel« auszulegen.
Einerseits ist die EU eine einzige ständige »Grenzüberschreitung«. Das Spannungsfeld zwischen den Kompetenzanmaßungen der Zentrale und den Fliehkräften prägt das politische und exekutive Alltagsgeschäft. Der »Stabilitäts- und Wachstumspakt« ist ein beeindruckendes Musterbeispiel. Seine Missachtung könnte in Gestalt eines Abrisses der Fundamente der Währungsunion die gesamte Union ins Wanken bringen. Schon jetzt sind in der Euro-Krise die nationalistischen Geister putzmunter geworden. Andererseits war die EU immer ein Verbund von Nationalstaaten. Das ändert natürlich nichts an der Verbindlichkeit der gemeinsam verabredeten Stabilitätskriterien. Ohne Haushaltsdisziplin in den beteiligten Staaten sind sie jedoch nutzlos. Die ständige Berufung auf Ausnahmen führt zu einem permanenten Notstandsregime. Seine Ratio erschöpft sich im »Herauspauken« notleidender Länder. Damit wird aber keine Solidarität geübt, sondern ein uneuropäischer Weg beschritten. Die insbesondere von sozialdemokratischer Seite erhobenen Forderungen nach einer weiteren Lockerung des Pakts könnten früher oder später zu einem Abschied von den darin enthaltenen Vereinbarungen führen und unabsehbare wirtschaftliche und politische Folgen nach sich ziehen.
Man scheint noch nicht ganz verstanden zu haben, welche Signale von den Europa-Wahlen 2014 ausgegangen sind. Sie zeigen, dass die EU an eine Grenze gestoßen ist und die Besinnung auf ihren Kern erforderlich ist. Die europäischen Bürger haben sich jedenfalls nicht für eine unbegrenzte Schuldenmacherei ausgesprochen.5 Ihre Hilfsbereitschaft wird drastisch abnehmen, wenn sie das Gefühl haben müssen, dass die verantwortlichen Politiker die gegenwärtige Existenz und die Zukunft ihrer Kinder mit untragbaren Hypotheken belasten. Europa darf jedoch nicht zum Wunschkonzert degenerieren. Das Gerangel um die Besetzung des Amts des Präsidenten der Europäischen Kommission und die Verfassungsbeschwerden vieler tausend Bürger in Deutschland im Zusammenhang mit dem Beschluss der EZB über den unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorlage einiger Streitfragen an den Europäischen Gerichtshof sind »Zeichen an der Wand«.
Es geht um die Zukunft Europas. Die Bürger der EU empfinden mittlerweile mindestens »Missvergnügen«. Die kommenden Herausforderungen sind nur zu bewältigen, wenn der Demokratisierungsprozess in allen Bereichen der Union konsequent fortgesetzt wird. Die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Probleme müssen nach Maßgabe sozialer Gerechtigkeit in allen Mitgliedstaaten und von den europäischen Institutionen angepackt werden. Das sollte im Bewusstsein der existentiellen Bedeutung der politischen Einigung auf dem Kontinent entschlossen und sachverständig geschehen. Das vorliegende Buch bietet zwar entsprechende Anregungen. Es zeigt aber auch, dass der folgende Satz nicht ganz falsch ist: »Je länger man Europa vernünftig anschaut, desto unvernünftiger schaut es zurück.«6
Spaltpilze
Es greift ein diffuses »Unwohlsein« um sich. Immer mehr Menschen bekommen das Gefühl, dass heute etwas mit der Welt im Ganzen auf eine sehr unheimliche Weise schiefgeht. Die Färbung und Massivität dieser Empfindung treten bei einem Blick auf Europa besonders deutlich zutage. Diesem »Projekt« wird attestiert, dass es dabei sei, an Missmanagement zu scheitern und in einem »Sumpf« zu versinken. So nennt Peter Sloterdijk das »Heillose« und »Überkomplexe«. Darunter fallen nach seinem Empfinden »Bürokratismus, Ökonomismus, Monetarismus und Prozeduralismus«. Sie werden von Jahr zu Jahr wegloser und verwickelter. Es findet eine ständig fortschreitende Entfremdung zwischen denen statt, die oben etwas konstruieren, und denen, die es unten nicht mehr mitvollziehen. Die »Titanic Europa« steuert womöglich einen Eisberg an.1 Der Befund ist fatal: Das »europäische Aggregat« befindet sich in einem Zustand, den niemand so gewollt haben kann. Abhilfe ist nicht erkennbar, ein inspirierendes gemeinsames Projekt, das einen Neustart bewirken könnte, auch nicht. Als durchweg ökonomisch ausgerichtete Wohlstandsgemeinschaft scheint Europa an seinen Grenzen angelangt zu sein. Jenseits davon deutet sich an, dass wir gegenwärtig nicht nur eine kleine Krise des Kapitals erleben, die auf dem Weg zu »blühenden Landschaften« der Vollbeschäftigung und der sozialen Gerechtigkeit überwunden sein wird. Wir stehen allem Anschein nach vor einem strukturimmanenten Problem, das sich weiter verschärfen dürfte. In der Euro- und Schuldenkrise verstärkt sich bereits die Klage darüber, dass der Einheit Europas ein belastbarer »Mythos« fehlt. Der Kontinent kommt dem »Pol der lose gekoppelten Unterhaltungsgemeinschaft nahe, mit all seiner amüsanten Diversität, seiner konstitutiven Uneinigkeit, seiner sympathischen Entschlussschwäche, seiner prekären Symbiose zwischen Norden und Süden«. Erkennbar ist das auch an der »herrlichen Beliebigkeit der Themen, am Vorrang der Urlaubsweltansichten und an einer alles durchdringenden Ernstfallferne«. Europa ist angeblich Lichtjahre von der »zusammengescheuchten und zusammengeballten Kampfgemeinschaft« entfernt, die unter dem Stress eines akuten Sich-angegriffen-Fühlens zielbewusst kooperieren könnte, um das Eine, das nottut, zu erreichen. Dem Begriff »Unterhaltungsgemeinschaft« kommt dabei keine alltägliche Bedeutung zu. Er deutet vielmehr auf den »Zusammenhang zwischen Polythematik und Agenturschwäche« hin. Gemeint sind Systemzustände, in denen man über tausenderlei Dinge reden kann, weil man ja praktisch gar nichts tun wird.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!