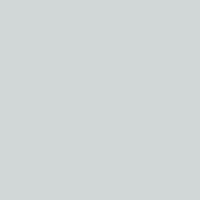12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erzeugung von Angst ist äußerst hilfreich, um Herrschaft zu etablieren und zu stabilisieren. Das ist spätestens seit Machiavelli bekannt. Doch wer von Angst überwältigt wird, kann nicht frei sein. Politische Angst unterhöhlt Rechtsstaat und Demokratie. In der "Coronakrise" ist dies durch den repressiven, Angst erzeugenden staatlichen Zugriff auf Individuen und Gesellschaft vielen Menschen bewusst geworden. Ulrich Teusch zeigt, wie wir die Methoden der Angsterzeugung erkennen, uns schützen und wehren können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ebook Edition
Ulrich Teusch
Politische Angst
Warum wir uns kritisches Denken nicht verbieten lassen dürfen
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-864898-40-2
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2021,
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Wissen Sie, ich bin fest davon überzeugt, daß wir immer nur eine kleine Schar in der Welt sein werden. Wie die Dinge liegen, werden wir stets die Besiegten sein. Doch was tut’s? Der Geist ist nur dann besiegt, wenn er der Niederlage zustimmt. Er ist den Jahrhunderten voraus.
(Romain Rolland in einem Brief an Albert Einstein1)
Vorwort
Was auf den folgenden Seiten zu lesen steht, ist vielleicht ein wenig gewöhnungs- und erklärungsbedürftig. Denn ich betreibe ein Wechselspiel: Einerseits berichte ich viel aus der gegenwärtigen Krise, von persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen, Beobachtungen, Gefühlen und Ängsten. Ich erzähle kleine Geschichten. Sie sind alles andere als spektakulär, vielmehr typisch und repräsentativ für das, was Millionen andere Menschen auch erlebt oder empfunden haben – so oder ähnlich.
Über diese alltagsnahe Darstellung hinaus ist mir andererseits aber immer auch an einer theoretischen Vertiefung und Verallgemeinerung gelegen: Wie sind die Erlebnisse und Erfahrungen zu erklären? Wie sind sie zu verstehen? Was haben sie zu bedeuten?
Vor allem interessiert mich: Wie kommt es zu dem, was ich im Folgenden als »politische Angst« bezeichnen werde? Was hat es mit ihr auf sich?
Dass Angst ein überaus effektives Herrschaftsmittel ist, wissen wir spätestens seit Niccolò Machiavelli und Thomas Hobbes. Die entsprechenden Machttechniken wurden im Lauf der Geschichte stetig perfektioniert. Sie werden auch gegenwärtig wieder eingesetzt. Das ist vielfach beschrieben und analysiert worden.1
Es bleiben jedoch Fragen: Warum lassen sich Menschen überhaupt (und so leicht) ängstigen? Warum geben die meisten von ihnen dem Druck immer wieder nach? Warum opfern sie ihre individuelle Freiheit allzu oft einer trügerischen Sicherheit? – Und warum sind wenige andere standhaft?
Solche weiterführenden Fragen kann ich nicht im Alleingang beantworten. Ich werde mich im Lauf meiner Darstellung daher immer wieder auf einige wenige große Denker und Denkerinnen des 20. Jahrhunderts beziehen, sie mit markanten Aussagen zitieren und versuchen, ihre Erkenntnisse für unsere Zeit fruchtbar zu machen. Es handelt sich dabei durchweg um Autoren, die von der totalitären Erfahrung dieses »Zeitalters der Extreme«2 (also des »kurzen 20. Jahrhunderts« 1914 bis 1989/91) tief geprägt wurden und aus ihr ähnliche Schlüsse gezogen haben. Da in den aktuellen Debatten immer wieder die Gefahr einer Erosion des Rechtsstaats und eines Abdriftens in autoritäre oder diktatorische Verhältnisse – also letztlich eine Wiederholung der Geschichte – beschworen wird, erscheint es mir ratsam, auf solche Erfahrungen zurückzugreifen.
Ich werde die Freiheitsbegriffe von Simone Weil, Erich Fromm, Ernst Cassirer und Hans Freyer skizzieren und damit eine theoretische Grundlage für die weitere Erörterung schaffen. Ich hätte mir selbstverständlich auch andere Autoren aussuchen können, die für ähnliche Erkenntnisse wie die vier genannten stehen. Aber auf die Auswahl kommt es letztlich nicht an.
Wichtig ist: Gerade in einer Zeit des Umbruchs und der Verunsicherung, einer Zeit, die weithin von politischer Angst durchsetzt und gelähmt ist, brauchen wir verlässliche, ermutigende Wegweiser. Wir brauchen starke intellektuelle Bezugspunkte, von denen wir lernen können, auf die wir uns berufen können, an die wir anknüpfen können.
Auch wenn hier immer wieder von Corona die Rede ist, habe ich kein Corona-Buch geschrieben oder schreiben wollen. Allerdings: Ohne die aktuelle Krise wäre dieses Buch wohl nicht entstanden. Es waren die »Maßnahmen« gegen Corona, die in mir politische Angst haben entstehen lassen: politische Angst als Gefühl – und Politische Angst als Buch.
Der Text ist zweigeteilt: Der erste, größere Abschnitt ist zeitdiagnostisch ausgerichtet, im zweiten entwickle ich einige normative und strategische Überlegungen, die vielleicht helfen können, sich in einer Krise zu orientieren, die uns noch lange beschäftigen wird. Insgesamt bietet der Text keine strenge, klar strukturierte Argumentation, sondern ist essayistisch angelegt, hat eher den Charakter einer Collage. Ich betrachte mein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und hoffe, dass sich am Ende ein schlüssiges Gesamtbild ergeben wird.
SAGREDO Vierzig Jahre unter den Menschen haben mich ständig gelehrt, daß sie der Vernunft nicht zugänglich sind. Zeige ihnen einen roten Kometenschweif, jage ihnen eine dumpfe Angst ein, und sie werden aus ihren Häusern laufen und sich die Beine brechen. Aber sage ihnen einen vernünftigen Satz und beweise ihn mit sieben Gründen, und sie werden dich einfach auslachen.
GALILEI Das ist ganz falsch und eine Verleumdung. Ich begreife nicht, wie du, so etwas glaubend, die Wissenschaft lieben kannst. Nur die Toten lassen sich nicht mehr von Gründen bewegen!
(Bertolt Brecht, Leben des Galilei3)
I DIAGNOSE
Beschwichtigung und Hysterie
Die Aufregung ist groß und die Stimmung gereizt. Fast hat man den Eindruck, wir erlebten zurzeit etwas noch nie Dagewesenes, etwas völlig Neues unter der Sonne. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wir befinden uns in einer geradezu klassischen Konstellation. Sie lässt sich in beinahe jeder Krisen- oder Katastrophenlage beobachten.
Vor gut zwölf Jahren (2008) veröffentlichte ich ein Buch mit dem Titel Die Katastrophengesellschaft – Warum wir aus Schaden nicht klug werden.1 Es war ein gutes und wichtiges Buch, wie ich nach wie vor finde. Es gefiel zwar einer Handvoll Kritikern, aber nicht dem Publikum. Kaum einer wollte es kaufen oder lesen, und inzwischen wurde der größte Teil der Auflage makuliert (also geschreddert).
Meine These lautete: Unsere Gesellschaft ist strukturell unfähig, Katastrophen oder katastrophale Prozesse mit nüchternen Augen zu betrachten. Sie neigt zu extremen Ausschlägen, entweder zur Verdrängung und Beschwichtigung oder zur Dramatisierung und Hysterie. So war es auch in der Corona-Krise – mit perversen Effekten: Wer zu Beginn der Krise Alarm schlug, wurde als Verschwörungstheoretiker hingestellt; wer im Verlauf der Krise für mehr Gelassenheit plädierte, ebenfalls.
Hysterie und Beschwichtigung spalten die Gesellschaft. Die Kontrahenten werfen sich wechselseitig Panikmache oder Verharmlosung vor. Die eine Seite beschuldigt die jeweils andere, sie verhalte sich »unverantwortlich« und betreibe »Realitätsverweigerung«. Beide Extremhaltungen können fatale Folgen zeitigen, wie die Katastrophengeschichte lehrt.
Einen der eindrücklichsten Belege findet man in Alessandro Manzonis berühmtem, erstmals 1827 erschienenen Roman I Promessi Sposi, zu Deutsch Die Brautleute.2 In dieses Werk hat Manzoni eine umfangreiche Schilderung der Mailänder Pestkatastrophe des Jahres 1630 eingefügt. Die Kapitel fallen insofern aus dem Rahmen, als der Autor hier in die Rolle des akribischen Historikers, besser vielleicht: in die Rolle des historischen Soziologen schlüpft.
Manzoni schildert – anders als im übrigen Roman – kein fiktives Geschehen. Vielmehr hat er alle gedruckten historischen Quellen zu der Epidemie, deren er habhaft werden konnte, konsultiert und ausgewertet. Nach dem Vorbild des professionellen Wissenschaftlers gibt er seinen Aussagen zum Beleg sogar etliche Fußnoten bei.
Manzonis Thema sind nicht so sehr die Schrecken der Epidemie, die von ihr angerichteten Verheerungen, sondern ihre gesellschaftliche Wahrnehmung, die langwierigen Erkenntnisprozesse, die durchzustehen waren, bis man sich am Ende eingestand: Ja, tatsächlich, bei dem, was wir vor uns sehen, handelt es sich unbezweifelbar um die Pest.
Zunächst wurde nach Kräften verdrängt, geleugnet und schöngeredet, man leistete sich einen sinnlosen Streit um Begriffe, verlor kostbare Zeit. Und schließlich, kaum dass man das entsetzliche Faktum endlich zur Kenntnis genommen hatte, betrieb man schon eine verquere Sinngebung des Ereignisses oder machte Jagd auf Sündenböcke. So schlug die anfängliche Beschwichtigung unversehens in Hysterie um.
Manzonis großartige Darstellung ist ebenso erschütternd wie lehrreich, zumal sie Mechanismen und Muster des »Katastrophen-Managements« freilegt, die bis heute ihre Wirkung tun. Am Ende des Pestkapitels steht wie in jeder guten wissenschaftlichen Abhandlung ein Summary der Befunde:
»Am Anfang also keine Pest, auf keinen Fall und in keiner Weise; sogar das Wort ist verboten. Dann pestartige Fieber: die Vorstellung schleicht sich durch ein Adjektiv ein. Dann keine richtige Pest; soll heißen: Pest schon, aber nur gewissermaßen; nicht eigentlich Pest, sondern etwas, für das man keinen anderen Namen finden kann. Schließlich ganz zweifellos und unbestreitbar Pest, aber schon hat sich eine andere Vorstellung damit verbunden, nämlich die der Hexerei und Giftmischerei, die den Sinn des nicht mehr abweisbaren Wortes verwirrt und verfälscht.«3
Auch viele andere Vorstellungen und Wörter, so Manzoni, hätten einen ähnlich dornenreichen Weg zurückgelegt – was ihn zu einer unvermindert aktuellen Nutzanwendung seiner Betrachtungen inspiriert. Man könnte, stellt er fest, den langen und gewundenen Weg zur adäquaten Wahrnehmung und Anerkennung der Realität erheblich abkürzen, würde man eine »seit langem schon vorgeschlagene Methode« befolgen: »zu beobachten, hinzuhören, zu vergleichen und nachzudenken, bevor man redet«.4
Die ungeliebte Freiheit – vier Perspektiven
1941 publizierte der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm (1900 bis 1980) sein berühmt gewordenes Buch Die Furcht vor der Freiheit. Darin vermerkt er, dass der Kampf für die Freiheit im Lauf der Geschichte zwar viele Rückschläge habe hinnehmen müssen, dass aber auch manche Schlachten gewonnen worden seien. »Viele sind in diesen Schlachten in der Überzeugung gestorben, es sei besser, im Kampf gegen die Unterdrückung zu sterben, als ohne Freiheit zu leben. Ein solcher Tod war für sie die höchste Bestätigung ihrer Individualität.«5
Was Fromm da schreibt, klingt zunächst nach einer von vorsichtiger Zuversicht bestimmten Geschichtsdeutung. Doch die Realität des Jahres 1941 gab wenig Grund zur Hoffnung. Und vor dem Hintergrund der bedrückenden Verhältnisse dieses Jahres formuliert Fromm nur wenige Zeilen später denn auch den Verdacht, mehr noch: die bittere Einsicht, dass die Liebe zur Freiheit möglicherweise eine Sache für Minderheiten sein könnte.
Tatsache war: Totalitäre politische Systeme hielten seinerzeit große Teile der Welt in Atem und im Griff. Nur wenige Menschen hatten sich dem Aufstieg der Diktaturen widersetzt. Weit eher war das Gegenteil der Fall gewesen. In Deutschland, Italien und andernorts haben viele Millionen ihre Freiheit ebenso bereitwillig aufgegeben, wie ihre Väter und Mütter für sie gekämpft hatten. Statt sich nach Freiheit zu sehnen und das schon Erreichte zu verteidigen, sahen sie sich nach Möglichkeiten um, der Freiheit zu entfliehen. Offenbar war sie ihnen zur Last geworden. Sie fürchteten sie. Sie zogen ihr die vermeintliche Sicherheit unter einem freiheitsfeindlichen, unterdrückerischen Regime vor. Andere wiederum – auch sie Millionen zählend – hätten vielleicht ein freies Leben präferiert, doch sie waren nicht bereit, aktiv dafür einzustehen. Sie ließen den Verlust ihrer Freiheit widerstandslos geschehen.6
Wie Fromm, so hatte auch der Philosoph Ernst Cassirer (1874 bis 1945) Deutschland unmittelbar nach der Machtübernahme des Nazismus verlassen. Und wie Fromm in der Furcht vor der Freiheit reflektierte Cassirer in seinem Buch Vom Mythus des Staates (das 1946 posthum zunächst in den USA erschien) über die zwölf braunen Jahre und was sie im Hinblick auf die Freiheitsfrage zu bedeuten hatten. Cassirer und Fromm kommen zu übereinstimmenden, bis in einzelne Formulierungen hinein fast identischen Einsichten:
»Die Freiheit ist kein natürliches Erbe des Menschen. Um sie zu besitzen, müssen wir sie schaffen. Wenn der Mensch bloß seinen natürlichen Instinkten folgen würde, würde er nicht für die Freiheit kämpfen; er würde eher die Abhängigkeit wählen. Offenkundig ist es viel bequemer, von anderen abzuhängen, als für sich selbst zu denken, zu urteilen und zu entscheiden. Dies erklärt, daß die Freiheit so oft sowohl im privaten als auch im politischen Leben mehr als Last denn als Vorrecht betrachtet wird. Wenn die Bedingungen außerordentlich schwer sind, versucht der Mensch, diese Last abzuschütteln. Hier hakt der totalitäre Staat und der politische Mythus ein. Die neuen politischen Parteien versprechen wenigstens ein Entkommen aus dem Dilemma. Sie unterdrücken und zerstören den Sinn für Freiheit selbst; aber gleichzeitig befreien sie den Menschen von jeder persönlichen Verantwortung.«7
Die französische Philosophin Simone Weil (1909 bis 1943) hatte ein viel zu kurzes, überaus aufreibendes, ganz vom Erkenntnisdrang bestimmtes Leben. Wenige Monate vor der Machtübernahme des Nazismus, im August und September 1932, hielt sie sich zu Studienzwecken in Deutschland auf. Zurück in Frankreich, verfasste sie 1934 ihre bedeutende, zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebene Schrift Über die Ursachen von Freiheit und gesellschaftlicher Unterdrückung. Auch dieser Text ist von der totalitären Erfahrung bestimmt, und auch er gibt auf die Freiheitsfrage eine skeptische, desillusionierte Antwort:
»Die Wahrheit ist, dass die Knechtschaft (…) den Menschen so weit erniedrigt, bis er sie liebt, dass die Freiheit nur denen kostbar ist, die sie wirklich besitzen, und dass ein ganz und gar unmenschliches System wie das unsere nicht etwa Menschen hervorbringt, die eine menschliche Gesellschaft aufbauen können, sondern alle, die ihm unterworfen sind, Unterdrückte wie Unterdrücker, nach seinem Bild formt.«8
Anders als die drei gerade vorgestellten Denker hatte der Soziologe Hans Freyer (1887 bis 1969) den Aufstieg des Nazismus zunächst mit Hoffnungen begleitet und sich dem Regime einige Jahre angedient. Dann jedoch ging er mehr und mehr auf Distanz und zeigte sich nach 1945 geläutert. In den 1950er- und 60er-Jahren gewann Freyer erheblichen öffentlichen Einfluss mit einer Vielzahl zeitdiagnostischer und technikkritischer Schriften. Auch die Frage nach der Freiheit trieb ihn um.
Auf den ersten Blick scheint sein Ansatz von größerem Optimismus bestimmt zu sein als die Positionen Fromms, Cassirers und Weils. Freiheit und Selbstbestimmungskraft, heißt es da, gehörten zum Wesen des Menschen; sie seien kein Produkt der Geschichte. Dann jedoch kommen Freyers Einschränkungen: Individuelle Freiheit und Autonomie, sagt er, können sich immer nur auf dem je gegenwärtigen Handlungsfeld, in vorgefundenen Sachzusammenhängen und unter gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen bewähren. Und das jeweilige Handlungsfeld sei auch im günstigsten Fall kein frei formbares Material. Es sei auf vielfältige Weise präformiert – und das menschliche Handeln darum notwendigerweise entfremdet.9
Des Weiteren zeigen die Handlungsfelder hinsichtlich ihrer Präformierungen Gradabstufungen. Diese können sich bis zum Extrem steigern und den Grenzfall der nahezu völligen Entfremdung erreichen. Und schließlich ist der Mensch nicht nur ein auf Freiheit und Autonomie angelegtes, sondern auch ein höchst »modellierungsfähiges«10 Wesen.
Der Schlüsselbegriff in Freyers 1955 erschienener Theorie des gegenwärtigen Zeitalters ist der des »sekundären Systems«. Sekundäre Systeme sind technische Systeme, die, so Freyer, »nach einer ganz neuen Formel konstruiert« sind. In ihnen werde – anders als in den »Ordnungen auf gewachsenem Grunde«11 –
»mit einem Menschen gerechnet, der gar nicht anders kann, als auf das System ansprechen, und diese Rechnung ist nicht Theorie, sondern sehr real: der Mensch wird auf das Minimum, das von ihm erwartet wird, wirklich reduziert. Dann ist hinreichende Wahrscheinlichkeit gegeben, daß er sich auf den Linien des Modells bewegen wird.
Sekundäre Systeme (…) sind Systeme der sozialen Ordnung, die sich bis zum Grunde, das heißt bis in die menschlichen Subjekte hinein, entwerfen.«12
Der von diesen neuartigen Systemen ausgehende Anpassungszwang wird nicht in herkömmlicher, äußerlich bleibender Weise an den Menschen herangetragen, sondern »in sein Herz und seinen Sinn«13 gepflanzt. Und das mit Erfolg:
»Angesichts der fortschreitenden Perfektion des Systems vermißt der Mensch seine Freiheit nicht mehr. Er schickt sich darein, daß es auch ohne sie geht. Dies um so leichter, weil das System in den toten Winkeln zwischen seinen Ansprüchen allerhand private Freiräume gewährt, die nach Geschmack und Belieben ausgefüllt werden können, ohne daß der Lauf des großen Apparats dadurch gestört wird, und weil es sich insgesamt mit einer abstrakten Humanität legitimiert, der zuzustimmen nicht sonderlich viel kostet, aber das Gewissen beruhigt.«14
Soll es reibungslos funktionieren, ist das System auf genau jenen Menschentypus angewiesen, den es im Zuge seines Funktionierens ständig und in großer Zahl hervorbringt. Es erzeugt »ein[en] Mensch[en], der unter ein Sachsystem so entschieden subsumiert worden ist, daß Antriebe, die in ihm selbst entspringen, nicht mehr zum Zuge kommen«15. Es erzeugt einen reduzierten, einen entfremdeten Menschen. Gerade die weitgehende Entfremdung (Hegel) aber definiert den Proletarier (Marx). Das Proletariat, wie Marx es kannte, also das des beginnenden industriellen Zeitalters, »bezeichnete die erste Stelle, an der sich das aufscheinende Modell den Menschen schuf, dessen es bedarf«16.
Wenngleich von einem Proletariat im Sinne des 19. Jahrhunderts auch schon zu Freyers Lebzeiten nicht mehr gesprochen werden konnte, behält die im Begriff des Proletariats enthaltene Entdeckung auch angesichts der industriegesellschaftlichen und sozialstaatlichen Entwicklung ihren Wert. Der Begriff, so Freyer, erfahre sogar »eine Steigerung […] ins Prinzipielle«17:
»Das sekundäre System zielt tatsächlich auf den Proletarier hin und erzeugt ihn. Es erzeugt ihn, indem es den Menschen durch seine Funktion im System definiert, indem es ihn darauf reduziert und alles, was er selbst ist, entweder verkümmern läßt oder bagatellisiert …«18
Eine (wahre) Corona-Geschichte
Nennen wir ihn Johannes. Er ist um die 50 und als Selbstständiger in einem kreativen Beruf tätig. Mit anderen Worten: ein Selbstausbeuter. Jemand, der im Grunde immer arbeitet (und in dem es immer arbeitet), nicht nur tagsüber, auch abends, manchmal nachts, in der Regel an Wochenenden und an Feiertagen. Er leistet sich kaum Urlaub, und wenn doch, dann ist diese angeblich schönste Zeit des Jahres für ihn wenig erholsam. Denn er schafft es nicht, in den ein, zwei Wochen, die ihm zur Verfügung stehen, seinen Alltag hinter sich zu lassen, abzuschalten und sich zu regenerieren. Er ist mit seinen Gedanken zu Hause, bei seiner Arbeit, bei seinen Sorgen.
Die berufliche Belastung ist es nicht allein. Johannes hat ein eigenes (noch nicht abbezahltes) schönes altes Haus mit großem Garten. Da ist immer etwas zu tun – und eigentlich müsste noch viel mehr getan werden. An jedem Jahresanfang stellt er eine To-do-Liste zusammen, aber er schafft es nie, sie wenigstens zur Hälfte abzuarbeiten. Der Berg, den er vor sich herschiebt, wird von Mal zu Mal größer.
Im Jahr vor Corona ist Johannes durch einen Todesfall in seiner Familie in eine schwere persönliche Krise geraten. Der schmerzliche Verlust eines ihm außerordentlich wichtigen Menschen hat Dinge wieder aufgewühlt, die er für längst verarbeitet gehalten hatte. Er rutschte in eine Depression, die seine Arbeitsfähigkeit stark beeinträchtigte. Vieles wäre in einer Therapie aufzuarbeiten gewesen, doch dafür fand Johannes keine Zeit. Er biss die Zähne zusammen, auch wenn es ihm immer schwerer fiel.
Johannes ist verheiratet. Mit seiner einige Jahre jüngeren Frau, nennen wir sie Silke, hat er zwei schulpflichtige, präpubertäre Kinder, einen 13-jährigen Jungen und ein 11-jähriges Mädchen. Auch Silke arbeitet in einem kreativen Beruf, ist aber in einem festen Beschäftigungsverhältnis und generiert den größeren Teil ihres gemeinsamen Einkommens; während Johannes’ Einkünfte stark schwanken, bringt Silke einen kalkulierbaren Betrag in die Haushaltskasse.
Tochter Paula ist wohlgeraten. Sie ist ein soziales Wesen par excellence, bei ihren Mitschülern sehr beliebt, gefragter Gast auf fast jedem Kindergeburtstag. Ihre schulischen Leistungen sind überdurchschnittlich und wurden in den Wochen vor der Corona-Krise immer besser. Paula entwickelte einen gesunden Ehrgeiz und ein ausgeprägtes schulisches Engagement, das Eltern wie Lehrer mit Freude registrierten.
Mit Paul verhält es sich etwas anders. So wohlgeraten auch er ist – seinen Eltern bereitet er seit mehreren Jahren große Sorgen. Seine schulischen Leistungen ließen schon in der Grundschule zu wünschen übrig. Jetzt, da er ein Gymnasium besucht, haben sich die Probleme verschärft. Paul ist ein sehr schwacher Schüler, er ist unmotiviert, nicht zu konzentriertem, kontinuierlichem Lernen bereit oder in der Lage. Die Erledigung der Hausaufgaben zum Beispiel ist ein familiärer Stressfaktor erster Güte und füllt oft die Abendstunden gänzlich aus.
Das alles liegt nicht etwa an Pauls mangelnder Intelligenz, im Gegenteil. Er hat mehrere einschlägige Tests, auch bei einem angesehenen Universitätsinstitut, hinter sich, erzielte dort durchweg hervorragende Ergebnisse und gilt in Teilbereichen als hochbegabt, verfügt also über sogenannte Inselbegabungen. Wegen seiner Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten hat er im Lauf der letzten Jahre eine kleine Odyssee hinter sich gebracht: Kinderpsychiater, Ergotherapie, Verhaltenstherapie … Alles ohne erkennbare Wirkung.
Da schon seit Längerem der Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung bestand, sollte kurz vor Beginn der Corona-Krise ein letzter diagnostischer Versuch unternommen werden. Zu diesem Zweck durfte Paul den regulären Schulbesuch für einige Wochen unterbrechen. Stattdessen ging er in eine kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik (in der auch Schulunterricht erteilt wurde). Dort wollte man mit ihm an seinem Sozialverhalten arbeiten sowie die schon eingeleiteten Untersuchungen zum vermuteten (und schließlich bestätigten) Autismus zu Ende führen.
Paul hatte die Einrichtung gerade einmal drei, vier Tage besucht, da bemerkten seine Eltern erstaunt und erfreut bereits positive Effekte: Er war ausgeglichener und entspannter als zuvor, sein Verhalten war berechenbarer und konstruktiver. Paul schien auf einem guten Weg.