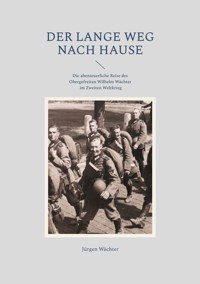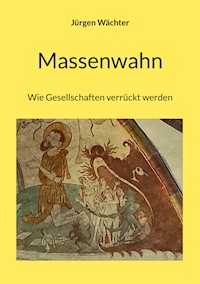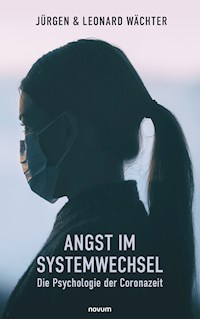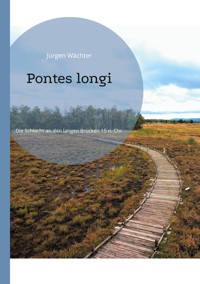
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sechs Jahre nach der Schlacht im Teutoburger Wald geriet 15 n. Chr. erneut eine römische Armee unter General Caecina in einen germanischen Hinterhalt. Das Ereignis wurde von Tacitus als die Schlacht an den langen Brücken, den Pontes longi, geschildert. In den letzten 200 Jahren gab es zahlreiche Theorien, wo in Nordwestdeutschland diese Pontes longi gelegen haben. In diesem Buch werden diese Theorien dargestellt und geprüft, ob sie mit den von Tacitus dargestellten historischen, topographischen und hydrographischen Gegebenheiten übereinstimmen oder verworfen werden müssen. Interessant ist insbesondere ein Gebiet in der Nähe des Varusschlachtortes Kalkriese, das diese Kriterien erfüllen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Bericht des Tacitus
3. Kalkriese als Ausgangspunkt
4. Wo liegt der Teutoburger Wald?
5. Wo trennten sich die Legionen?
6. Trennung an der Hasefurt
7. Was bleibt noch an Möglichkeiten?
8. Ergebnis
9. Literatur
1. Einleitung
Versuche zur Lokalisierung der Varusschlacht hat es in den letzten 400 Jahre in sehr großer Zahl gegeben. Es gibt wohl kaum ein Gebiet Nordwestdeutschlands, das nicht als Schlachtort genannt worden wäre. Wesentlich seltener befassten sich Historiker, Archäologen und Heimatforscher mit dem möglichen Ort der Schlacht an den Pontes longi, den Langen Brücken. Immerhin wäre es den Germanen unter Arminius hier im Jahre 15 n. Chr. fast gelungen, erneut eine römische Armee in Norddeutschland zu besiegen.
Für die wenigen Autoren, die sich mit der Schlacht an den Langen Brücken doch beschäftigten, war eine Verortung schwierig, denn diese musste in enger Verbindung zum Ort der Varusschlacht stehen, da es sich um einen germanischen Angriff auf vier von dort abziehende Legionen unter General Caecina handelte. Da der Ort der Varusschlacht nicht bekannt war, gingen auch die Deutungen zu den Langen Brücken weit auseinander. Dennoch war man zuversichtlich und Otto Dahm meinte 1902, dass die Frage der Örtlichkeit „ohne Zweifel in absehbarer Zeit beantwortet“ werde, „wenn die römisch-germanischen Forschungen im nordwestlichen Deutschland in gleicher Weise fortgesetzt werden, wie sie neuerdings an der Lippe in Angriff genommen sind.“1
Doch auch nach über einem Jahrhundert tappt die Forschung im Dunkeln. Mittlerweile ist mit Kalkriese jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach der Schauplatz der Varuskatastrophe entdeckt und dies macht es einfacher, einen neuen Blick auf die Pontes longi zu werfen. Dies soll hier im Folgenden versucht werden.
Nach einer Schilderung der Römerfeldzüge des Jahres 15 unter Zugrundelegung des Berichtes des Tacitus in Kapitel 2 sind, um einer Lokalisierung der Langen Brücken näher zu kommen, mehrere Aspekte wichtig. Nämlich erstens die Frage, wie sicher wir uns mit Kalkriese als Ort der Varusschlacht sein können. Hierzu werden im Folgenden die relevanten Aspekte knapp wiedergegeben (Kapitel 3).
Als zweiten Aspekt werden wir betrachten, ob Kalkriese mit dem bei Tacitus genannten „saltus teutoburgiensis“ als Ort der Varusniederlage vereinbar ist und um was es sich dabei handeln könnte. Hierzu wird in Kapitel 4 ein Vorschlag gemacht.
Hält Kalkriese der Untersuchung stand, ist in den Kapiteln 5 und 6 die Klärung der Frage notwendig, wo sich im Jahre 15 die Truppen des Germanicus und des Caecina voneinander trennten, um ihre Wege zurück zum Rhein fortzusetzen. Geschah dies an einem Schiffanleger an der Ems oder bereits in der Nähe von Kalkriese? Hierzu werden die bisher vorgetragenen Argumente ausgewertet und modern überprüft. Und es findet eine Diskussion zu den von der Forschung gemachten Vorschlägen zur Örtlichkeit der Schlacht an den Langen Brücken statt.
Ausgehend vom Ort der Varusschlacht und dem Ort der Trennung der Heere lässt sich erstmals eine vorsichtige Eingrenzung der Region vornehmen, die für die Pontes longi in Frage kommt. In Kapitel 7 erfolgt eine geographischnaturkundliche Beschreibung dieser Region und ein Abgleich mit den Angaben bei Tacitus. Daraus lassen sich Vorschläge für zukünftige archäologische Forschungen ableiten.
1 DAHM 1902: 66.
2. Der Bericht von Tacitus
Werfen wir zuerst einen Blick auf die überlieferten historischen Geschehnisse. Nachdem im Jahre 9 n. Chr. drei römische Legionen unter dem Feldherrn Varus von einer Koalition germanischer Stämme unter Arminius nahezu vollständig vernichtet worden waren, überfielen die Germanen auch sämtliche römischen Stützpunkte östlich des Rheins. Lediglich das Kastel Aliso, zu dem auch einige Überlebende der Varusschlacht geflohen waren, hielt den Angriffen stand. Im Winter 9/10 machten die dortigen Römer dann einen Ausfall und brachten sich zum Rhein in Sicherheit. Seitdem waren keinerlei römische Verbände oder sonstige römische Einrichtungen mehr östlich des Rheins vorhanden. Germanien war wieder frei.
Die Römer in der Provinz Niedergermanien brauchten einige Zeit, um sich vor germanischen Angriffen über den Rhein hinweg sicher zu fühlen. Solche erfolgten jedoch nicht. Es brauchte einige Mühe, um durch Aushebungen neue Legionen aufzustellen und die Kastelle am Rhein zu befestigen. Aktionen des römischen Militärs erfolgten erst wieder, als im Jahr 13 n. Chr. Germanicus (Nero Claudius Germanicus, 15 v. Chr. – 19 n. Chr.), Großneffe von Kaiser Augustus, das Oberkommando über die Rheinlegionen übernahm. Um eine Meuterei der Soldaten nach dem Tod von Augustus niederzuschlagen bzw. vorzubeugen, zog er mit ihnen 14 n. Chr., vermutlich vom Kastell Vetera (beim heutigen Xanten) ausgehend, über den Rhein in das Gebiet der Marser, die wahrscheinlich im Gebiet zwischen der Lippe und der Ruhr wohnten. Die Marser hatten sich an den Kämpfen gegen Varus beteiligt und sollten bestraft werden, indem ihr Land und ihre Siedlungen verwüstet und jeder vorgefundene Germane erschlagen wurde. Die Marser waren die ersten, die diese Erfahrung machen sollten. Sie wohnten in geringer Nähe zum Rhein und konnten relativ gefahrlos und ohne lange Anmarschwege überfallen werden.
Im Frühjahr 15 n. Chr. drang Germanicus dann in gleicher Weise von Mainz aus mit acht Legionen in das Gebiet der Chatten ein. Auch hier wurde gemordet, geplündert und zerstört, was möglich war. Mattium, der Hauptort der Chatten, wurde erobert und zerstört. General Caecina besiegte ein Aufgebot der Marser, die den Chatten zu Hilfe kommen wollten. Prorömische Kräfte der Germanen unter Segestes arbeiteten mit Germanicus zusammen, der dadurch die schwangere Frau des Arminius, Thusnelda, in seine Hände bekam.
Der Feldzug gegen die Chatten kann nicht lange gedauert haben, denn Germanicus belies es in diesem Jahr nicht damit, sondern startete im Sommer 15 n. Chr. einen weiteren Feldzug, nun gegen die Brukterer. Lassen wir nun Tacitus sprechen, der diese militärische Aktion sehr detailliert beschrieben hat:
„Und damit nicht die ganze Wucht des Krieges auf einmal hereinbreche, schickte er Caecina mit vierzig Kohorten, um den Feind zu zersplittern, durch das Gebiet der Bructerer an den Fluß Amisia, während die Reiterei der Befehlshaber Pedo durch das Gebiet der Friesen führte. Er selbst fuhr mit vier Legionen, die er auf Schiffe verladen hatte, über die Seen, Fußvolk, Reiterei und Flotte trafen gleichzeitig an dem vorbestimmten Fluß ein. Da die Chauken Hilfstruppen zu stellen versprachen, wurden sie in die Heeresgemeinschaft aufgenommen. Die Bructerer, die selbst ihr Hab und Gut verbrannten, schlug L. Stertinius, den Germanicus mit einer leichten Heeresabteilung abgesandt hatte. Während des Mordens und Plünderns fand er den Adler der neunzehnten Legion, der unter Varus verlorengegangen war. Dann führte er sein Heer weiter bis zu der äußersten Grenze der Bructerer, und das ganze Gebiet zwischen den Flüssen Amisia und Lupia, nicht weit entfernt von dem Teutoburger Wald, in dem, wie es hieß, die Überreste des Varus und seiner Legionen unbegraben lagen, wurde verwüstet.“2
Germanicus zieht danach zum Schlachtfeld des Jahres 9 und bestattet die Überreste der Legionen des Varus. Dies wird von Tacitus näher beschrieben, womit wir uns später befassen wollen.
Recht knapp und ohne Zusammenhänge schildert uns Tacitus dann ein Gefecht zwischen Germanicus und Arminius an einem nicht bekannten Ort.3 Ohne darauf einzugehen, wo sich die Germanen während des Aufenthaltes auf dem Varusschlachtfeld befanden, schreibt er: „Aber Germanicus folgte dem Arminius, der sich in unwegsame Gegenden zurückzog, und befahl der Reiterei, sobald sich Gelegenheit dazu bot, vorzustürmen und dem Feind ein freies Feld, das er besetzt hatte, zu entreißen. Arminius forderte seine Leute auf, sich zusammenzuscharen und an das Waldgelände heranzurücken. Dann machte er plötzlich kehrt und gab den Abteilungen, die er überall in dem Waldgebiet versteckt hatte, das Zeichen zum Hervorbrechen. Jetzt wurde durch die neue Kampffront unsere Reiterei in Verwirrung gebracht, und die herbeigeschickten Reservekohorten, auf die der Strom der Fliehenden prallte, vermehrten noch die Bestürzung. Sie wären in das Sumpfgelände, in dem sich die Siegenden auskannten, während es für die Unkundigen gefährlich war, gedrängt worden, hätte nicht der Caesar die Legionen vorgeführt und zum Kampf aufgestellt. Dies erschreckte den Feind und ermutigte die eigene Truppe. Doch ohne, daß es zu einer Entscheidung kam, trennte man sich.
Dann führte er das Heer an die Amisia zurück und brachte die Legionen zu Schiff, wie er sie hergeführt hatte, wieder zurück. Einen Teil der Reiterei befahl er, entlang der Küste zum Rhein zu marschieren. Caecina, der eine eigene Heeresabteilung führte, erhielt die Weisung, obgleich die Wege, auf denen er den Rückmarsch antreten wollte, bekannt waren, so rasch wie möglich die Langen Brücken hinter sich zu bringen. Dies ist ein schmaler Fußpfad durch ausgedehntes Sumpfgelände, der einst von L. Domitius als Damm aufgeführt worden war. Das übrige Gelände ist morastig, man bleibt dort im schweren Lehmboden hängen, oder Bachläufe machen es nur schwer begehbar. Ringsum stieg das Waldgelände langsam an, das Arminius jetzt dicht besetzte, nachdem er in Eilmärschen auf abgekürzten Wegen dem mit seinem Gepäck und mit Waffen belasteten römischen Heer zuvorgekommen war. Caecina, der unschlüssig war, wie er die im Laufe langer Zeit zusammengebrochenen Bohlenwege wiederherstellen und zugleich den Feind abwehren solle, beschloss an Ort und Stelle ein Lager abzustecken, damit der eine Teil mit der Befestigungsanlage beginnen, der andere dem Kampf aufnehmen könne.
(64) Die Barbaren versuchten, die Postenkette zu durchbrechen und sich auf die Arbeitskommandos zu stürzen; sie forderten sie heraus, umzingelten sie und stürmten auf sie los. Durcheinander ertönte das Geschrei der Arbeitskommandos und der kämpfenden Truppe. Und überall stellten sich die Schwierigkeiten den Römern in den Weg: das grundlose Sumpfgelände, auf dem man nicht fest auftreten konnte und beim Vorwärtsgehen ausglitt, das Gewicht der Panzer, das auf dem Körper lastete, die Unmöglichkeit, im Wasser stehend die Wurfspeere zu schwingen. Dagegen waren die Cherusker an den Kampf im Sumpfgelände gewöhnt, waren hochgewachsen, führten gewaltige Lanzen, mit denen sie auch auf größere Entfernung ihre Gegner verwunden konnten. Erst die Nacht enthob die schon weichenden Legionen dem unter ungünstigen Bedingungen geführten Kampfe.
Die Germanen kannten angesichts ihrer Erfolge keine Müdigkeit. Sie gönnten sich auch jetzt keine Ruhe und leiteten alle Wasserläufe, die von den Anhöhen ringsum herunterkamen, in das tieferliegende Gelände ab. Dieses wurde überschwemmt und die schon fertiggestellten Befestigungsabschnitte verschüttet, wodurch die Mannschaften doppelte Arbeit zu leisten hatten. Es war das vierzigste Dienstjahr, in dem Caecina als Untergebener oder Vorgesetzter stand. Er hatte Erfahrung im Glück und Unglück gesammelt und ließ sich daher nicht in Schrecken versetzen. Und so fand er bei der Erwägung, welche weiteren Maßnahmen zu treffen seien, keinen anderen Ausweg, als den Feind aus dem Walde so lange nicht herauszulassen, bis die Verwundeten und der ganze schwere Tross einen Vorsprung gewonnen hätten. Denn in der Mitte zwischen den Bergen und den Sümpfen zog sich eine Ebene hin, die eine Aufstellung in schmaler Front ermöglichte. Von den Legionen wählte er die fünfte für die rechte, die einundzwanzigste für die linke Flanke, die erste für die Spitze der Marschkolonne, die zwanzigste als rückwärtige Deckung gegen eine etwaige Verfolgung aus.