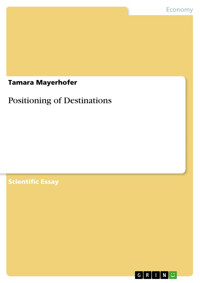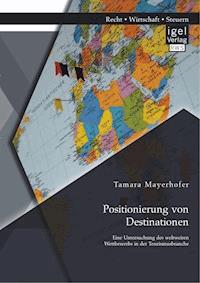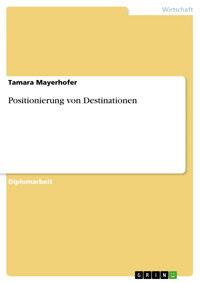
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Tourismus - Sonstiges, Note: 1, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Tourismus & Dienstleistungswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Die gesamte Arbeit basiert auf intensiver Literaturrecherche der Themenbereiche Destinationen, Destinationsmanagement, Tourismusgrundlagenforschung, strategisches Marketing und Management, Tourismusmarketing und Positionierung. Der Theorieteil ist in die Kapitel Destinationen und Destinationsmanagement, Strategisches Marketing, Strategieentwicklung und Positionierung unterteilt. Im Abschnitt Destinationen und Destinationsmanagement werden die grundlegenden Begriffe definiert und aufgearbeitet. Außerdem erfolgt eine Analyse der Angebotsstruktur von Destinationen, die Wertschöpfung und Wertkette von touristischen Regionen wird erörtert und die Stakeholder definiert. Des Weiteren erfolgt eine Diskussion zu den Aufgaben, den Problemstellungen und der Entwicklung von DMOs. Im Kapitel Strategisches Marketing werden zuerst die Market-based und die Resource-based view gegenübergestellt und analysiert. Darauf aufbauend werden die daraus entstandenen Marketingansätze und Wettbewerbsstrategien aufgeführt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Strategieentwicklung und beschreibt die Vorgehensweise anhand verschiedener theoretischer Grundlagen und Instrumente, dazu gehören die Marktanalyse, die Angebotsanalyse, das Stärken-Schwächen-Profil (Ressourcenanalyse), Portfolioanalysen, sowie die Segmentierung. Im letzten theoretischen Kapitel wird das Thema Positionierung erläutert. Neben den allgemeinen Grundlagen werden touristische Modelle ausführlich diskutiert, da diese das Fundament für die empirische Untersuchung bilden. Im empirischen Teil wird auf Basis der touristischen Positionierungsmodelle ein konzeptionelles Modell zur strategischen Positionierung erarbeitet und entsprechende Hypothesen aufgestellt. Die Überprüfung der Hypothesen bzw. des Modells erfolgte durch eine Befragung mittels Onlinefragebogen im November 2009 am Beispiel drei sehr gut positionierter Destinationen im alpinen Raum (Serfaus-Fiss-Ladis, Paznaun mit den Feriendörfern Ischgl, Galtür, Kappl und See, sowie Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg). Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in Kapitel 6 tabellarisch dargestellt und ausführlich diskutiert. Abschließend werden alle theoretischen und praktischen Ergebnisse zusammengefasst. Die Limitationen der Arbeit werden dabei kritisch diskutiert und es wird aufgezeigt in welchen Bereichen in Zukunft noch intensiverer bzw. weiterer Forschungsbedarf notwendig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich während meines Studiums und beim Verfassen dieser Diplomarbeit unterstützt haben.
Besonders bedanken will ich mich bei meiner Betreuerin Frau Dr. Brunner-Sperdin. Ihre fachliche Unterstützung und ihr hilfsbereites Engagement haben diese Arbeit erst möglich gemacht.
Ein großes Dankeschön gilt auch den zahlreichen UnternehmerInnen und teilenehmenden Institutionen aus dem Paznaun, Fiss-Serfaus-Ladis und der Ferienregion Kitzbühel. Jeder einzelne Beitrag der TeilnehmerInnen hat dazu beigetragen, interessante Erkenntnisse im Rahmen der empirischen Studie zu gewinnen.
Vielen Dank auch an alle Studienkollegen und Freunde, für deren unersetzliche Hilfe während (und für die wohlverdienten Ablenkungen außerhalb) des Studiums.
Sehr bedanken will ich mich bei meiner Familie, vor allem bei meinen Eltern Ulli und Walter, für die vertrauensvolle Unterstützung und ihre Geduld mit mir, während meines Studiums und darüber hinaus.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einführung
1.1. Problemstellung
1.2. Zielsetzung
1.3. Vorgehensweise
2. Destinationen und Destinationsmanagement
2.1. Angebotsstruktur einer Destination
2.2. Wertkette einer Destination
2.3. Destinationsmanagement
3. Strategisches Marketing
3.1. Market-based view (MBV) vs. Resource-based view (RBV)
3.1.1. Market-based view (MBV)
3.1.2. Resource-based view (RBV)
3.2. Marketing Ansätze
3.3. Wettbewerbsstrategie
4. Strategieentwicklung
4.1. Marktanalyse
4.2. Angebotsanalyse
4.3. Stärken-Schwächen-Profil (Ressourcenanalyse)
4.4. Portfolioanalysen
4.5. Segmentierung
5. Positionierung
5.1. Destination Competitiveness & Sustainability Model von Ritchie & Crouch (1999, 2000, 2005)
5.2. Destination Competitiveness Model von Dwyer & Kim (2003)
5.3. Diskussion der Theorien und Bildung eines konzeptionellen Modells zur Analyse der Positionierung von Destinationen
6. Empirie
6.1. Forschungsdesign
6.2. Vorgehensweise
6.3. Auswertung und Analyse
6.4. Resultate
7. Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Destinationsbegriff
Abbildung 2: Touristisches Angebot
Abbildung 3: Konzeptionelles Modell des Destinationsprodukts
Abbildung 4: Wertkette einer Destination
Abbildung 5: "Value Fan" einer Wintersportdestination
Abbildung 6: Umfeld der touristischen Wertschöpfungskette
Abbildung 7: touristische Wertschöpfungskette
Abbildung 8: Dienstleistungskette einer Destination
Abbildung 9: Stakeholder im Tourismussystem
Abbildung 10: organisatorische Strukturen Destinationen
Abbildung 11: Tourismusorganisation
Abbildung 12: Die vier Prinzipien für Wettbewerbserfolg von Destinationen
Abbildung 13: Konzeptionelles Modell zur strategischen Managementanalyse einer Wintersportdestination
Abbildung 14: Aufgabe des Marketing
Abbildung 15: Strategisches Marketing - Planungsprozess Destination
Abbildung 16: Market-based View vs. Resource-based View
Abbildung 17: Brachenstrukturanalyse
Abbildung 18: Augmented model for market analysis -Market influences on profitability, risk, and strategy
Abbildung 19: Charakteristika Kernkompetenzen
Abbildung 20: A Resource-Based Approach to Strategy Analysis: A Practical Framework
Abbildung 21: Darstellung der Zusammenhänge von Ressourcen, Fähigkeiten und Wettbewerbsvorteilen
Abbildung 22: Marketing Ansätze
Abbildung 23: Elemente des Destinationsmarketing
Abbildung 24: Illustriertes Beispiel der Komponenten eines Destinationsimage (Nepal)
Abbildung 25: Die Komponenten des Destinationsimages*
Abbildung 26: Wettbewerbsmatrix
Abbildung 27: Generisches Model des 'strategic fit': Vorgeschichte und Konsequenzen
Abbildung 28: Die vier möglichen Szenarien des strategic fit
Abbildung 29: Elemente erfolgreicher Strategien
Abbildung 30: Elemente der Konkurrenzanalyse'
Abbildung 31: Generisches Destinations-Benchmarking Model - adaptiert nach EFQM
Abbildung 32: Angebotspolitik einer Destination
Abbildung 33: Konzeptionelles Servicequalitäts-Modell
Abbildung 34: Angebotsanalyse einer typischen Schweizer Destination
Abbildung 35: SWOT Analyse
Abbildung 36: nachhaltiger ressourcenbasierender Wettbewerbsvorteil
Abbildung 37: Mean-End Struktur der Zielvorgaben
Abbildung 38: A'WOT Resultate der finnisch/deutschen Expertenanalyse
Abbildung 39: BCG-Matrix mit Unternehmensstrategien
Abbildung 40: BCG Matrix
Abbildung 41: 9-Felder-Matrix
Abbildung 42: Destinationslebenszyklus
Abbildung 43: Optionen der Marktsegmentierung und -strategie
Abbildung 44: Möglichkeitenmodell für optimale Positionierung
Abbildung 45: Klassisches Positionierungsmodell
Abbildung 46: Positionierungsmodell für einen Reiseveranstalter
Abbildung 47: Strategische Positionierung einer Destination
Abbildung 48: Model for Sustainability destination competitiveness
Abbildung 49: Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry
Abbildung 50: Detailed depiction of determinants of market competitiveness
Abbildung 51: Destination Competitiveness Model (1999)
Abbildung 52: Conceptual model of destination competitiveness
Abbildung 53: Hauptelemente der Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen
Abbildung 54: konzeptionelles Modell zur Analyse der Positionierung von Destinationen aus Stakeholderperspektive
Abbildung 55: Überprüfung konzeptionelles Modell zur erfolgreichen Positionierung von Destinationen
Abbildung 56: Große Darstellung Destination Competitiveness Model (Crouch & Ritchie 1999, S. 147)
Abbildung 57: Große Darstellung Destination Competitiveness and Sustainability Model (Ritchie & Crouch 2005, S. 63)
Abbildung 58: Große Darstellung Destination Competitiveness Model (Dwyer & Kim 2003, S. 378)
Abbildung 59: Design Online-Fragebogen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Hauptelemente der Segmentierungsvariablen
Tabelle 2: Gegenüberstellung Destination Competitiveness Model (1999) - Destination Competitiveness and Sustainability Model (2005)
Tabelle 3: Übersicht der Indikatoren des Destination Competitiveness Model von Dwyer & Kim (2003)
Tabelle 4: Auswertung Mittelwert, Median, Standardabweichung der empirischen Studie Kategorien I.-V.
Tabelle 5: Auswertung Kategorie VI. Positionierung und unternehmensdemographische Daten
Tabelle 6: Detaillierte Darstellung der Kategorien und Elemente des Destination Competitiveness and Sustainability Model71
Tabelle 7: Detaillierte Indikatorenauflistung des Destination Competitiveness Model von Dwyer & Kim (2003)
Tabelle 8: Ergebnisse multiple lineare Regressionsanalyse
1. Einführung
1.1. Problemstellung
Der weltweite Wettbewerb in der Tourismusbranche nimmt kontinuierlich zu. Die Erschließung neuer Reiseländer bzw. die Erweiterung der bereisbaren Regionen, innovative Informations- und Kommunikationstechnologien, erfahrenere Konsumenten und alternative Reiseprodukte führen zu einer verstärkten Konkurrenzsituation. Die Wettbewerbsfähigkeit hängt nicht nur von ökonomischen, ökologischen, politischen und technologischen Faktoren ab, auch soziale und kulturelle Aspekte sind dabei ausschlaggebend (Ritchie & Crouch, 2005).
Diese Entwicklungen betreffen nicht nur Länder, die ein einer weltweiten Konkurrenz stehen, auch immer mehr kleinere Regionen bzw. Destinationen müssen sich mit strategischen Überlegungen auseinandersetzen, um nachhaltig am Markt bestehen zu können. In der Betriebswirtschaftslehre wird die Wichtigkeit einer Strategie bzw. eines strategischen Marketings immer wieder herausgehoben, eine eindeutige Positionierung am Markt ist dabei ein sehr wichtiges Instrument (Hooley et al., 2004). Positionierungsstrategien ermöglichen nicht nur Unternehmen und Organisationen, sondern auch Destinationen, ein erfolgreiches agieren auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene.
Bei genauerer Analyse dieser Problematik kann man erkennen, dass über einige Forschungsfragen in diesem Themenbereich diskutiert wird.
Zum Einen handelt es sich dabei um die Definition des Destinationsmanagements, die im internationalen Vergleich sehr differierende Formen annehmen kann. Im nordamerikanischen Raum sind Destinationen zumeist Ressorts in Firmenbesitz und alle Bereiche der Wertschöpfung können durch eine Gesellschaft nach außen vertreten und vermarktet werden.
Im europäischen Raum sind jedoch immer noch überwiegend einzelne Unternehmen (zumeist KMUs) zu finden. Zwar bestehen auch Orts- oder Regionalverbunden, aber die Entwicklung und Zusammenschlüsse zu Destinationen muss noch weiter vorangetrieben werden (Flagestad & Hope, 2001).
Durch ein effektives Destinationsmanagement können die Stärken (Ressourcen, Know- how, Budgets, etc. ...) der einzelnen Unternehmungen in und um die Orte/Regionen zusammengefasst werden, um diese dann als Destination durch starke Positionierungsstrategien vermarkten zu können (Althof, 1996; Bieger, 2002; Dettmer, 1999; Fyall 2005; Freyer, 2009).
Es gibt noch nicht viele bzw. ausgereifte Verfahren, um die Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen anhand von Positionierungsmodellen darzustellen. Es werden Modelle aus der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre übernommen. Vor allem Porters generische Wettbewerbsstrategien (1990) sowie seine Branchenstrukturanalyse (1990) werden sehr oft zur Strategiefindung und somit zur daraufhin erfolgenden Positionierung eingesetzt. Dazu werden auch häufig Portfolio Analysen verwendet, wie z.B. die BCG-Matrix, das McKinsey-Portfolio, etc. (Bieger, 2002), aber auch SWOT-Analysen (Hooley et al., 2004).
Es bestehen wenige Frameworks, die ausschließlich für den Tourismus bzw. Destinationen entwickelt wurden. Studien beschäftigen sich bspw. ausschließlich mit der Infrastruktur einer Destination (Prideaux, 2000; Priskin, 2001) oder mit Gästezufriedenheitsbefragungen (Devesa et al., 2009; Ibrahim & Gill, 2006; Murphy et al., 2000; Wu, 2007), aber es fehlt noch an systematischen Analysen sämtlicher wichtiger Attribute (Infrastruktur, Attraktionen, ökologisches und soziokulturelles Umfeld, etc.) einer Destination (Hudson et al., 2004).
Speziell auf Grund der besonderen Merkmale des Destinationstourismus und der Komplexität der Wertschöpfungskette (Bieger, 2002; Steingrube, 2004) - Intangiblität der Services, Simultanität der Erzeugung und des Verbrauchs, Lagerungsunfähigkeit, Schwierigkeiten der Vorhersage der Nachfrage, usw. ... - wird ein Modell zur Erarbeitung der Positionierungsmöglichkeiten durchaus benötigt.
Vielfach wurde aus Sicht der Nachfrage recherchiert und eine Market-based view (MBV) verfolgt, die Resource-based view (RBV) wurde oftmals vernachlässigt. Aber gerade die RBV spielt eine zentrale Rolle, da zumeist ausschließlich die (natürlichen) Ressourcen überhaupt erst die Voraussetzungen für Tourismus schaffen (Althof, 1996; Bieger, 2002; Freyer, 2009), und werden daher in dieser Arbeit auch genauer betrachtet.
Die meisten Autoren (Bieger, 2002; Howie, 2004; Ritchie & Crouch, 2005) sind sich einig, dass nur durch einen „nachhaltigen Tourismus" (sustainable tourism), ein nachhaltiger Erfolg erzielt werden kann, der sich laut WTO (World Tourism Organization) nicht nur auf die Erhaltung der ökologischen Ressourcen bezieht, sondern auch auf den Respekt der Kultur und der Menschen der Gastregion, sowie allen Stakeholdern soziale wie ökonomische Vorteile bietet (WTO, 2002).
Ritchie und Crouch (2005) haben das umfassende theoretische Modell „Destination competitiveness and sustainability" zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen erarbeitet, dass sich vor allem auf die Ressourcen einer Destination konzentriert. Dieses Framework wurde bisweilen nur in einer Studie empirisch von Hudson, Ritchie und Timur im Jahr 2004 untersucht. Bei der in Kanada durchgeführten Untersuchung konnten interessante Erkenntnisse gewonnen werden, da die Studie jedoch nur auf 10 Experteninterviews innerhalb der 13 untersuchten Destinationen limitiert war, wird von den Autoren nicht nur der Aufruf für weitere Studien, sondern auch für weitere Adaptionen des Modells gestartet. Diese Arbeit setzt dies, mit der Aufarbeitung von Theorien und Analyse aktueller Fachartikel und -studien, durch die Entwicklung eines konzeptionellen Frameworks um.
Speziell im Tiroler Tourismus erhält die Thematik der Destinationspositionierung eine zusätzliche Relevanz, da das Angebot an natürlichen Ressourcen sehr homogen ist und die einzelnen Destinationen sich nur durch eine klare Positionierung von der Konkurrenz positiv abgrenzen können.
Der Tourismus in Tirol trägt rund 6,4 % zum BIP von Österreich bei, mit einem generierten Umsatz von 6 Milliarden Euro. Fast 25.000, überwiegend kleine- und mittlere Unternehmen leben von und investieren in den Tiroler Tourismus, womit auch noch etwa 35.000 Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden (Tirol Werbung, 2005).
Diese Diplomarbeit soll interessante Erkenntnisse für die Praxis, als auch für die Theorie aufzeigen, da bis zu diesem Zeitpunkt die Kriterien zur erfolgreichen Positionierung, und dem damit nachhaltigen Erfolg einer Destinationen aus einer RBV, noch nicht ausführlich erforscht sind (Ritchie & Crouch, 2000; Hudson et al., 2004).
Bedingt durch diese Feststellungen wird in der Diplomarbeit folgende Forschungsfrage erörtert:
Nach welche Kriterien werden Positionierungsstrategien in Destinationen entwickelt, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
1.2. Zielsetzung
Durch die Analyse der relevanten Literatur und der Durchführung einer empirischen Studie, sollen hilfreiche Erkenntnisse für die betroffenen Stakeholdergruppen der jeweiligen Destination aufgezeigt werden, damit diese trotz homogener Marktstruktur und intensiver Konkurrenzsituation, eine effektive (Re-)Positionierungsstrategie verfolgen können, um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Dies könnte in Zukunft Destinationen mit ähnlicher Homogenität der Ressourcen die Positionierungsfindung erleichtern bzw. eine effektive Repositionierungsstrategie aufzeigen. Wie bereits in der Problemstellung beschrieben, soll durch diese Arbeit auch ein wertvoller Beitrag für die Theorie erarbeitet werden. Die Analyse der Ressourcen einer Region aus Stakeholdersicht, soll die Entwicklung eines Modells zur erfolgreichen und nachhaltigen Positionierung von Destinationen ermöglichen.
1.3. Vorgehensweise
Die gesamte Arbeit basiert auf intensiver Literaturrecherche der Themenbereiche Destinationen, Destinationsmanagement, Tourismusgrundlagenforschung, strategisches Marketing und Management, Tourismusmarketing und Positionierung. Der Theorieteil ist in die Kapitel Destinationen und Destinationsmanagement, Strategisches Marketing, Strategieentwicklung und Positionierung unterteilt. Im Abschnitt Destinationen und Destinationsmanagement werden die grundlegenden Begriffe definiert und aufgearbeitet. Außerdem erfolgt eine Analyse der Angebotsstruktur von Destinationen, die Wertschöpfung und Wertkette von touristischen Regionen wird erörtert und die Stakeholder definiert. Des Weiteren erfolgt eine Diskussion zu den Aufgaben, den Problemstellungen und der Entwicklung von DMOs. Im Kapitel Strategisches Marketing werden zuerst die Market-based und die Resource- based view gegenübergestellt und analysiert. Darauf aufbauend werden die daraus entstandenen Marketingansätze und Wettbewerbsstrategien aufgeführt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Strategieentwicklung und beschreibt die Vorgehensweise anhand verschiedener theoretischer Grundlagen und Instrumente, dazu gehören die Marktanalyse, die Angebotsanalyse, das Stärken-Schwächen-Profil (Ressourcenanalyse), Portfolioanalysen, sowie die Segmentierung.
Im letzten theoretischen Kapitel wird das Thema Positionierung erläutert. Neben den allgemeinen Grundlagen werden touristische Modelle ausführlich diskutiert, da diese das Fundament für die empirische Untersuchung bilden.
Im empirischen Teil wird auf Basis der touristischen Positionierungsmodelle ein konzeptionelles Modell zur strategischen Positionierung erarbeitet und entsprechende Hypothesen aufgestellt.
Die Überprüfung der Hypothesen bzw. des Modells erfolgte durch eine Befragung mittels Onlinefragebogen im November 2009 am Beispiel drei sehr gut positionierter Destinationen im alpinen Raum (Serfaus-Fiss-Ladis, Paznaun mit den Feriendörfern Ischgl, Galtür, Kappl und See, sowie Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg).
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in Kapitel 6 tabellarisch dargestellt und ausführlich diskutiert.
2. Destinationen und Destinationsmanagement
Der international anerkannte Begriff Destination[1] setzt sich vermehrt im deutschsprachigen Raum durch, und ersetzt zunehmend die ursprünglichen Bezeichnungen, wie Reiseziel oder Zielgebiet (vgl. Freyer 2009, S. 258).
Im einfachsten Sinne kann eine Destination als geographische Regionen (Meliän- Gonzälez & Garcfa-Flacön 2003, S. 720) bezeichnet werden, es gibt jedoch eine Vielzahl an ausführlicheren Definitionen.
Beispielsweise beschreibt Freyer (2009) touristische Destinationen als „ ... geographische, landschaftliche, soziokulturelle oder organisatorische Einheiten mit ihren Attraktionen, für die sich Touristen interessieren."
Eine Destination kann sowohl nach Größe, als auch nach Entfernung (Reisedistanz), abgegrenzt werden, dies umfasst von einzelnen Resorts, über ganze Region, bis hin zu Ländern oder gar Kontinenten (vgl. Freyer 2009, S. 266). Dies bezeichnet Bieger (2007) auch als Orientierung nach den Bedürfnissen aus Gästesicht, wie in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1: Destinationsbegriff[2]
Der Gast selbst, definiert dabei den geographischen Raum, den er als Reiseziel und somit als Destination bestimmt (vgl. Luft 2007, S. 21).
Somit sieht beispielsweise ein Japaner den Kontinent Europa als Destination, im Gegensatz zu einem Österreicher, für welchen ein Thermen-Resort in einem anderen Bundesland, eine Destination darstellen kann (vgl. Freyer 2009, S. 266; vgl. Buhalis 2000, S. 97).
Eine Destination kann dabei als ein Amalgam von individuellen Produkten und Erfahrungsmöglichkeiten definiert werden, welches das umfassende Tourismuserlebnis ausmacht (Murphy et al. 2000, S. 44).
Howies (2003) detailliertere Definition jedoch beschreibt Destinationen als Plätze, die für Touristen von Interesse sind, und um dieses auf lange Frist zu halten und erfolgreich am Markt bestehen zu können, müssen Destinationen „entwickelt" werden. So sollten Ressourcen in Attraktionen verwandelt werden, umfassende Unterbringungsmöglichkeiten, sowie eine umfassende Infrastruktur, zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollten alle touristischen Entwicklungen in die regionale Entwicklung bestmöglich integriert werden um einen nachhaltigen Erfolg zu garantieren (vgl. Howie 2003, S. 71). Buhalis (2000) definiert eine Destination, als eine geographische Region, welche von den Gästen als einzigartige Entität wahrgenommen wird. Dazu verfügen diese Reiseziele über politische und legislative Rahmenbedingungen, die sowohl das Tourismusmarketing, als auch die Planung ermöglichen.
Pechlaner (2009) beschreibt Destinationen als „ ... prozessorientierte, auf den Wettbewerb ausgerichtete Netzwerke des Tourismus, verstanden als strategische Produkt/Markt-Kombinationen, wobei der kundenorientierte Fokus hervorgehoben wird.". Im Gegensatz zu anderen Begriffserklärungen involviert Pechlaner sowohl die Netzwerk-, als auch die Prozesstheorie.
Die detaillierte und weithin anerkannte Definition, auf welche sich diese Arbeit beruft, ist von Bieger (2008) und beschreibt eine Destination als:
„Geographischer Raum (Ort, Region, Weiler), den derjeweilige Gast (oder ein Gästesegment) als Reiseziel auswählt. Sie enthält sämtliche für einen Aufenthalt notwendigen Einrichtungen für die Beherbergung, Verpflegung, Unterhaltung/Beschäftigung. Sie ist damit Wettbewerbseinheit im Incoming Tourismus, die als strategische Geschäftseinheit geführt werden muss."
Im nächsten Abschnitt werden die Angebotsstrukturen von bzw. das Produkt Destination diskutiert, dazu werden Definitionen angeführt und erläutert, sowie entsprechende Modelle graphisch dargestellt und besprochen.
2.1. Angebotsstruktur einer Destination