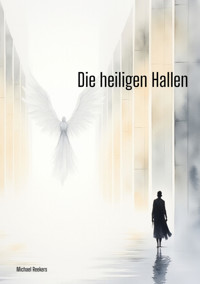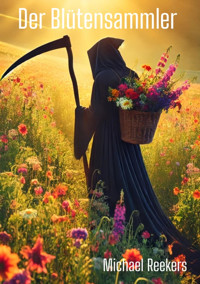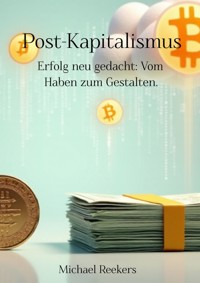
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch denkt weiter, wo der Kapitalismus an seine Grenzen stößt. Es analysiert systemisch – nicht moralisch. Es zeigt auf, wie ökonomische Machtverhältnisse, digitale Kontrolle und politische Einflussnahme zusammenspielen – und warum strukturelle Ungleichheit kein Zufall, sondern Funktion des Systems ist. Mit dem eigenen Lohnmodell wird ein konkreter Reformvorschlag entwickelt, der soziale Spaltung begrenzt, demokratische Teilhabe stärkt und ökologische Verantwortung integriert. Das Buch verbindet ökonomische Theorie mit gesellschaftlicher Praxis – und argumentiert, warum gerechtere Verhältnisse nicht nur möglich, sondern notwendig sind. Fundiert durch über 100 wissenschaftliche Quellen, inspiriert von Ansätzen wie Doughnut Economics, Gemeinwohlökonomie und postkapitalistischer Eigentumstheorie, liefert dieses Werk keine Utopie, sondern eine Einladung: zur Neuausrichtung unseres Wirtschaftens – radikal pragmatisch, systemisch solidarisch. Für Leser:innen, die verstehen wollen, warum das "Maßhalten" keine Schwäche ist, sondern die stärkste Antwort auf eine Welt am Limit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Verantwortlich für den Inhalt gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Michael Reekers
Konstanzerstr. 76A
8280 Kreuzlingen
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Website: https://authentic-advice.ch
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Haftung für Inhalte:
Die Inhalte dieses Buches wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Beiträge stellen die persönliche Meinung des Autors dar und erheben keinen Anspruch auf absolute Wahrheit oder Unfehlbarkeit. Sie dienen der öffentlichen Debatte, nicht der abschließenden Urteilsbildung.
Haftung für Links:
Sofern in diesem Buch auf externe Websites verwiesen wird, liegt die Verantwortung für deren Inhalte ausschließlich bei den jeweiligen Betreibern. Der Autor distanziert sich ausdrücklich von sämtlichen Inhalten verlinkter Seiten und übernimmt dafür keine Haftung.
Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses Buches, einschließlich Texte, Konzepte und Struktur, sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors, sofern nicht gesetzlich anders geregelt.
Autorenvita
Michael Reekers , geboren 1975 in Melle (Niedersachsen), lebt heute in der Schweiz. Er ist Pflegefachmann mit einem Bachelor in Social Management und studiert im zweiten Bildungsweg Philosophie. Reekers verbindet sozialwissenschaftliche Analyse mit praktischer Berufserfahrung im Gesundheitswesen sowie einem tiefen Interesse an gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Seine Texte bewegen sich an der Schnittstelle von Theorie und Alltag, oft geprägt von einem essayistischen Stil, kritischer Empathie und dem Anspruch, Denkgewohnheiten zu hinterfragen.
Mit „Post-Kapitalismus – Erfolg neu gedacht: Vom Haben zum Gestalten.“ legt er ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue Gesellschaftsordnung vor – radikal, konstruktiv und fundiert.
Post-Kapitalismus
Erfolg neu gedacht:
Vom Haben zum Gestalten.
Michael Reekers
Inhalt
1 Prolog: Der Kapitalismus am Ende seiner Zeit ..................................................... 10
2 Eine kurze Geschichte des Geldes: Von Muscheln zur Datenbank ........................ 12
2.1 Vom Tausch zur Repräsentation ................................................................... 12
2.2 Metall, Macht und Vertrauen ........................................................................ 12
2.3 Papier, Kredit, Algorithmus .......................................................................... 13
2.4 Historische Entwicklung des Kapitalismus: Von der Befreiung zur Blockade .. 14
2.4.1 Fortschrittsphase (18.–20. Jahrhundert) ................................................ 14
2.4.2 Krisenphase (ab 1970er Jahre) .............................................................. 14
2.4.3 Scheitern sozialstaatlicher Korrekturen (Keynesianismus vs.
Neoliberalismus) .................................................................................. 15
2.4.4 Globale Perspektive: Kolonialismus und Externalisierung von Kosten ..... 15
2.5 Systemische Schwächen des Kapitalismus .................................................. 15
2.5.1 Strukturelle Ungleichheit ...................................................................... 16
2.5.2 Externalisierung von Kosten .................................................................. 16
2.5.3 Demokratiedefizite ............................................................................... 17
2.5.4 Unterschied Kapitalismus vs. soziale Marktwirtschaft ........................... 17
2.5.5 Digitaler Kapitalismus und Plattformökonomie ...................................... 17
3 Warum der Kapitalismus eine Neuausrichtung braucht ....................................... 19
3.1 Forschungsfrage ......................................................................................... 19
4 Alternative Modelle: Vom Grundeinkommen zum 3:1-Prinzip ............................... 20
4.1 Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ................................................... 20
4.2 Das 3:1-Lohnmodell .................................................................................... 20
4.3 Kritische Fragen und Herausforderungen: .................................................... 22
4.3.1 Ergänzungen: Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen ...................... 23
5 Kapitalflucht im Post-Kapitalismus: Übergangsphänomen oder strukturelles
Problem? ........................................................................................................... 24
5.1 Warum der Kapitalismus historisch funktional war ....................................... 25
5.2 Vom Aufstiegsversprechen zur Reproduktionsmaschine ............................... 26
5.3 Warum die Zeit reif scheint – und trotzdem zögert ......................................... 27
5.3.1 Systemische Legitimation durch kognitive Dissonanz ............................ 28
5.3.2 Symbolische Exklusion durch Statuskultur ............................................ 29
5.4 Die große Erzählung vom Wert: Wie Geld unsere Wahrnehmung kolonisiert ... 29
5.5 Status, Leistung und das Missverständnis von Wert ...................................... 31
5.6 Der Mythos der Exklusivität .......................................................................... 32
5.7 Gesundheitsversorgung wird segmentiert, um Klassenstrukturen zu
reproduzieren ................................................................................................. 33
5.8 Warum Menschen lieber gegen Gleichheit stimmen, als den Kapitalismus
infrage zu stellen .................................................................................................... 35
5.9 Planetare Grenzen: Warum Kapitalismus kein ökologisch stabiles System sein
kann ............................................................................................................... 36
5.10 Jenseits der Wachstumslüge: Ökologische Gerechtigkeit als Systemfrage ..... 37
6 Das Maß des Menschen: Das 3:1-Modell als neue gesellschaftliche Grundlage .... 39
6.1 Grundeinkommen als Anker, Lohnverhältnis als Grenze................................ 40
6.2 Keine Gleichmacherei, sondern funktionale Verhältnismäßigkeit .................. 41
6.3 Symbolische Entwaffnung des Statusdenkens ............................................. 43
7 Besitz, Erbschaft, Kapital – Warum Geld Grenzen braucht .................................... 46
7.1 Wenn Kapital schneller wächst als die Welt – Der systemische Bruch zwischen
Vermögen und Wert ............................................................................................... 47
7.2 Lohn reicht nicht: Kapital muss eingebunden werden ................................... 48
7.3 Erbschaften als Systemwiederherstellung – und ihre Begrenzung .................. 49
8 Eigentum, Wachstum und Verantwortung – Warum auch Unternehmen Grenzen
brauchen ............................................................................................................... 51
8.1 Wachstum ja – aber mit Maß ........................................................................ 51
8.2 Eigentumsbegrenzung als Systempflege ...................................................... 52
8.3 Kapitalbeteiligung an alle statt an wenige ..................................................... 53
8.4 Die Wirkung: Innovation ohne Raubbau ........................................................ 54
8.5 Wirtschaft als Teil der Demokratie................................................................ 54
8.6 Wie Vermögen zu Gemeinwohl werden kann ................................................ 55
9 Kapitalismus, digitale Oligarchie und die systemische Aushöhlung der Demokratie ..
.......................................................................................................................... 56
9.1 Strukturelle Korruption: Legalisiert und institutionalisiert ............................. 57
9.2 Der Markt als Ersatzdemokratie: Finanzmärkte statt Volkssouveränität ......... 58
9.3 Plattformkapitalismus: Die digitale Schattenverfassung ............................... 59
9.3.1 Oligarchische Verzerrung: Wenn Reichtum über Politik entscheidet ....... 59
9.3.2 Gegenstrategien: Demokratischer Widerstand und institutionelle
Reformen ............................................................................................. 60
9.4 Systemfrage des 21. Jahrhunderts ............................................................... 61
10 Die Psychologie der Reflexe: Warum Wandel nicht nur Idee, sondern Reife
braucht .......................................................................................................... 63
10.1 Angst vor Veränderung als Systemverteidiger ............................................... 64
10.2 Kognitive Dissonanz und das Festhalten an gewohnten Lügen ...................... 65
10.2.1 Wir halten an Lügen fest, wenn die Wahrheit zu teuer wird. .................... 66
10.2.2 Der Reflex, anderen nichts zu gönnen – und was das mit uns macht ....... 67
11 Das Scheitern des 12:1 – und warum 3:1 mehr ist als nur die nächste Stufe ...... 69
11.1 Warum die Schweizer Initiative unterging ..................................................... 70
11.2 Die Illusion der Leistungs-Gerechtigkeit ....................................................... 71
11.3 Warum der nächste Versuch ein anderes Narrativ braucht ............................ 73
12 Unternehmen als Hebel – Wie KMU den Wandel vorantreiben können .............. 74
Der psychologische Hebel: Selbstwirksamkeit statt Moral ................................... 74
12.1 Die 3:1-Charta – freiwillig, verbindlich, transformativ .................................... 74
12.2 Der Weg in die Breite: Vom Pionier zur Bewegung ......................................... 75
12.3 Beziehung statt Kontrolle: Psychologische Reifung im Unternehmerdenken .. 76
12.4 Widerstand und Transformationsintelligenz ................................................. 76
12.5 Was gewonnen wird .................................................................................... 76
13 Umsetzungsstrategien: Vom Ist- zum Soll-Zustand .......................................... 78
13.1 Politische Maßnahmen: Vom Steuerrecht zur Strukturreform ........................ 78
13.2 Wirtschaftliche Anreize: Genossenschaften und Gemeinwohl als Motor ....... 78
13.3 Kultureller Wandel: Bildung, Medien und Erzählung ...................................... 79
13.4 Übergänge gestalten: Schockvermeidung und systemische Sicherheit .......... 79
13.5 Die Rolle des Staates: Hüter des Rahmens oder aktiver Mitgestalter?............ 79
14 Bildung als Bedingung: Warum Aufklärung ohne Reife nichts verändert............. 80
14.1 Wissen ist nicht genug – es braucht Bewusstheit .......................................... 81
14.2 Warum ein gerechteres System nicht funktioniert, wenn Menschen nicht dafür
bereit sind ................................................................................................... 83
14.3 Die Architektur des Wandels: Wie man ein System umbaut, ohne es zu
sprengen .................................................................................................... 84
15 Widerstand von oben: Was passiert, wenn die Besitzenden ihre Macht verlieren86
15.1 Erwartbare Gegenargumente – und ihre kulturelle Kraft ................................ 87
15.2 Die Verteidigung des Selbstbilds durch Systemerhalt ................................... 88
15.3 Warum jede große Veränderung mit Angst beginnt ........................................ 90
16 Vom Konkurrenzdenken zur Beziehungsfähigkeit .............................................. 92
17 . Machtstrategien des Wandels: Streik, ziviler Ungehorsam und kollektive
Selbstermächtigung ........................................................................................ 94
17.1 Streik: Der ökonomische Reflex der Selbstachtung ....................................... 94
17.1.1 Ziviler Ungehorsam: Wenn Legalität Legitimität verliert .......................... 94
17.1.2 Selbstorganisation: Die strukturelle Antwort auf Machtmonopole .......... 96
17.1.3 Widerstand als Voraussetzung für demokratische Erneuerung ............... 96
17.2 Was wir verlernen müssen: Vergleich, Status, Dominanz .............................. 97
17.2.1 Vergleich ............................................................................................. 97
17.2.2 Status .................................................................................................. 97
17.2.3 Dominanz ............................................................................................ 98
17.3 Eine Gesellschaft, die Maß halten will, muss zuerst Maß an sich selbst
nehmen. ..................................................................................................... 98
17.4 Was wir brauchen: Vertrauen, Maß, Empathie .............................................. 98
17.4.1 Vertrauen ............................................................................................. 99
17.4.2 Maß ..................................................................................................... 99
17.4.3 Empathie ............................................................................................. 99
17.5 Warum das System sich nur ändern kann, wenn wir uns ändern .................. 100
18 Die Charta der Zukunft – Verantwortung vernetzen, bevor Gesetze greifen ...... 102
18.1 Historische Parallelen ............................................................................... 102
18.2 Psychologische Grundlagen: Kohärenz und Commitment ........................... 102
18.2.1 Architektur und Mechanismen ............................................................ 103
18.2.2 Der strategische Hebel: Kooperation unter Innovator:innen ................. 103
19 Ein realistischer Weg in die postkapitalistische Ära ........................................ 104
19.1 Offene Fragen: Revolution oder Evolution? ................................................. 104
19.2 Ist globale Umsetzung möglich? ................................................................ 104
19.3 Handlungsempfehlungen .......................................................................... 105
19.4 3:1 ist kein Ziel – es ist der Anfang .............................................................. 106
20 Epilog: Vielleicht ist es noch nicht so weit ...................................................... 107
20.1 Warum wir diesen Text jetzt schreiben, obwohl der Moment noch zögert ..... 107
20.2 Warum Maß kein Rückschritt ist, sondern Fortschritt .................................. 108
20.3 Eine Einladung an die, die spüren, dass das Maß voll ist .............................. 109
21 Literaturverzeichnis ...................................................................................... 111
1Prolog:
Der Kapitalismus am Ende seiner Zeit
Der Kapitalismus, wie wir ihn heute erleben, ist nicht das Versprechen, das er einst war, und erst recht nicht die Notwendigkeit, als die er sich selbst immer noch ausgibt. Ursprünglich als Reaktion auf die Starrheit feudaler Ordnungen und die Arbitrarität absolutistischer Machtverhältnisse entstanden, stellte er zunächst tatsächlich eine historisch progressive Kraft dar: Er ermöglichte Eigentum jenseits von Geburt, verknüpfte individuelle Anstrengung mit sozialem Aufstieg, schuf durch Märkte eine Dynamik, die Innovationen freisetzte, und ließ durch die Entfesselung von Produktion erstmals in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit entstehen, dass Überfluss nicht nur eine Ausnahme, sondern ein systemischer Zustand sein könnte (Polanyi, 1944/2001; Landes, 1998). Die Entstehung des modernen Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert, das Aufkommen freiheitlich-demokratischer Ideen in Zusammenhang mit Eigentumsrechten und die damit verbundene Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft wären ohne kapitalistische Ökonomien ebenso wenig denkbar wie das Industriezeitalter selbst (Weber, 1905/2001).
Doch was damals als historische Befreiung empfunden wurde, hatte seinen Preis – einen Preis, der sich über Generationen kumulierte und heute, im Spätstadium kapitalistischer Logik, zur systemischen Hypothek geworden ist. Schon im 19. Jahrhundert beschrieben Denker wie Karl Marx oder John Stuart Mill die strukturelle Tendenz zur Ungleichverteilung von Kapital, zur Akkumulation von Eigentum in den Händen weniger und zur Entwertung menschlicher Arbeit durch die Mechanismen des Marktes (Marx, 1867/2005; Mill, 1848/2004). Die Industrialisierung brachte nicht nur Fortschritt, sondern auch Ausbeutung, nicht nur Maschinen, sondern Massenelend, nicht nur Fabriken, sondern Fabrikbrände. Die Entstehung der Arbeiterbewegung war kein Zufall, sondern eine historisch notwendige Korrektur auf ein System, das Wachstum nicht an soziale Verträglichkeit koppelte, sondern ausschließlich an Rentabilität.
Im 20. Jahrhundert, unter dem Eindruck zweier Weltkriege und der weltweiten Depression von 1929, entstanden sozialstaatliche Gegenmodelle: Die New-Deal-Politik in den USA, der Wohlfahrtsstaat in Westeuropa, das System der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Doch diese Korrekturen waren nicht systemüberwindend – sie waren systemstabilisierend. Sie erkauften Frieden durch Konsum, Integration durch Kredit, Zugehörigkeit durch Beschäftigung. Und solange Wirtschaftswachstum und Ressourcenexpansion Hand in Hand gingen, funktionierte dieses Modell erstaunlich gut – zumindest für die industrialisierten Nationen des globalen Nordens (Esping-Andersen, 1990; Streeck, 2014).
Doch seit den 1970er Jahren ist ein schleichender, inzwischen dramatischer Strukturwandel zu beobachten. Die Finanzialisierung der Ökonomie, also die Ablösung realwirtschaftlicher Produktion durch spekulative Kapitalströme, die
10
zunehmende Entkopplung von Lohn und Produktivität (Mishel & Bivens, 2021), die globale Deregulierung von Arbeits- und Finanzmärkten sowie die Schwächung organisierter Arbeiterschaft durch Gewerkschaftszerschlagung – etwa unter Reagan in den USA oder Thatcher in Großbritannien – haben dazu geführt, dass der Kapitalismus heute nicht mehr das Versprechen auf Beteiligung erfüllt, sondern sich zunehmend als Instrument sozialer Segmentierung und politischer Entdemokratisierung erweist (Harvey, 2005; Crouch, 2011). Während technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung theoretisch den Zugang zu Bildung, Kommunikation und kultureller Teilhabe für alle Menschen erleichtern könnten, hat sich faktisch eine neue Klasse von Plattformkapitalisten etabliert, deren Akkumulationsdynamiken sich jeder nationalstaatlichen Kontrolle entziehen (Srnicek, 2017).
Gleichzeitig geraten fundamentale Lebensbereiche – Gesundheit, Pflege, Wohnen, Energie, Bildung – unter die Logik marktwirtschaftlicher Effizienz. Dabei zeigt sich in der Praxis: Was betriebswirtschaftlich optimiert wird, funktioniert gesellschaftlich oft schlechter. Die Privatisierung der Altersvorsorge hat Altersarmut nicht verhindert. Die Auslagerung von Pflege in prekarisierte Subsysteme hat weder Menschlichkeit noch Nachhaltigkeit befördert. Und der Wohnungsmarkt, längst zur Spekulationsfläche degradiert, produziert keine Wohnungen für Menschen, sondern Assets für Portfolios (Aalbers, 2016).
Was wir erleben, ist keine funktionale Krise, sondern ein zivilisatorischer Erschöpfungszustand. Die massive Zunahme psychischer Erkrankungen, insbesondere bei jungen Menschen (OECD, 2021), der Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, die Radikalisierung politischer Ränder – all das sind keine „Nebenwirkungen“, sondern systemimmanente Folgen einer Wirtschaftsform, die Menschen zunehmend als Kostenfaktor, Märkte als Naturgesetz und Gewinn als anthropologische Konstante begreift.
Die Frage lautet also nicht mehr: Wie retten wir den Kapitalismus? Sondern: Was kommt danach – und wann beginnen wir, es zu denken?
11
2Eine kurze Geschichte des Geldes: Von Muscheln zur
Datenbank
Geld ist kein Naturphänomen – es wächst nicht auf Bäumen, folgt keinen Naturgesetzen und ist nicht „einfach da“. Vielmehr ist es eine soziale Technologie, die von Menschen geschaffen wurde, um komplexe Beziehungen zu strukturieren: zur Organisation von Vertrauen, zur Erleichterung von Tausch und zur Verwaltung von Schuld (Graeber, 2011, S. 21). Diese Funktionen waren niemals neutral, sondern tief eingebettet in kulturelle, politische und moralische Ordnungen. Geld entscheidet darüber, wer zählt, wer bekommt, wer schuldet – und damit, wer Macht hat.