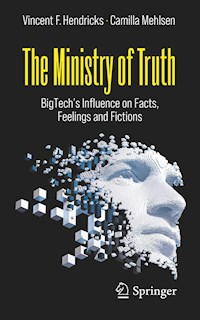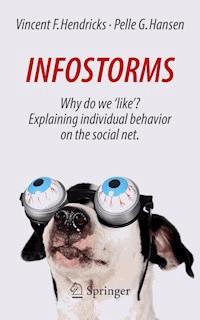17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Eine Demokratie befindet sich in einem postfaktischen Zustand, wenn politisch opportune, aber faktisch irreführende Behauptungen anstatt Fakten als Grundlage für die politische Debatte, Meinungsbildung und Gesetzgebung dienen. Wer diese Entwicklung bremsen will, muss verstehen, was sie verursacht.«
Mit Macht dringen populistische Aussagen, alternative Tatsachen und Fake News in die öffentliche Debatte ein. Desinformation hat sich so ausgeweitet, dass wir alle uns dazu verhalten müssen – Politiker, Journalisten und Bürger. Im Zeitalter der Information ist Aufmerksamkeit gleichzusetzen mit Geld, Macht und Einfluss, auch wenn das auf Kosten von Tatsachen geschieht.
Mit ihrem Bestseller Postfaktisch legen die Philosophen Vincent F. Hendricks und Mads Vestergaard eine zusammenhängende Analyse der Mechanismen vor, die uns etwas als wahr betrachten oder empfinden lassen. Ihr Buch beschreibt die Entwicklung hin zu einer postfaktischen Demokratie und benennt die Gewinner und Verlierer der neuen Aufmerksamkeitsökonomie. Ein eindringlicher Weckruf zu einer Zeit, da die „Wirklichkeit“ zunehmend eine Frage von Klickzahlen scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Mit ihrem Bestseller Postfaktisch legen die Philosophen Vincent F. Hendricks und Mads Vestergaard eine zusammenhängende Analyse der Mechanismen vor, die uns etwas als wahr betrachten oder empfinden lassen. Ihr Buch beschreibt die Entwicklung hin zu einer postfaktischen Demokratie und benennt die Gewinner und Verlierer der neuen Aufmerksamkeitsökonomie. Ein eindringlicher Weckruf zu einer Zeit, da die »Wirklichkeit« zunehmend eine Frage von Klickzahlen scheint.
Zu den Autoren
Vincent F. Hendricks, Jahrgang 1970, ist Professor für Formale Philosophie und Direktor des Center for Information and Bubble Studies (CIBS) an der Universität Kopenhagen. Für seine Forschung wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Elite Research Prize des dänischen Forschungsministeriums.
Mads Vestergaard ist Doktorand am Center for Information and Bubble Studies (CIBS) der Universität Kopenhagen, wo er seinen Master in Philosophie machte. Darüberhinaus ist er u.a. Gründer und ehemaliger Vorsitzender der »Nihilistischen Volkspartei«, einem dänischen Kunst- und Satireprojekt.
Vincent F. Hendricks
Mads Vestergaard
POSTFAKTISCH
Die neue Wirklichkeit
in Zeiten von Bullshit,
Fake News und
Verschwörungstheorien
Aus dem Dänischen
von Thomas Borchert
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Karl Blessing Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-23013-5V001
www.blessing-verlag.de
INHALT
Vorwort
Einleitung
1 Aufmerksamkeitsökonomie
2 Der Nachrichtenmarkt
3 Aufmerksamkeitsspekulation und politische Blasen
4 Alternative Fakten, Desinformation und Fake News
5 Faktenresistenz, Populismus und Verschwörungstheorien
6 Die postfaktische Demokratie
Dank
Literaturhinweise
Anmerkungen
Vorwort
Dieses Buch handelt nicht von Donald J. Trump. Allerdings waren die Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika am 8. November 2016 und Trumps spektakulärer Wahlkampf mit ausschlaggebend dafür, dass Schreibtisch und Kalender im Frühjahr 2017 diesem Buch gewidmet wurden. Auch wenn wir Donald Trump, dem König der Aufmerksamkeit, hier viel Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, geht es in Postfaktisch nicht um Trump. Wir versuchen auch nicht, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahlen in den USA erschöpfend zu erklären. Dieses Buch ist in seiner Absicht etwas bescheidener. Unter anderem geht es uns um das Informationsmilieu, die Marktkräfte, die politischen Strategien und die psychologischen Faktoren, die zur Wahl Donald Trumps beigetragen haben. Außerdem versuchen wir in Postfaktisch,generell die Bedingungen, unter denen man heutzutage in Aufmerksamkeit spekuliert und die letztendlich zu einer postfaktischen Demokratie führen können, zusammenhängend zu analysieren.
In einer postfaktischen Demokratie, egal von welcher Demokratie die Rede ist, bilden Fakten und Tatsachen nicht länger die Grundlage der geführten Politik, sodass die Bürger in der postfaktischen Demokratie auf längere Sicht die Verlierer sind.
Neue Technologien schaffen neue Bedingungen und andere Möglichkeiten für die Vermittlung von Information, für den Journalismus und für die Kommunikation politischer Botschaften. Im Gegensatz zur Hoffnung und Vision von Philosoph Francis Bacon (1561–1626), ist technologischer Fortschritt jedoch nicht gleichbedeutend mit menschlichem Fortschritt. Technologischer Fortschritt bedeutet wiederum auch nicht menschlicher Verfall, wie romantische Kulturpessimisten meinen. Es liegt alleine an uns. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Technologie nicht uns Menschen kontrolliert. Der Einfluss und die Bedeutung der neuen Technologie für unsere Wirklichkeit und unsere Gesellschaft lokal und letztendlich auch global hängen davon ab, wie wir die Technologie nutzen, benutzen und reglementieren. Aktiv müssen wir individuell sowie kollektiv dafür sorgen, dass technologischer Fortschritt gleichbedeutend mit menschlichem Fortschritt ist. Damit wir nicht blind handeln, benötigen wir Wissen darüber, wie die neue Technologie unsere Kommunikation, unser Handeln und die Politik beeinflusst.
Aufklärung hat im Informationszeitalter keinen leichten Stand. Heutzutage steht Aufmerksamkeit im Zentrum des Äthers und der sozialen Medien. Wir leben in einem Überfluss an Information, welcher wiederum Knappheit an Aufmerksamkeit erzeugt, was Aufmerksamkeit in eine wertvolle Ressource verwandelt. Werbung und traffic bedeuten Geld, Macht und politischen Einfluss. Dabei spielen Wahrheit, Fakten und wirkliche soziale Herausforderungen nicht länger die Hauptrolle. Um zu verhindern, dass die Jagd nach Aufmerksamkeit die Aufklärung und die Vermittlung wahrhaftsgetreuer Information verdrängt, müssen wir die Mechanismen, die strukturellen Voraussetzungen und die Entwicklung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten studieren und verstehen. Und genau das ist die Absicht unseres Buches. Wir legen in Postfaktisch unser Verständnis davon dar, wie die Jagd nach Aufmerksamkeit auf einem Markt der Informationen zu Desinformation, politischen Blasen, Populismus und letztendlich zu einer postfaktischen Demokratie führt.
Wir schulden der nächsten Generation eine Welt, die sich in einem noch besseren Zustand befindet als die Welt, die wir von unseren Eltern übernommen haben. Dafür ist es hoffentlich noch nicht zu spät.
Einleitung
Am 4. Januar 2017 brachte das obskure kleine Medium Donbass News Agency eine Geschichte, wonach die USA sich anschickten, 3 600 Panzer als Teil der »Nato-Kriegsvorbereitungen gegen Russland« nach Europa zu bringen.1
Abb. 1 Die Nachricht der Donbass News Agency, die sich um die ganze Welt verbreitete.
Binnen weniger Tage verbreitete sich die Geschichte im Netz viral, also explosiv, wurde von Medien in den USA, Kanada und Europa übernommen, 40 000-fach geteilt, ins Norwegische übersetzt, von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert und erfreute sich auch sonst beträchtlicher Aufmerksamkeit, vor allem in der russischen Presse.2 Aber es war eine Fehlinformation. Zwar stimmte, dass die USA ihre Streitkräfte in Europa verstärken wollten, aber nicht mit Panzern und schon gar nicht in der Größenordnung, wie von der Donbass News Agency angegeben. Andernfalls hätte sich die amerikanische Panzerpräsenz um das Zwanzigfache gegenüber den tatsächlichen Plänen vergrößert.
Fehlinformation wie diese ist meistens nicht einfach falsch, sondern ein Mischprodukt. Das Rezept besteht in der passenden Vermengung von Wahrem und Falschem. Nur zwei Tage vor der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl im Mai 2017 sah sich die Kampagne des Kandidaten Emmanuel Macron einem massiven Hackerangriff ausgesetzt. Neun Gigabyte mit E-Mails und anderer interner Kommunikation wurden gepostet und zirkulierten in den sozialen Medien. Macrons Stab zufolge bestand dieses Leck aus einer Kombination von authentischem Material mit gefälschten Dokumenten und Erfundenem, um »Zweifel und Fehlinformation auszusäen«3. In einer Pressemitteilung von Macrons Kampagne En Marche! mit der Bestätigung des Lecks heißt es: »Der Ernst der Angelegenheit steht außer Frage. Wir können nicht hinnehmen, dass vitale demokratische Interessen in Gefahr gebracht werden.«4 Das World Economic Forum verkündete schon 2013:
Das globale Risiko massiver digitaler Desinformation bildet den Kern einer Konstellation aus technologischen und geopolitischen Risiken, die sich von Terrorismus über Cyberangriffe bis zum Zusammenbruch globaler Regierungsformen erstrecken.5
Fehlinformation ist im digitalen Zeitalter den globalen Herausforderungen zuzurechnen, genau wie die Klimaveränderungen, zunehmende ökonomische Ungleichheit, die Krise der Wasserversorgung, weltumspannende Gesundheitsprobleme und einige andere drängende Probleme. Digitale Fehlinformation wird aber nicht allein ausgelöst durch Terrorismus, Cyberangriffe und die lichtscheue Einmischung fremder Mächte. Diese Herausforderung lässt sich auch nicht allein damit bewältigen, Schurken zu ermitteln und beim Namen zu nennen. Richtet sich alle Aufmerksamkeit auf solche halbseidenen und total finsteren Akteure, können die strukturellen Bedingungen übersehen werden, die Fehlinformation blühen lassen. Es wird dann schwer, wenn nicht unmöglich, diese Ströme und ihre schädlichen Auswirkungen einzudämmen.
Um uns vor Fehlinformationen schützen und um externen Einfluss auf die Bildung politischer Meinung und auf demokratische Wahlen verhindern zu können, ist es wichtig, dass wir das Milieu verstehen, in welchem Information produziert und verbreitet wird. Der Versuch von russischer Seite, die Brexit-Abstimmung und die Präsidentschaftswahlen in den USA 2016 zu beeinflussen, hat gezeigt, dass das Informationsmilieu sehr ungeschützt ist. Die Presse als vierte Staatsmacht, Wachhund der Öffentlichkeit und Torwächter des öffentlichen Raumes wird hier zu einem entscheidenden Teil im Puzzlespiel. Das Agieren der Nachrichtenmedien und ihr Reagieren auf Fehlinformation sind entscheidend dafür, wie kräftig Letztere durchschlägt und wie großen Schaden sie anrichten kann. Das Hacken von Macrons Kampagne und das Leaken der Dokumente hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die französische Wahl. Der Kontrast zum Einfluss der Leaks aus Hillary Clintons Kampagne auf die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016 ist frappierend. Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Leck in Frankreich tat sich in letzter Stunde auf, unmittelbar vor dem gesetzlichen Verbot von Wahlberichten in den letzten 44 Stunden. Aber das ist nicht alles. Auch presseethische Grundsätze trugen erheblich zum Ausbleiben eines Effekts bei. Die französische Zeitung Le Monde schrieb am 6. Mai, dem Tag nach dem Leck und direkt vor der Wahl:
Wenn diese Dokumente Enthüllungen enthalten, wird Le Monde sie natürlich veröffentlichen, sobald sie in Übereinstimmung mit unseren journalistischen und ethischen Regeln analysiert sind, ohne dass wir uns zu einem Instrument anonymer Akteure für die Verbreitung ihrer Tagesordnung machen lassen.6
Solche journalistische Ethik und Gründlichkeit bei der Dokumentation scheinen keine so maßgebliche Rolle für die Wahlberichterstattung von einzelnen US-Medien, vor allem auf Kabelsendern, gespielt zu haben. Wenn journalistische Ideale bei der Verbreitung von Nachrichten sekundär bleiben, können Nachrichtenmedien, einschließlich der etablierten, zur Fehlinformation beitragen, statt sie zu enthüllen und zu verhindern. Aber ethische Prinzipien und edle Intentionen von Journalisten und Medieninstitutionen – oder Mangel daran – sind nur Teile in einem größeren Spiel. Sie machen weder das Gesamtbild aus, noch liegt hier die Lösung des Problems.
Medien und Journalisten operieren in einem Umfeld, das den Rahmen für Nachrichtenverbreitung und Informationsvermittlung setzt. Um in einem Umfeld zu überleben, muss man sich auf dessen Bedingungen einstellen, auch in der Medienbranche. Die ökonomischen Voraussetzungen, unter denen Journalistik und Nachrichtenvermittlung betrieben werden, haben Einfluss auf das Resultat und die Qualität. Öffentlich-rechtliche Medien machen einen Unterschied, genau wie die Geschäftsmodelle und Marktbedingungen von Medien.
Abb. 2 Die Annahme von Bürgern in sieben EU-Ländern über den Bevölkerungsanteil von im Ausland Geborenen wird der tatsächlichen Prozentzahl im jeweiligen Land gegenübergestellt. Während der Unterschied zwischen Annahme und Realität in Dänemark nur 4% beträgt, sieht es am entgegengesetzten Ende der Skala ganz anders aus: In Italien beträgt der Unterschied satte 21%. Quelle: Flynn et al. (2017)
Ist der Markt für Nachrichten vollständig kommerzialisiert und komplett abhängig von Anzeigenkunden, deren Qualitätskriterium einzig aus der Größe des Publikums besteht, können Unterhaltungswert, Konflikt und Sensation zu den entscheidenden Nachrichtenkriterien werden. Das schafft gute Voraussetzungen für Fehlinformation, Populismus und politische Manipulation. Was genauso gilt, wenn Politiker die Medien an der kurzen Leine haben.
Es gab Zeiten, da konnten Despoten das Informationsniveau der Bevölkerung als Macht- und Herrschaftsstrategie auf einem absoluten Minimum halten sowie durch Zensur und Strafe die Quellen für ungelegene Information unterdrücken. Einige Machthaber versuchen das immer noch. Der Kampf für die Meinungsfreiheit ist auch ein Kampf gegen diese Herrschaftsstrategie. Im Informationszeitalter lässt sich von Zeit zu Zeit auch ohne Zensur und Verletzung der Meinungsfreiheit ein ganz ähnlicher propagandistischer Effekt erzielen, indem man Bürger, Wähler und die Presse mit Fehlinformationen überhäuft. Durch Fehlinformationen werden die politische Opposition, die Bürger und die Presse verwirrt, wodurch die Machthaber mit so einigem davonkommen. Erst recht, wenn das Hand in Hand geht mit stark verbreitetem Misstrauen – ob nun begründet oder nicht – gegenüber der Presse, die als Wachhund im Auftrag der Bevölkerung agieren soll. Meinungsfreiheit allein ist kein Bollwerk gegen eine solche Herrschaftstaktik in Sachen Information. Was aber könnte das Bollwerk dann sein? Wohlgemerkt, ohne dass es die Einschränkung der Meinungsfreiheit mit sich führen und damit Freiheit, Aufklärung und Demokratie untergraben würde. Die Annäherung an diese ausgesprochen schwere, aber brennende Frage erfordert ein Verständnis der technologischen, marktmäßigen und psychologischen Bedingungen, die Fehlinformation wirksam werden lassen.
Die Digitalisierung von Informationen und Medieninhalten sowie die Infrastruktur des Internets ermöglichen technologisch die Produktion und Ausbreitung von Fehlinformation auf einem neuen Niveau. Die Infrastruktur, die Ökonomie und der Markt für Medienprodukte, die aus dem Internet entstanden sind, verschaffen politischen und ideologischen Interessen günstige Voraussetzungen für Propaganda. Zum Startpaket gehören kräftige ökonomische Anreize für die Produktion und Verbreitung verzerrter Geschichten, loser Gerüchte und von Fake News. Sie sind die Quelle für Reklame- und Anzeigeneinnahmen. Klicks im Internet lassen sich in Geld verwandeln, wobei der Wahrheitsgehalt dessen, worauf geklickt wird, in diesem Kontext keine Bedeutung hat. Ein Klick ist ein Klick. Werden die Menge und Akzeptanz von Fehlinformationen nicht eingedämmt, nähern sich die am härtesten davon betroffenen Demokratien einem postfaktischen Zustand.
Eine Demokratie befindet sich in einem postfaktischen Zustand, wenn politisch opportune, aber faktisch irreführende Narrative statt Fakten als Grundlage für die politische Debatte, Meinungsbildung und Gesetzgebung dienen.
Ist es so weit gekommen, sind Tatsachen und faktisches Wissen entwertet, worauf wir als Folge die Fähigkeit verlieren, die gesellschaftlichen und globalen Probleme zu benennen und zu lösen, denen wir gegenüberstehen. Aber das ist noch nicht alles. Wie das World Economic Forum vier Jahre nach der Benennung von digitaler Fehlinformation als globalem Risiko schlussfolgert, fordert diese jetzt die demokratische Regierungsform insgesamt heraus.7 Mit diesem Buch möchten wir ein Erklärungsgerüst dafür liefern, wie eine Demokratie als postfaktisch enden kann. Die Kapitel 1–5 benennen Bedingungen und Strukturen. Das abschließende Kapitel 6 erklärt, was für eine Größe eine postfaktische Demokratie darstellt und warum das schlussendlich kein erstrebenswerter Zustand ist.
Im digitalen Zeitalter fehlt es nicht an Information. Aber wer Information konsumiert, tut das im Tausch gegen die eigene Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Eingangstür zu unserem Bewusstsein. Das macht sie wertvoll für alle mit einer Botschaft, einer Neuigkeit oder einer Ware, die verkauft werden will. Wenn man jedoch etwas Bestimmtem die eigene Aufmerksamkeit schenkt – einer Facebook-Debatte über die Bedrohung durch Zuwanderer, einem Tweet von Donald Trump über das Abhören des Trump Tower durch Barack Obama, einer Nachricht bei Breitbart zu #Pizzagate, einem Gerücht, wonach Angela Merkel über das ZDF herrscht, oder … –, dann gibt es daneben eine Menge anderes, das weichen muss. Der Tag hat nur 24 Stunden, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt – und deshalb im Netz hart umkämpft. Das Ergebnis dieses Kampfes ist oft ausschlaggebend dafür, was auf die Tagesordnung des Nachrichtenstroms und der Politik gelangt, ob Letztere sich nun online oder offline abspielt. Die Aufmerksamkeitsökonomie und der Markt für Nachrichten sowie politische Botschaften sind die Themen von Kapitel 1 und 2. Der Nachrichtenmarkt und der Markt für politische Botschaften ermöglichen Aufmerksamkeitsspekulation und die Bildung politischer Blasen, in denen die Substanz verschwindet. Das sind die Dreh- und Angelpunkte von Kapitel 3. In Kapitel 4 werden die Ingredienzen von Information und vor allem von Fehlinformation behandelt, von der Wahrheit über Verzerrungen, unbestätigten Gerüchten, Nichterwähnung bis zu Lügen, Bullshit, Fake News sowie der Behauptung »alternativer Fakten«. Kapitel 5 beleuchtet zunächst verschiedene psychologische und sozialpsychologische Mechanismen, die uns für Fakten resistent machen – wenn nicht sogar faktenimmun – und die zugleich Fehlinformation so wirkungsvoll werden lassen. Dieselben Triebkräfte machen Populismus mit seinen simplen »Wir gegen die anderen«-Geschichten zu einer effektiven politischen Strategie; man kann »die anderen« verdächtigen, also die Presse, die Elite, verarmte Randzonen, die Dummen, die Unaufgeklärten, die Reichen, die Armen, die Fremden … Und dabei politische Gegner in Misskredit bringen. Werden »die anderen« dann auch noch als Feinde aufgefasst, ist die Wahrheit das erste Opfer in einem Zangenkrieg, geprägt von beiderseitigem Misstrauen. Hier gedeihen Verschwörungstheorien bestens, und sie können lange am Leben bleiben. Das Buch schließt mit Kapitel 6 über die postfaktische Demokratie: Warum sie genau wie das entgegengesetzte Extrem, die Technokratie, nicht sonderlich demokratisch und es deshalb wert ist, bekämpft zu werden.
1 Aufmerksamkeitsökonomie
1.1 Die Informationsgesellschaft
Als Abraham Lincoln Anfang des 19. Jahrhunderts im Bundesstaat Indiana aufwuchs, war er, so erzählten es die Nachbarn, zu kilometerlangen Fußmärschen bereit, um ein einziges Buch auszuleihen. »Mein bester Freund ist der Mensch, der mir ein Buch gibt, das ich noch nicht gelesen habe«, soll der junge Lincoln gesagt haben.8 Literatur gab es nur in beschränkter Auswahl, sie war schwer zugänglich und wertvoll. Das galt nicht nur für Literatur, sondern als Grundbedingung für das Erlangen von Information überhaupt: Information war eine schwer zugängliche Ressource. Ob es um Neuigkeiten aus weiter Ferne ging, neue Technik, neues Wissen oder reine Unterhaltung, in aller Regel setzte die Beschaffung von Information harte Arbeit voraus und verursachte erhebliche Kosten. Noch vor wenigen Jahren hat uns der Zugang zu Informationen viel mehr abverlangt als heute. Sich auf dem Laufenden zu halten, erforderte zum Beispiel das Abonnement oder den Kauf einer Zeitung, den Gang zur Bücherei, oder dass man sich zum Dorfteich bemühte, um das Neueste über den Nachbarn zu erfahren. Digitalisierung und Datentechnologie haben das radikal geändert. Heute reicht in der Regel ein Handy mit Internetzugang, um an die Information zu gelangen, die gesucht wird: Nachrichten, Politik, wissenschaftliche Studien, Literatur, Unterhaltung, Klatsch, Babyfotos und Katzenvideos. Nie zuvor stand uns so viel und so leicht zugängliche Information zur Verfügung.
Das Informationszeitalter kennzeichnet deshalb nicht, dass wir alle schwer zugängliche und kostbare Information jagen. Es verhält sich eher umgekehrt. In der Informationsgesellschaft gibt es so viel Information, dass wir darin zu ertrinken drohen. Das spiegelt sich darin wider, dass das gigantische Angebot von online frei zugänglicher Information deren Wert drastisch gesenkt hat. Viele, die mit dem Internet aufgewachsen sind, haben die Erwartung, dass Information gratis ist – und auch sein sollte –, und weigern sich, für Zeitungen, Bücher oder Unterhaltungsprodukte zu bezahlen. Wohl kaum jemand wäre heute zu einem Fußweg über mehrere Kilometer bereit, um ein Buch in die Finger zu bekommen.
1.2 Der Preis der Information
Dass Information in überwältigender Menge leicht zugänglich ist und man dafür meist nicht in Euro und Cent bezahlen muss, bedeutet aber keineswegs, dass sie umsonst ist. Der Preis, den wir für Information zahlen, ist unsere Aufmerksamkeit. Erinnert sei an den englischen Begriff »to pay attention«. Man kann Unmengen Information zur Verfügung haben, aber um sie aufzunehmen, zu verarbeiten und möglicherweise auf ihrer Grundlage zu handeln, müssen sie gegen die eigene Aufmerksamkeit eingetauscht werden. Das Projekt Gutenberg hat mehr als 53 000 Bücher online frei zugänglich gemacht. Bei Lektüre von einem Buch pro Tag würde es 145 Jahre dauern, diese Bibliothek durchzulesen. Die heutige Herausforderung besteht nicht darin, etwas zu lesen zu finden, sondern die Zeit, etwas von all dem zu lesen, das man zur Verfügung hat. Es soll ja möglichst noch Aufmerksamkeit für Familie, Freunde und das Leben sonst übrig bleiben.
Wenn die Menge zugänglicher Information überwältigend ist, folgt daraus ein Defizit an Aufmerksamkeit. Schon 1971 hat der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft, Herbert Simon, prophetisch über das Informationszeitalter geäußert:
… in einer an Information reichen Welt bedeutet der Reichtum an Information Knappheit an etwas anderem: Eine Knappheit an dem, was immer das sein kann, das Information verbraucht. Was Information verbraucht, liegt auf der Hand: Sie verbraucht die Aufmerksamkeit des Empfängers.9
Dass wir Aufmerksamkeit (ver)brauchen, um informiert zu werden, macht sie zu einer kostbaren Ressource für uns. Die Information, auf die man aufmerksam geworden ist, wird aufgenommen und zur eigenen Erfahrungs- sowie Wissensgrundlage. Bei der Aufmerksamkeit handelt es sich um eine sehr spezielle Ressource. Im Gegensatz zu ökonomischen Mitteln und politischer Macht ist sie eher gleichmäßig verteilt. Auch wenn manche ihre Aufmerksamkeit längere Zeit und konzentrierter aufrechterhalten können als andere, gibt es, verglichen mit anderen Ressourcen, nur marginale Unterschiede bei der dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Menge an Aufmerksamkeit. Sie kann nicht akkumuliert oder angespart werden wie Geld. Im wachen Zustand (ver)brauchen wir konstant unsere Aufmerksamkeit: Wir sind die ganze Zeit aufmerksam auf etwas. Aber ein gemeinsames Merkmal von Geld und Aufmerksamkeit besteht darin, dass wir die Ressource für etwas auf Kosten von etwas anderem verbrauchen, für das sie andernfalls genutzt werden könnte.
1.3 Knappheit an Aufmerksamkeit
Der Philosoph und Psychologe William James (1842–1910) hat die Aufmerksamkeit 1890 in einem berühmten Zitat beschrieben:
[Aufmerksamkeit] ist das Bewusstsein, das in klarer und lebendiger Form einen aus mehreren simultan möglichen Gegenständen oder Gedankenströmen in Besitz nimmt. … Es erfordert die Abwendung von bestimmten Dingen, um sich effektiv zu anderen zu verhalten.10
Um Information effektiv aufzunehmen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf jeweils einen Gegenstand ausrichten. Neuere Kognitionsforschung hat das bestätigt: Auch wenn wir mitunter multitasken und auf mehrere Dinge gleichzeitig aufmerksam sein können, etwa telefonieren und zugleich Essen zubereiten, werden wir in der Regel langsamer und begehen mehr Fehler. Die Qualität sinkt, wenn wir die Aufmerksamkeit aufteilen, statt sie ganz auf eine Sache oder Aktivität zu konzentrieren (Sternberg & Sternberg 2012).
Abb. 3 Multitasking senkt die Qualität der eigenen Aufmerksamkeit durch Verminderung der Reaktionsfähigkeit und auch der Menge an aufgenommener Information.
Wenn wir nur auf jeweils eine Sache aufmerksam sein können, wird Zeit ein entscheidender Faktor. Aber die Zeit ist selbst fixiert und begrenzt. Wie auch immer wir uns mit To-do-Listen zu organisieren und unseren Zeitverbrauch zu optimieren versuchen, der Tag hat doch immer nur vierundzwanzig Stunden und das Individuum eine begrenzte Aufnahmekapazität (Kahneman 1973). Das setzt eine Obergrenze dafür, wie aufmerksam man sein kann, und damit auch, wie viel Information täglich aufgenommen und verarbeitet werden kann. Das macht die Auswahl von Information und die Allokation von Aufmerksamkeit ausschlaggebend dafür, wie man informiert ist.