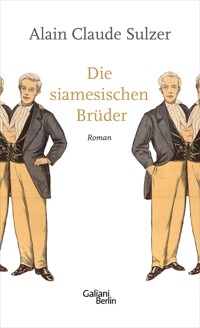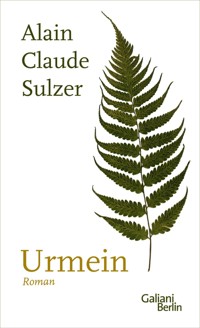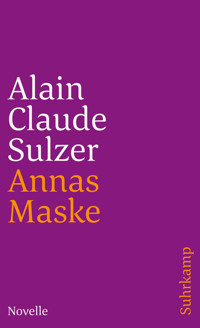Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alain Claude Sulzers virtuoser Roman über einen großen Filmstar in der Einsamkeit des Exils und die Wirren der europäischen Katastrophe. Lionel Kupfer, allseits umschwärmter Filmstar der frühen Dreißigerjahre, ist ins Hotel Waldhaus in Sils Maria gereist, um sich auf seine nächste Rolle vorzubereiten. Doch die Ereignisse überschlagen sich. Kupfer sieht sich mit der Tatsache konfrontiert, dass er als Jude in Deutschland unerwünscht ist. Der Vertrag für seinen nächsten Film wird aufgelöst. Die schlechte Nachricht überbringt ihm ausgerechnet Eduard, sein Liebhaber, dessen gefährliche Nähe zu den neuen Machthabern immer offenkundiger wird. Lionel Kupfer ist gezwungen, zu emigrieren.Doch muss er nicht nur Eduard verlassen, sondern auch einen jungen Schweizer Postbeamten namens Walter, der sich ins Hotel eingeschmuggelt hat, in der Hoffnung, dem von ihm verehrten Filmstar leibhaftig zu begegnen. Er kommt ihm dabei näher, als er je zu hoffen wagte.Wir folgen nicht nur Lionel ins Exil nach New York, wo er als Schauspieler nicht richtig Fuß fassen kann, sondern auch dem zwielichtigen Kunsthändler Eduard und dem jungen Postbeamten aus Sils.Innerhalb einer Zeitspanne von fünfzig Jahren begegnen wir Menschen unterschiedlicher Herkunft, deren Wege sich kreuzen, die sich manchmal für wenige Tage sehr nahekommen, um dann wieder auseinandergerissen zu werden. Doch obwohl sie sich aus den Augen verlieren, vergessen sie einander nicht.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Claude Sulzer
Postskriptum
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alain Claude Sulzer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alain Claude Sulzer
Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt die Bestseller »Zur falschen Zeit« (KiWi 1249) und »Aus den Fugen« (KiWi 1360). Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Prix Médicis étranger, dem Hermann-Hesse-Preis und dem Kulturpreis der Stadt Basel.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Lionel Kupfer, umschwärmter Filmstar der frühen Dreißigerjahre, muss während eines Aufenthalts in der Schweiz erkennen, dass er als Jude in Deutschland unerwünscht ist. Der Vertrag für seinen nächsten Film wird aufgelöst. Die schlechte Nachricht überbringt ihm ausgerechnet Eduard, sein Liebhaber, dessen gefährliche Nähe zu den neuen Machthabern immer offenkundiger wird. Lionel Kupfer ist gezwungen, zu emigrieren. Er geht nach Amerika und versucht dort, als Schauspieler Fuß zu fassen.
Innerhalb einer Zeitspanne von fünfzig Jahren begegnen wir Menschen unterschiedlicher Herkunft, deren Wege sich kreuzen, die sich manchmal für wenige Tage sehr nahekommen, um dann wieder auseinandergerissen zu werden. Doch obwohl sie sich aus den Augen verlieren, vergessen sie einander nicht.
»Großes Kino: Liebe, Drama, Zeitgeschichte, Gut und Böse, und schließlich sogar ein unerwartetes Happy End. Ein ausgesprochen lesenswerter Roman.«
Deutschlandfunk
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2015, 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Getty Images/Heritage Images
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31511-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Förderhinweis
Motto
Prolog
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
Postskriptum 1963
Dank
Der Autor dankt der Kulturstiftung Pro Helvetia und dem
für die großzügige finanzielle Unterstützung
»Die sekundär entstehende Wärme zwischen Menschen ist aber naturgemäß nur ein flüchtiger Hauch. Unbeständig. Sie verschwindet meist, wenn man voneinander nichts Praktisches mehr zu verlangen hat.«
Max Brod[1]
Prolog: Das Meer der Wiener, Sommer 1894
Seine Mutter rief nicht ihn. Sie rief »Tobias!«, der mit den Nachbarskindern Verstecken spielte, doch Tobias hörte sie nicht oder wollte nicht hören, er antwortete nicht. Lion hörte ihn schreien, aber das war keine Antwort auf Mutters beharrliches Rufen, es gehörte zum Spiel. Was konnte sie von ihm wollen? Was gab es zu helfen? Es war doch alles ein Spiel. Sie waren so jung.
»Eckstein, Eckstein, alles muss versteck sein«, hatte er seinen älteren Bruder laut und vernehmlich gegen den Wind anrufen hören, der die Worte zerriss und zerstreute. Der Verlust des »t« im »versteckt« ging auf Tobias’ Konto. Aber das war schon eine Weile her. Lion konzentrierte sich auf seinen Stift. Eine hübsche Stimme hatte Tobias nicht, er krächzte, doch Lion liebte die Stimme seines Bruders, so wie sie war, sie war wie seine aufgerissenen Knie und zerschundenen Waden, sie war roh und liebenswert. Gewisse Dinge waren ihm nicht beizubringen. Vor allem nicht deutliches Sprechen. Doch dafür schalt ihn keiner. Sie liebten ihn so, wie er war, und Lion liebte ihn am meisten, auch wenn er es seinen Bruder nicht täglich spüren ließ, anders als seine Mutter.
Tobias spielte mit den Kindern anderer Sommerfrischler Verstecken. Da sich das kleine Haus am Neusiedler See, in dem die Familie, seit Lion sich erinnern konnte, jeden Sommer vier Wochen Urlaub verbrachte, nicht die besten Voraussetzungen bot, um sich unsichtbar zu machen (der Garten war kaum größer als das Haus), unternahmen Tobias und seine Freunde bei schönem Wetter ausgedehnte Exkursionen – am liebsten in die Nähe des Sees –, wo sie im Gestrüpp, in Kuhlen, Erhebungen und hinter dürren Ästen Verstecke fanden, in denen man zumindest kurzzeitig unentdeckt blieb. Hier war alles anders als in der Stadt, und deshalb nannte man es Urlaub am Meer. Dass das Wasser bloß ein See war, erfuhr Lion erst später, denn seine Eltern nannten es das Meer der Wiener.
Wenn ihnen die Suche nach neuen Verstecken langweilig wurde, kehrten die Jungen zu ihrem liebsten Zeitvertreib zurück und spielten Indianer oder Krieg, die Schlacht bei Königgrätz oder Kampf der Trapper gegen die Apachen. Ein Zeitvertreib, an dem sich hin und wieder ein paar hilfsbereite Mädchen als Krankenschwestern oder Squaws beteiligten. Stets gewannen die Preußen und Apachen.
Tobias und seine Freunde – fünf Jungen in seinem Alter – trafen sich täglich nachmittags. Wenn hin und wieder auch einer fehlte, Tobias war immer dabei. Er las nicht, er beschäftigte sich nicht mit sich selbst, er war nie krank. Es war immer jemand für ihn da, wenn nicht, trieb er ihn auf. Er erwachte früh, vor allen anderen, und wäre am liebsten als Letzter zu Bett gegangen. Tobias war der beste Kamerad, den ein Junge sich wünschen konnte. Treu bis in den Tod, genau so wie sie bei ihren Spielen sagten, wenn sie zwei Finger in die Höhe hielten und schworen. Wir hätten ihn auch Siegfried nennen können, sagte der Vater, und die Mutter lachte.
Lion warf einen schrägen Blick in den Himmel. Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, war es etwa vier. Eine Uhr besaß er noch nicht. Manchmal lieh er sich die Taschenuhr seines Vaters. Der konnte sich darauf verlassen, dass sein Jüngster mindestens so viel Sorge dafür tragen würde wie er selbst. Lion war sanftmütig mit einer Neigung zur Ungeduld, wenn die Dinge nicht liefen, wie er wollte. Eine Ungeduld sich selbst gegenüber, bei anderen aber blieb er ruhig.
Eine unerwartet kühle Windbö streifte Lion, strich über sein dunkles Haar und machte sich mit einem schneidenden Geräusch davon, das die zitternden Halme des spärlichen Grases erzeugten, das da und dort büschelweise aus dem Sand ragte und dessen Namen Lion nicht kannte. Das Gras war fast weiß. Es klang, als zerrisse dünner Stoff.
Weiter weg, näher am See, wo das Schilfrohr beinahe undurchdringlich war, spielten die Jungen und machten sich einen Spaß daraus, die nistenden Teichhühner und Rohrsänger aufzuschrecken, die laut schimpften, bevor sie aufflogen. Die Jungs waren stärker, die Menschen überhaupt. Doch hatte man Tobias eingeschärft, zufällig entdeckte Nester nicht anzurühren, und Lion war überzeugt, dass er und seine Freunde sich daran hielten, und zwar aus Einsicht, nicht, weil man es ihnen verboten hatte. Sie waren wild und machten Lärm, aber rücksichtslos waren sie nicht.
Gewiss hätte es ihnen großes Vergnügen bereitet, wenn Lion sich dorthin verirrt, nicht mehr herausgefunden hätte und hätte gerettet werden müssen wie eine dumme Gans. Indem er sich zurückzog, konnte er ihnen damit nicht dienen. Tobias und seine Freunde spielten für sich, Lion blieb allein. So wie er wollte. So wie man es von ihm gewohnt war. Was die anderen Jungs taten, wusste er nicht, er sah sie erst abends, wenn man nach dem Essen im winzigen Pavillon der Kupferbergs, am Strand oder bei Freunden der Familie in einem der anderen Sommerhäuser zusammenkam, um zu reden, zu rauchen und zu trinken. Am Abend konnte auch Lion ein anderer sein wie die anderen.
Lion empfand seinen Wunsch nach Einsamkeit nicht als Beeinträchtigung. Ihn sich zu erfüllen war einfach. Allein zu sein war seine Entscheidung, er folgte einer inneren Weisung, die fast so deutlich war wie eine Stimme. Natürlich hörte er sie nicht, und selbstverständlich sprach er mit niemandem darüber. Nur so, als Einzelgänger, konnte er ungestört betrachten, was sich seinem Auge darbot, und wiedergeben, wie er es sah. Was er entdeckte, war niemals bedeutungslos, nie klein, nie groß. Dinge, an denen die anderen achtlos vorbeigingen, zogen ihn an, hielten ihn fest und zwangen ihn, sie eingehend zu betrachten. Das konnte ein maroder Schuh oder ein verschimmeltes Stück Brot sein, ein zerrissener Strumpf oder das abgebrochene Bein eines Schaukelpferds. Einmal hatte er am Wasser eine halb verfaulte Beinprothese aus Holz gefunden. Er war in Begleitung seiner Mutter, die über den Fund entsetzt war. Allein ans Wasser ließen sie ihn nicht.
Tobias und seine Kameraden, Lions Eltern und deren Freunde und Bekannte, alle die, die das sommerliche Leben mit Lion teilten, als wäre man auf einer Insel, gehörten zur Szenerie, aber Lion zeichnete nie Menschen. Es war nicht nötig, sie aufs Papier zu bannen. Lieber zeichnete er Tiere und Bäume, Waldstücke und Mauern, Blumen und abgebrochene Wagenräder, Türen und manchmal ganze Häuser, am liebsten aber Strandgut. Darüber, dass er begabt sei, war man sich einig. »Lion ist nur glücklich vor einem Stück Papier«, pflegte seine Mutter zu sagen. Dass es sie mit Stolz erfüllte, war nicht zu überhören.
Er zeichnete, seit er denken konnte. Seine Mutter behauptete, selbst das Material sei ihm zugeflogen. Eines Tages hatte ein Stück Papier vor ihm gelegen, ein Stift war auch zur Hand gewesen. Als Stift und Papier beisammen waren, begann das Abenteuer. Seit er das tat, waren seine Finger nie sauber, sondern abwechselnd grau oder schwarz oder bunt oder beides. Stets trug er Zeichenstifte bei sich, manchmal ein Tuschefässchen und eine Feder. Seine Kleider waren voller Flecken. Er hatte gezeichnet, noch bevor er schreiben und rechnen konnte, noch immer fiel es ihm leichter als alles, was man in der Schule lernte. Schreiben und Rechnen waren lediglich die schwächeren Äste desselben Baums, aus dessen Stamm heraus er zeichnete.
Schreiben und Rechnen waren Äste, an denen man sich festhielt, um im Leben weiterzukommen, eine Fortsetzung dessen, was er längst beherrschte: Reden ohne zu überlegen. Beim Zeichnen musste man nicht einmal sprechen. Der Mund blieb verschlossen, die Lippen bewegten sich nicht. Zeichnen verwandelte alles, was er sah, zu dem, was sich vielfach verspiegelt hinter den Dingen verbarg.
Er zeichnete auch das, was er nicht sah. Nur der Wind, nur der Lockruf des Rohrsängers, der Warnruf, wenn sich ein Räuber seiner Brut näherte, ließ sich nicht einfangen und fixieren, noch nicht. Der Schrei. Die Angst. Die Zukunft. Das Unbekannte. Es würde schon kommen und auf sich aufmerksam machen.
Lion war ein fröhliches, etwas unnahbares Kind, und niemand versuchte, ihn auf einen anderen Weg zu bringen.
Vielleicht hörte Tobias seine Mutter tatsächlich nicht. Die Namen der anderen Jungen, mit denen er Verstecken spielte, kannte Lion nicht. Es gab für ihn keinen Grund, sich ihre Namen zu merken. Einer war blond, ein anderer war ständig »verwundet«, einer trug immer lange Hosen, die anderen kurze, der fünfte eine Brille, die ihm ständig von der Nase rutschte und die er immerfort nach oben auf die sommersprossige Nase schob. Hätten ihre Mütter manchmal nach ihnen gerufen, wie seine Mutter vorhin nach Tobias gerufen hatte, vielleicht hätte sich Lion dann ihre Namen gemerkt. Doch sie wohnten weiter weg. Wenn ihre Mütter tatsächlich riefen, hörte man es nicht. Vermutlich taten sie es deshalb nicht. Die Jungen waren älter als Lion und an Dingen interessiert, die ihn nicht interessierten, und sonntags gingen sie in die Kirche. Tobias war neun. Er selbst war erst sechs.
Lion hatte sich in den Dünen verkrochen und zu zeichnen begonnen. Der Sand war kühl, denn die Stelle, an der er sich niedergelassen hatte, lag im Schatten und wurde vom auffrischenden Wind gefächelt und gefältelt. Wer ihn suchte, würde ihn hier so schnell nicht finden. Leicht gab der Sand unter den Füßen nach. Hier trafen sich nachts heimlich die Liebespaare, behauptete Tobias.
Kaum hatte er den Zeichenstift angesetzt, begann seine Hand ein Gewehr zu zeichnen, während er doch gerade noch hatte versuchen wollen, einen Stein auf das Papier zu bringen, so wie er war, so wie er vor ihm lag. Doch während er den Stein betrachtete, veränderte sich seine Form, und es war nicht zu verkennen, was gegen Lions Willen aus ihm wurde. In seinen Gedanken loderte plötzlich der zurückgeworfene Kopf eines sterbenden Soldaten auf, doch er zeichnete nur das Gewehr, das Gesicht konnte er nicht erkennen. Tobias war es, der gern von Waffen erzählte und der ihn gebeten hatte, einen Soldaten zu zeichnen, »wie er fällt«. Er hatte sich stets geweigert.
Ganz von der Zeichnung absorbiert, tauchte er erst wieder auf, als er die Jungen rufen hörte. Solange hatte sich sein Blick ausschließlich auf das Papier gerichtet, auf das er zeichnete. War es vorhin die Mutter gewesen, waren es jetzt die Kameraden, die Tobias riefen.
»Wo bist du? Tobias!«
Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er musste an der Reihe sein, er hatte sich versteckt, ihn suchten sie schon länger und entdeckten ihn nicht. Er hatte offenbar ein sicheres Versteck gefunden.
Lion unterschied zwei Stimmen, danach eine dritte, hoch und piepsig. Der hatte noch keinen Stimmbruch, dachte er. Die Stimmen näherten und entfernten sich wieder, und plötzlich stand einer der Jungen da und blieb wie angewurzelt vor ihm stehen. Hatte er zunächst wohl vermutet, Tobias entdeckt zu haben, musste er jetzt feststellen, dass es ein fremder Junge war. Lion kannte ihn nicht, und der Junge kannte offenbar Lion nicht.
»Ist hier einer mit grünen Strümpfen vorbeigekommen?« Lion schüttelte den Kopf. »Grüne Strümpfe? Nein.«
Gut beobachtet, dachte er.
»Wir suchen ihn seit einer Ewigkeit«, fuhr der Junge fort und zog am Bund seiner Hose, die ihm bis zu den Knien reichte. Keine Kratzer, keine Schrammen, die Haut war glatt und weiß wie Mandelpudding.
»Hat sich wohl gut versteckt«, sagte Lion, und der Junge nickte und blickte neugierig auf ihn hinunter. Es war nicht der mit der piepsigen Stimme.
»Was tust du da?«
Lion verdeckte nicht, was er gezeichnet hatte, denn er hatte nichts zu verbergen, er drehte das Blatt in seine Richtung, sodass der Junge es in Ruhe betrachten konnte, und es entging Lion nicht, welche Wirkung das, was er sah, auf ihn ausübte. Er betrachtete ihn genau. War das wirklich die Arbeit eines Sechsjährigen, von dem man nichts anderes als Gekrakel erwartete?
»Ein Gewehr!«
Lion nickte.
»Warum ein Gewehr?«
»Warum kein Gewehr? Gib dich damit zufrieden oder …«
Der Junge starrte ihn an: »Oder?« Er streckte die Hand nach der Zeichnung aus, aber nun drehte Lion sie wieder zu sich, sodass sich der andere zu ihm herunterbeugen musste, wenn er das Bild noch ein wenig betrachten wollte.
»Sie ist noch nicht fertig«, sagte Lion versöhnlich.
»Und wenn sie fertig ist, krieg ich sie dann?«
»Willst du sie wirklich«, fragte Lion und dachte: Es wäre doch erstaunlich, wenn er sie nicht wollte, und: Was hat er für ein schmales Gesicht und wie merkwürdig stoßen die Brauen über der Nasenwurzel zusammen und wie spitz und knochig sind seine Knie unter der zarten Haut. Noch nie hatte er einen Jungen so betrachtet, als wollte er ihn malen. Er wollte ihn zeichnen, er würde ihn zeichnen, egal, ob er nun vor ihm stand oder ob er ihn aus dem Gedächtnis zeichnen musste, was wahrscheinlicher war.
»Ja, klar«, antwortete der Junge.
»Wie heißt du«, wollte Lion wissen.
»Siegfried.«
»Siegfried, der Drachentöter, so wollten sie Tobias nennen.«
»Wir sind keine Juden.«
»Na und«, sagte Lion. »Wenn ich fertig bin, kriegst du die Zeichnung. Heute Abend bin ich fertig. Versprochen.«
Der Junge sagte: »Ich hänge es über meinem Bett auf.«
Jetzt war er rot geworden.
»Hast du ihn gefunden!«
Aus nächster Nähe ertönte die piepsige Stimme von vorhin.
»Wo seid ihr? Siegfried! Tobias«, rief eine zweite, tiefere Stimme.
Siegfried drehte sich um. Zwei Buben erschienen, die Lion kannte.
»Du hast ihn nicht gefunden«, sagten sie, als sie Lion sahen.
Siegfried antwortete: »Nein, hab ich nicht.«
»Wen sucht ihr denn?«, fragte Lion, indem er sich unwissend stellte, stand auf und schüttelte den Sand aus den Umschlägen der kurzen Hose, die ganz zerknittert war.
»Deinen Bruder«, sagte einer der beiden.
»Sein Bruder?«, sagte Siegfried und schaute erwartungsvoll zu den beiden Jungen.
»Los, wir suchen ihn«, rief er dann und wollte losrennen. Er rutschte aus und glitt langsam in den Sand. Die beiden Freunde halfen ihm auf, aber er schüttelte sie ab. Er drehte sich nicht nach Lion um. So plötzlich, wie sie gekommen waren, waren die drei wieder weg.
Lion war wieder allein. Es dauerte eine Weile, bis Siegfried aus seinen Gedanken verschwunden war. Wie alt mochte er sein? Kaum größer als Tobias, hatte er im Unterschied zu ihm die gesetzte Stimme eines Jünglings, der sich noch etwas genierte, ein Mann zu werden. Während jene seines Bruders laut in den Angeln quietschte, schwang seine lautlos wie ein frisch geöltes Gartentor.
Er konzentrierte sich erneut auf seine Arbeit und konnte sich erst davon lösen, als die Zeichnung beendet war. Das war etwa eine halbe Stunde später, während der er sich durch nichts hatte ablenken lassen. Er hatte kein einziges Mal vom Papier aufgeblickt. Und er würde nichts mehr daran ändern, egal, was die Erwachsenen dazu sagten. Er würde die Zeichnung Siegfried schenken, wenn er ihn wiedersah, heute Abend oder im Lauf des morgigen Tages. Er hatte keine Ahnung, zu welchem Haus oder welcher Familie er gehörte, er würde ihn suchen, und er würde ihn finden. Der fallende Soldat – das Gewehr lag vor ihm, als habe er es von sich geworfen – hatte unverkennbar Siegfrieds Gesichtszüge. Ein älterer Siegfried und dennoch unverwechselbar. Mit zurückgeworfenem Kopf schien er nicht zu fallen, sondern in den Tod zu stolpern.
Lion verstaute den Radiergummi, die Stifte und das Federmesser im Lederbeutel, den er an einem breiten Band um den Hals trug, und schnürte ihn zu (»Pass auf, dass du nicht irgendwo hängen bleibst, im Gestrüpp oder an einer Türklinke, und wickle das Band nie zweimal um den Hals, es könnte in einem gefährlichen Moment die Wirkung einer Schlinge haben. Pass einfach auf.« Das war die Stimme seiner Mutter, ein Echo von außen).
Als er sich den Sand aus den Sandalen klopfte, bemerkte er, dass der Wind stärker geworden war. Doch etwas anderes machte ihn stutzig. Etwas, das sich bewegte. Waren es Schritte oder Stimmen? Von Menschen oder von Tieren? Ein unbekanntes Gefährt? Es war unmöglich, bei dieser Windstärke auch nur den geringsten menschlichen Laut auszumachen. Es waren keine Schritte. Eine unbestimmte Unruhe lag über der Gegend, und selbst der Wind, der in unberechenbaren Bewegungen wie ein über die Ufer getretener Strom über den Sand mäanderte, vermochte sie nicht zu verscheuchen, eher verstärkte er sie. Was war das? Irgendetwas war im Gange. Was er dann hörte, war etwas, was er nie zuvor gehört hatte und nie vergessen sollte, und später kam es ihm so vor, als habe er in diesem Augenblick schneller begriffen als gesehen.
Er hörte einen Schrei, und es war naheliegend, an eine Möwe zu denken. Aber es war ein menschlicher Schrei, der einem tierischen glich. Was da auf sich aufmerksam machte, war kein Tier, sondern ein Mensch, ein Mann oder eine Frau.
Die Unruhe, die eben noch ganz diffus gewesen war, packte Lion am Kragen und schlug ihn ins Gesicht, boxte ihn in den Bauch und auf die Beine, die bleiern wurden, es fiel ihm schwer zu gehen. Er musste dorthin. Aber wohin? Er kam viel zu langsam voran. Seine Füße waren Erdklumpen mit Bleigewichten. Zum Meer. Natürlich, er musste zum See.
Ziellos – denn er wusste nicht, was er suchte und in welche Richtung er gehen sollte – stolperte er durch den Sand über Steine und Steinchen, und winzige Holzstückchen drangen in seine Sandalen, Gestrüpp wischte ihm ins Gesicht, aufgewirbelter Sand wehte ihm in die Augen, und immerzu holte der Wind ihn ein, riss und zerrte an ihm, kam seitlich oder von hinten, am ungebärdigsten aber von vorne, wo das Meer der Wiener war, der endlose See, den er nun sehen konnte. Der Sturm stellte sich ihm in den Weg, doch er lief, ohne sich aufhalten zu lassen, die beschwerlichen Gewichte an seinen Füßen waren von ihm abgefallen, er rief in den Wind nach Tobias. Er rief nach Tobias, denn plötzlich wusste er, nach wem er rufen musste.
»Tobias! Tobias!«
Wie hätte er ihn hören können in diesem Wetter? Lion lief weiter in die Richtung, aus welcher der Schrei zu ihm gedrungen war und der geklungen hatte, als hätte der Sturm ihn dort, wo er in den Himmel gestiegen war, wie ein Tuch in Stücke gerissen; Fetzen, die überallhin flatterten, senkten und hoben sich als wirbelnder Nachhall auf seinem Trommelfell; obwohl er längst verstummt war, hörte er ihn immer noch.
Er blieb unvermittelt stehen und blickte nach oben. Und wenn er das alles nur geträumt hätte? Er wusste nun ziemlich genau, wo er sich befand, ein Geruch lag in der Luft, der ihm sagte, dass er ganz nah am Wasser war. Er roch das Schilf und das Wasser. In diesem Moment ertönte wieder ein Schrei, und Lion wurde gewahr und war ganz sicher, dass er nicht geträumt hatte und dass es sein Vater war, der schrie. Sein Vater, warum sein Vater, was hatte er am Wasser zu suchen? War er nicht zu Hause? War nicht die Zeit der Siesta? Wie spät mochte es sein?
Wenige Schritte später, er tauchte hinter einer Wand aus Schilfrohr auf, in der sich eine Lücke öffnete, sah Lion, was er nicht hätte sehen dürfen – aber niemand schien ihn jetzt zu bemerken – und worüber man später nie sprach und was sich ihm für immer einprägte. Er sah, wie sich zwei Männer und vier Jungen über einen Körper beugten, den sie ans Ufer gezogen hatten. Es war ein ruhiger Körper, der vollständig bekleidet war. Von den Kleidern floss das Wasser. Der Kopf lag in der Armbeuge seines Vaters. Das Gesicht war weiß. Die Lippen waren blau.
Er hörte das Meer, er sah das Wasser des Neusiedler Sees, vom Wind gepeitscht, und seine Mutter, die Hände an den Mund gepresst, als müsste sie sich übergeben, in der Nähe der Gruppe und doch, völlig schutzlos am Rand, allein in einem großen leeren Raum, der sich um sie gebildet hatte. Unwirklich und bedrohlich hob sich diese stumme Gesellschaft vor den unendlichen Wassermassen ab, dem Wasser des Meeres, der ein See war, wie er erst später verstehen würde, als sie längst nicht mehr hierherkamen, denn an den Neusiedler See kehrten sie nie mehr zurück.
Lions Mutter ließ die Hände sinken und öffnete den Mund zu einem Schrei, wie es schien, doch kein Laut drang über ihre Lippen, und langsam hob sie die Hände wieder, und einen Augenblick lang sah sie aus wie der kleine Soldat, dem Gott die Waffe aus der Hand geschlagen hatte. Die vor ihm lag, mit der er sich hätte verteidigen können, wenn Gott es zugelassen hätte. Aber Gott war nicht da. Es war zu spät.
Wer war der Junge im Arm seines Vaters? Lion kniff die Augen zusammen, um besser zu sehen, wer das war. Dann fielen ihm die grünen Strümpfe über dem feuchten Leder der Schuhe auf, die bleiche Haut über den grünen Strümpfen. Tobias trug grüne Strümpfe, doch seine Beine waren braun gebrannt wie seine, selbst im Winter verloren sie ihre Farbe nicht ganz. Nun brauchte er die Augen nicht mehr zusammenzukneifen. Etwas in seiner Hand schien sich zu bewegen.
Der ausgestreckte Körper, über den der Vater sich beugte, gehörte Tobias, jedenfalls trug er dessen Strümpfe und Kleider, aber er wirkte gerupft und geschrumpft. Lion starrte auf die merkwürdige Szenerie. Was er sah, konnte er nicht glauben, als wäre es ein Bild. Er näherte sich. Niemand nahm Notiz von ihm. War das Tobias? Ließ sich das Bild zerreißen?
Ist das Tobias? Hörte ihn niemand? Niemand antwortete. Er sah, wie sich das Gesicht seines Vater zum Kopf des Jungen in seinem Arm neigte, bis er ihn schließlich berührte, als wollte er ihn küssen. Das tat er aber nicht. Gleichzeitig versuchte er, den Händen des Jungen etwas zu entreißen, ein erbärmliches Bündel, ein behaartes Wesen. Das sah Tobias ähnlich, nach Tieren zu tauchen, die ihm entwischen wollten. Tobias war mutig und kräftig, Tobias würde auch das überstehen. Aus der behaarten Kreatur, die seine Finger nicht freigaben, war jedes Leben gewichen, und auch sein Bruder bewegte sich nicht. Nein. Gleich steht er auf und lacht, dachte Lion. Steht auf und geht. Steht auf und spuckt in hohem Bogen wie einen Jodeljuchzer das Wasser aus, das er verschluckt hat.
»Steh auf«, sagte seine Mutter, wie aus dem Schlaf erwacht, in einem Ton, den er nicht von ihr kannte. Tobias regte sich nicht. War es vielleicht doch nicht Tobias?
»Mach, dass er aufsteht«, sagte sie leise drohend zum Vater.
»Steh auf«, sagte sie, »das ist kein Scherz, damit scherzt man nicht.«
Aber ihre Stimme war so blass und schwach wie Tobias’ Körper. Nur seine Hand war stark, die das leblose Tier nicht loslassen wollte, und Lion war sich nicht sicher, ob der Vater die Mutter hörte.
»Steh auf«, und für einen Augenblick war auch Lion überzeugt, dass er gehorchen würde.
Tobias gab das Tier erst frei, nachdem der Vater seine große Hand um die kleinen Fäuste gelegt und vorsichtig Finger um Finger gelöst hatte. Seine Hand blutete. Er warf das nasse Bündel weg, was auch immer es war, Ratte oder Biber, Hund oder Katze, das Wesen, das Tobias, einmal gefangen oder gerettet, mit in den Tod gerissen hatte. Die Strafe, dachte Lion, die Strafe für ein Verbrechen, du hast es gefangen, doch wolltest du es auch töten?
Erst als er sah, dass Tobias nicht um seine Beute kämpfte, dass er sie schließlich herausgab, verstand er, was geschehen war, und vielleicht begriff es in diesem Augenblick, erst jetzt, auch seine Mutter, denn plötzlich gaben ihre Beine nach, und sie fiel, ohne einen Laut von sich zu geben, in sich zusammen, sie sackte einfach seitlich in den Sand. Der Vater hob Tobias hoch und stand auf. Er war tot.
I
Januar 1933
Hinauf. Er ging täglich nach der Arbeit zum Waldhaus hinauf. Es war ja nichts weiter als ein gemächlicher Abendspaziergang vom Dorf zum Hotel. So jedenfalls sollte es aussehen.
Als er nach oben blickte, dorthin, wo er Kupfer vermutete, glaubte er einmal einen Schatten zu erkennen, der sich hinter dem Fenster bewegte, ein anderes Mal sah er sogar, wie der Vorhang beiseitegeschoben und kurz darauf wieder fallen gelassen wurde. Nicht der Wind hatte den Stoff bewegt – das Fenster war geschlossen, Luft konnte nicht hereinwehen –, sondern eine Hand. Walter zweifelte nicht daran, dass es sich dabei um die des berühmten Schauspielers handelte. Sein Gefühl sprach dafür, und nichts sprach dagegen. Beobachtete Kupfer ihn, wie er gern Kupfer beobachtet hätte, wäre er ihm je begegnet, was bislang leider nicht der Fall war? Walter konnte sich einbilden, Kupfer verfolgte heimlich seine Schritte, wenn diese ihn zum Hotel hinauflenkten. Wie jede Einbildung wurde sie nachts zur Gewissheit, um am nächsten Morgen, wenn er wieder hinter dem Postschalter stand und auf Kunden wartete, einer unbestimmten Verunsicherung zu weichen. Warum sollte er sich täuschen? Aus vielerlei Gründen, wie er wusste, aber nicht weiter zu erforschen bereit war. Im Lauf des Tages kehrte die Zuversicht allmählich zurück.
Dafür, dass Kupfer tatsächlich auf dem Stockwerk und in dem Zimmer wohnte, in dem er ihn vermutete, gab es allerdings keinen einzigen nachprüfbaren Anhaltspunkt. Nur das Gefühl. Das Hotel zu betreten, in dem der Filmstar wohnte, traute Walter sich nicht. Er war kein Gast, und er hatte keinen Auftrag, hatte hier also nichts verloren. Sich nach Kupfer zu erkundigen, kam nicht infrage. Hätte er es dennoch gewagt, hätte man ihm sicher keine vertraulichen Auskünfte gegeben. Er war ja nicht der Postbote. Er besaß keine Befugnis, sich selbst ins Hotel zu schicken, sein Platz war im Postamt hinter dem Schalter. Auch wenn er in der Hierarchie eine höhere Position als der Briefträger einnahm, berechtigte sie ihn nicht, die Post persönlich auszutragen. Schon gar nicht, wenn es darum ging, sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Aussicht, dass der Briefträger und sein Stellvertreter gleichzeitig krank wären, was ein Einspringen seinerseits nötig gemacht hätte, war angesichts der Zuverlässigkeit und guten Konstitution seiner Kollegen mehr als unwahrscheinlich. Also wartete er auf einen Zufall. Obwohl er ahnte, dass das Warten wohl vergeblich sein würde.
Kupfer die Post persönlich auszuhändigen, war übrigens auch dem Briefträger nicht gestattet. Weiter als in die Eingangshalle gelangte kein unbefugter Außenstehender. Wer mit jemandem sprechen wollte, sprach mit dem Concierge oder wurde bereits an der Tür vom Chasseur höflich zurechtgewiesen, das Hotel zu verlassen, und zwar nicht durch die Drehtür (ein Unikum in Sils), sondern durch eine der gewöhnlichen Schwingtüren. Nicht herablassend, aber unmissverständlich. Förmlich, aber nicht abweisend. Es bestand die vage, sehr vage Aussicht, Kupfer den Aufzug verlassen und in den Salon gehen zu sehen, falls man es doch bis in die Halle schaffte. Dass es einen Aufzug gab, wusste jedes Kind, denn es war der einzige im Dorf, und so manches dieser Kinder hatte hier als Liftboy begonnen und damit den ersten Schritt nach oben getan. Von alledem etwas zu erhaschen, konnte Walter sich nur erträumen, dessen Aufgabe es war, Briefe, Zeitungen und Pakete entgegenzunehmen und die poste restante herauszugeben, die im Postamt darauf wartete, abgeholt zu werden, in neun von zehn Fällen von Hotelgästen, die von weit her anreisten und ihre Ruhe suchten, ohne auf ihre Eilpost verzichten zu wollen. Seitdem er hier lebte und arbeitete – seit fast zwei Monaten –, hatte kein einziger Einheimischer postlagernde Sendungen abgeholt.
Zu wägen, zu rechnen und zu stempeln, wie Walter es seit einigen Jahren tat, war keine Passion, aber er langweilte sich auch nicht dabei. Man sah mehr Leute, als wenn man den ganzen Tag in einem Büro saß, und man konnte sich ungestört ausmalen, was hinter den ausdruckslosen Gesichtern der Kunden vorging, worauf sie warteten und welche Heimlichkeiten auszutauschen sie fähig waren, zumindest in schriftlicher Form. Walter Staufer war unverheiratet und vermisste eigentlich nichts.
Dass Kupfer in Sils Maria logierte, war ein offenes Geheimnis. Dennoch belagerte niemand das Hotel, Diskretion war gewährleistet, dafür garantierten die Besitzer des Hotels genauso wie das Personal. Siebenmal die Woche wurde ihm das Berliner Tageblatt ins Hotel gebracht, mehrmals erhielt er Briefe, Verehrerpost vermutlich, etliche Sendungen waren auf der Rückseite lediglich mit Initialen versehen. Walter verbot es sich aus Gründen der Vertraulichkeit, mehr als nur jeweils flüchtige Blicke auf diese Namen zu werfen. Seine Augen waren gut genug. Doch ob es sich bei L.H. tatsächlich um Lilian Harvey und bei L.S. um Leo Slezak handelte, konnten auch sie nicht dechiffrieren. Die Buchstaben behielten ihre Geheimnisse für sich. Fast alle Briefe kamen aus Deutschland und Österreich, einer aus England, einer aus Schweden.
Herr Waldner, der Briefträger, kehrte nie mit leeren Händen vom Waldhaus zurück, nicht einmal während der Nebensaison. Einmal täglich leerte er den hoteleigenen Briefkasten, der im Entree einen prominenten Platz einnahm, der an einen kleinen Altar erinnerte. Darin deponierten die Gäste Briefe und Ansichtskarten. Das Waldhaus bedeutete jeweils das Ende seiner Tournee. Danach kehrte er zur Post und dann zu Frau und Kindern zurück. Dass Kupfer keine Briefe aufgab, entging Walter nicht.
Lionel Kupfer hielt sich seit Jahren regelmäßig im Hotel Waldhaus auf, um sich von den aufreibenden Dreharbeiten zu erholen, die ihn bis nach Afrika (Im Bann der Mumie) und Indien (Die Frau des Maharadschas) geführt hatten. Der berühmteste Schauspieler deutscher Zunge – mit rumänischen Wurzeln, wie es hieß, um seine jüdische Herkunft zu tarnen, die ihm, wie man behauptete, einen um eine oder zwei Silben längeren Namen auf den Lebensweg mitgegeben hatte, der ihn vermutlich weniger schnell zum Erfolg geführt hätte – war etwa doppelt so alt wie Walter. Betrachtete man die Bilder, die an die Öffentlichkeit gelangt waren, hatte er sich in den letzten zwanzig Jahren jedoch kaum verändert. Was man über ihn in Erfahrung bringen konnte, wusste Walter, denn er verehrte ihn wie einen Gott. Er sammelte über ihn, was er finden konnte, und das war eine ständig zunehmende Flut an Interviews, Berichten, Anekdoten und Büchern. Die illustrierten Blätter liebten ihn und hielten mit ihrer Zuneigung nicht hinterm Berg. Bella Fromm nannte ihn »den Verführer par excellence«, Siegfried Kracauer sprach vom »levantinischen Bel-Ami«. Kupfer war seit seinem ersten Film der Schwarm aller Frauen, nicht nur in Deutschland »die gleißende Talmiseite unserer ernsten Existenz«, wie Peter Panter in der Weltbühne notiert hatte. Zuletzt hatte er die Menschen durch seine Darstellung des zwielichtigen Titelhelden in Die Hände des Magiers beeindruckt, den Walter kürzlich im Palace in Maloja gesehen hatte, anderthalb Wegstunden vom Postamt entfernt, in dem er im Obergeschoss zwei kleine Zimmer mit Küche bewohnte. Ein Badezimmer gab es nicht, die Toilette war auf dem Flur, er wusch sich an der Spüle und stellte samstags eine Badewanne auf.
Er war den langen Weg dem Silser See entlang zu Fuß gegangen und hatte es nicht bereut. Nicht zum ersten Mal hatte Kupfer als Magier den Eindruck eines Zerrissenen hinterlassen, er war gefährlich, arrogant und attraktiv. Es fiel ihm offenbar nicht schwer, den Eigenschaften, die ihn berühmt gemacht hatten, treu zu bleiben.
In seinem ersten Film, dem Sensationserfolg Der schöne Heuchler, war Kupfer schon fünfunddreißig Jahre alt gewesen. Ein Stummfilm, in einer Nebenrolle Marlene Dietrich, damals noch unbekannt, vielleicht sogar ihr allererster Film, einer von vielen, die sie heute verleugnete.
Er war ein groß gewachsener Mann mit ausgeprägten Backenknochen, verschatteten Wangen und dünnem Lippenbärtchen, mit hohem Stirnansatz und rabenschwarzem Haar. Und hellen Augen, die müde blickten, als liege ein Schleier über ihnen. Sie waren von wässerigem Blau, wie alle bewundernd schrieben, die das Glück hatten, ihm leibhaftig zu begegnen. Ein Bild von einem Mann. Von italienischer Eleganz, mit französischem Esprit (man glaubte einen kaum wahrnehmbaren fremdartigen Akzent zu hören), getrieben von deutscher Willenskraft. Viril nannten ihn die Franzosen. Die blauen Augen sah man außer auf den gemalten Filmplakaten natürlich nicht. Der Farbfilm war noch ein fernes Gerücht.
Kupfer zog jeden in seinen Bann, und Walter noch ein bisschen mehr als andere. Walter träumte manchmal von ihm. So nah wie hier in Sils kam man ihm nirgendwo sonst, am ehesten, mit etwas Glück, wie Walter sich vorstellte, im fernen Berlin, wo er lebte, wenn er nicht drehte. Wo er auftauchte, bildeten sich Trauben von Menschen, die ihn umringten und ihn berühren wollten. Nun war er in Sils und Walter zu einem winzigen Teil der bunten, beweglichen Kulisse geworden, vor der sich Kupfer unsichtbar im Engadin bewegte. Von der Hand hinter dem Vorhang einmal abgesehen. Eine feinknochig weiße Hand mit langen Fingern. Da der genaue Zeitpunkt seiner Ankunft geheim gehalten worden war, hatte Walter nicht einmal nach der Kutsche Ausschau halten können, in der Kupfer von einem der Fuhrunternehmen – Mathis oder Conrad – vom Bahnhof in St. Moritz zum Hotel gefahren worden war. Er konnte in jeder sitzen und saß vielleicht in keiner. Er war nicht nur im Film ein Zauberer. War er nicht überirdisch?
Der Gedanke, ihm hier, abseits der großen Städte, Auge in Auge gegenüberzustehen, bereitete ihm Schwindel. Aber noch hatte sich ihm die Gelegenheit nicht geboten. In diesen Tagen schneite es oft, und sowohl die Kutscher als auch die Gemeinde- und Hotelangestellten hatten alle Hände voll zu tun, denn zum dauerhaften Erfolg eines Orts wie diesem gehörte das reibungslose Funktionieren sämtlicher Dienstleistungen, dazu gehörte auch, die Wege passierbar zu machen.
Walter betete den Schauspieler an wie alle, die ihn verehrten. Da er nicht der Einzige war, wusste er um die Bedeutungslosigkeit und Naivität seiner Schwärmerei. Sie war nichts als ein unsichtbarer Rausch in seinem Kopf und ging im Chor der anderen Bewunderer unter. Er war wie alle. Nur Kupfer war anders, er ragte aus der Menge heraus. Nichts sprach dagegen, dass er sich ihm zu Füßen geworfen hätte, wäre er plötzlich vor ihm gestanden.
Walter hatte seine neue Stelle auf Anweisung von oben angetreten. Mit ihm, der keine Entscheidungsbefugnis besaß, verfuhr man wie mit den allermeisten Angestellten nach Gutdünken und nicht nach seinen Wünschen oder Vorlieben. Nicht er, die Direktion entschied, was aus ihm wurde, zumindest solange er keine Familie gründete. Am Stadtrand von Bern in der Nähe der Kaserne aufgewachsen und bei der erstbesten Gelegenheit nach Zürich gezogen, war die Aussicht auf ein Leben in den Bergen zunächst niederschmetternd gewesen. Doch die Tatsache, dass die Zahl der fremden Besucher meist deutlich höher war als die der Einheimischen, hatte ihm die Eingewöhnung leicht gemacht. Und jetzt die Aussicht, Kupfer zu begegnen.
Die Aussicht, Kupfer zu begegnen, nahm dem Leben in den Bergen – selbst den ungezählten ereignislosen Abenden – die trostlose Gleichförmigkeit. Sie kolorierte es. Die Aussicht, Kupfer zu sehen, konnte durch keine Straße der Stadt, die er hatte verlassen müssen, überboten werden, mochte sie noch so belebt sein. Kupfer war am 13. Januar in Sils Maria eingetroffen.
Dass es Walter ausgerechnet hierher verschlagen hatte, war eine glückliche Fügung, die er gar nicht hätte forcieren können. Er war ein Rädchen im Getriebe, ohne Beziehungen und Ehrgeiz. Hatte es genützt, an Kupfer zu denken, um von seiner Anwesenheit in Sils zu hören?
Und dann kam er ihm eines Tages so nah wie dem Mondlicht, das ihn an jenem Abend traf, als er nach seinem Spaziergang zum Waldhaus pflichtgemäß die letzte Leerung des einzigen öffentlich zugänglichen Briefkastens am Postamt von Sils Maria vornahm. Dabei fiel ihm die Ansichtskarte in die Hände, die kein anderer als Kupfer selbst geschrieben hatte. Sie lag obenauf. Sie war offenkundig als letzte Sendung in den Briefkasten gesteckt worden. Ohne Kupfers Handschrift je zuvor gesehen zu haben, identifizierte er sie sofort. Sie tat ihre geheimnisvolle Wirkung, und Walter sah sich in einen Film versetzt, in dem er eine Rolle spielte, nur eine Statistenrolle zwar, doch war er in voller Größe im Bild. Das Mondlicht traf den Namenszug wie der Strahl eines Scheinwerfers. Euer Lionel stand groß und deutlich da. Die Karte ging nach Wien, so viel erkannte er. Die übrige Schrift war kleiner als die Unterschrift und im Mondlicht unleserlich.