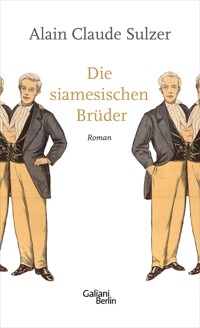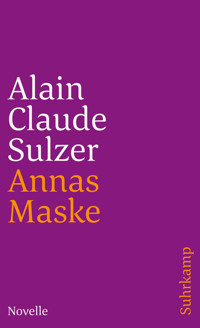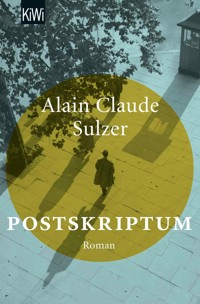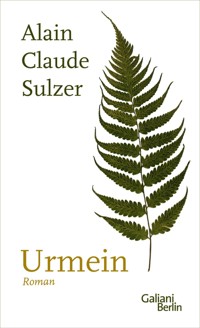
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1911 erwirbt ein italienischer Adeliger ein halb verfallenes Schloss in der Schweiz. Es liegt in Urmein, einem kleinen Dorf oberhalb von Thusis. Ausgewählte Freunde aus ganz Europa kommen hier zusammen, um einen geruhsamen Lebensabend zu verbringen. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bricht die neue Zeit in Gestalt eines jungen Soldaten über sie herein. Im Jahr 1911 erwirbt der italienische Graf Emilio Galli ein halb verfallenes Schloss; es liegt in Urmein am Fuße des Piz Beverin. Als Galli den mit verschwenderischer Pracht restaurierten Ruhesitz bezieht, ist er nicht allein: Ausgewählte Freunde aus halb Europa kommen zusammen – eine ungewöhnliche Gemeinschaft, in der sich die Lebensgeschichten von Künstlern und Abenteurern, von Reisenden und Damen der Gesellschaft kreuzen. Tagsüber in den weitläufigen Zimmerfluchten mit sich selbst beschäftigt, trifft man sich abends im exotisch angelegten Wintergarten. Doch dann bricht die neue Zeit herein in Gestalt des aus den Materialschlachten des Krieges zurückkehrenden Neffen Gallis. Mit stilistischem Glanz und großer Dichte zieht Alain Claude Sulzer seine Leser in eine Welt, die in ihrem Untergang noch einmal ihre ganze Pracht entfaltet. Schloss Urmein, das ist eine faszinierend gedachte Weltfluchtburg. Als Galli seine Utopie aufgibt und die Koffer packt, ist es 1918: Winter über Europa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alain Claude Sulzer
Urmein
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alain Claude Sulzer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alain Claude Sulzer
Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, darunter die Bestseller Zur falschen Zeit und Aus den Fugen sowie zuletzt den Roman Unhaltbare Zustände. Zu seinen weiteren Büchern zählen u.a. Postskriptum und Die Jugend ist ein fremdes Land. Urmein erschien zuerst im Jahr 1998.
Sulzers Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt, für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Prix Médicis étranger, den Hermann-Hesse-Preis und den Kulturpreis der Stadt Basel.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Im Jahr 1911 erwirbt der italienische Graf Emilio Galli ein halb verfallenes Schloss; es liegt in Urmein, einem kleinen Dorf oberhalb von Thusis am Fuße des Piz Beverin. Als Galli den mit verschwenderischer Pracht restaurierten Ruhesitz bezieht, ist er nicht allein: Ausgewählte Freunde aus halb Europ kommen zusammen – eine ungewöhnliche Gemeinschaft, in der sich die Lebensgeschichten von Künstlern und Abenteurern, von Reisenden und Damen der Gesellschaft kreuzen. Tagsüber in den weitläufigen Zimmerfluchten mit sich selbst beschäftigt, trifft man sich abends im exotisch angelegten Wintergarten. Doch dann bricht die neue Zeit herein in Gestalt des aus den Materialschlachten des Krieges zurückkehrenden Neffen Gallis.
Mit stilistischem Glanz und großer Dichte zieht Alain Claude Sulzer seine Leser in eine Welt, die in ihrem Untergang noch einmal ihre ganze Pracht entfaltet. Schloss Urmein, das ist eine faszinierend gedachte Weltfluchtburg. Als Galli seine Utopie aufgibt und die Koffer packt, ist es 1918: Winter über Europa.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Das Buch erschien erstmals 1998 beim Verlag Klett-Cotta, Stuttgart
Verlag Galiani Berlin
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covermotiv: Three fern fronds. Chromolithograph after a nature print. Credit: Wellcome Collection. CC BY
ISBN978-3-462-32157-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Erster Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
Zweiter Teil
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
Hinweis
Dank
für Georg Martin
Erster Teil
I
Im August 1913 ließ sich Graf Galli in Urmein, einem kleinen, weltabgeschiedenen Dorf oberhalb von Thusis, nieder. Bereits fünf Jahre zuvor, im Herbst des Jahres 1908, hatte er auf Anraten seines Mailänder Arztes Galliardi damit begonnen, sich nach einem Ort umzusehen, der es ihm erlauben würde, die letzten Jahre seines Lebens nach seinen Vorstellungen zu verbringen. Nach einigen Reisen durch Oberitalien und die italienische Schweiz, durch Teile Frankreichs und Graubündens, verschlug es ihn nach Chur, wo ihm eine befreundete Dame, die Witwe eines Diplomaten und Trägers des Ordens vom Kostbaren Stern, dazu riet, einen ihr bekannten, hier ansässigen Rechtsanwalt aufzusuchen; diesem war, wie man es der Frau des Diplomaten völlig richtig zugetragen hatte, durch eine Erbschaft eine Art Schloss oder Kloster zugefallen, das seit Jahren vergessen und unbewohnt, jedoch in leidlichem Zustand, seinem unaufhaltsamen Zerfall oder jenem neuen Eigentümer entgegensah, der es gnädig beleben wollte.
Eines Tages im Frühsommer 1911 unternahm der Graf, gemeinsam mit Dr. Feurer, dem Anwalt aus Chur, mit dem er zuvor korrespondiert und den er schließlich in seiner Kanzlei aufgesucht hatte, einen Ausflug nach Urmein; gemeinsam wollten sie den Besitz besichtigen, der beiden gleicherweise unbekannt war und von dem weder Fotografien existierten noch Zeichnungen oder Pläne überliefert waren. In Chur bestiegen sie die Rätische Bahn und fuhren bis Thusis, wo sie von einem vorab durch Dr. Feurer organisierten, von einem bärtigen Mann geführten offenen Zweispänner abgeholt wurden, der sie nach Urmein bringen sollte. Die beiden Herren – schwarz gekleidet bis auf die weißen Hemden – brachen frühmorgens auf und erreichten Urmein bei schönem Wetter zur Zeit des höchsten Sonnenstandes; als sie am Ziel dieses durch keinerlei Verzögerungen in die Länge gezogenen Ausflugs anlangten, hatte der Graf bereits alles Wissenswerte sowohl über Dr. Feurers Leben, das dieser als »ein wenig unordentlich« bezeichnete, als auch einiges Bemerkenswerte über jenes unbewegliche Erbteil erfahren, dessen er überraschend teilhaftig geworden und das zu besichtigen man eben im Begriff war.
Johann Rudolf Feurer war als Kind wohlhabender Eltern in Zürich aufgewachsen, wo er auch studiert und im Alter von vierundzwanzig Jahren, gegen den Rat, aber schließlich doch mit dem Segen seines Vaters, eine verarmte Oberländerin geheiratet hatte, die ihm drei Kinder schenkte, bevor sie ihn, wenige Monate nach der Geburt des Jüngsten, ohne Vorankündigung, ja ohne erkennbaren Grund verließ. Das erschütternde Erlebnis dieser unerwarteten und beleidigenden Trennung hatte, seinen Worten zufolge, sein Leben so gründlich verändert, dass er sich heute, fünfunddreißig Jahre später, nur noch mit Mühe an jene Frau erinnern konnte, die er einst geliebt und deren Verlust er viel zu lange beklagt hatte. Die Söhne hatte er ins Internat gegeben, sich selbst aber nach Chur zurückgezogen und dort eine Kanzlei eröffnet, nachdem das jüngste Kind, seine einzige Tochter, im Alter von fünf Jahren unter unvorstellbaren Qualen an toxischer Diphtherie gestorben war. In spätestens drei Jahren gedachte er seine Kanzlei zu schließen oder an seinen jüngsten Sohn abzutreten, der ebenfalls Jurist und in der Lage sei, seine Geschäfte weiterzuführen, zumal sich auch Chur in den letzten Jahren zu einer Goldgrube für rechtskundige Leute entwickelt habe. Auf die Frage des Grafen, warum er denn kein zweites Mal geheiratet habe, lachte Dr. Feurer nur und führte, nicht gerade überzeugend, seine vielfältige juristische Tätigkeit ins Feld, die ihn viele Jahre lang so sehr in Anspruch genommen habe, dass es ihm unmöglich gewesen wäre, eine Wiedervermählung auch nur in Erwägung zu ziehen. Im Übrigen habe ihm der gattenlose Zustand eine Freiheit gewährt, von der er früher nicht einmal zu träumen gewagt hatte.
Bezüglich des Besitzes in Urmein tappte er, wie sich herausstellte, nahezu im Dunkeln. Zwar bestand keine Ungewissheit über das Erbe und die Besitzverhältnisse, doch herrschte völlige Unklarheit über das Alter und die Geschichte des Hauses (für welche der Graf zu Dr. Feurers Erleichterung übrigens kaum Interesse zeigte). Das Kloster oder Schloss – das Testament schwankte unschlüssig zwischen beiden Begriffen – hatte bis vor Kurzem einer ungefähr gleichaltrigen Kusine zweiten Grades gehört, der Tochter eines Vetters seines Vaters, die vor einem knappen halben Jahr (»… unerwartet, wie ich schon sagte …«) in Paris gestorben war. Als kleines Kind, so erinnerte sich Dr. Feurer, sei das unter schweren Asthmaanfällen leidende Mädchen des Öfteren nach Urmein zu einer Tante geschickt worden, über die sie, jedenfalls mit ihm, ebenso selten gesprochen habe wie über das Haus, das sie kurz nach Vollendung ihres zwanzigsten Lebensjahrs von ihrer kinderlosen, frommen Verwandten geerbt hatte, ohne jedoch, soviel er wisse, jemals dorthin zurückgekehrt zu sein oder sich gar um das Wohlergehen der wenigen noch lebenden Bewohnerinnen ihres neuen Besitzes gekümmert zu haben. Sie war nach Paris gezogen, um Künstlerin zu werden, hatte sich aber, statt selbst zu malen, bald damit begnügt, unentgeltlich vor zweitklassigen, ominösen Schulen angehörenden Malern in allen nur erdenklichen Positionen, nicht selten nackt, Modell zu sitzen und zu liegen. Einige Ergebnisse dieser luxuriösen und frivolen Zeitverschwendung hatte er bei einer Ausstellung in Paris mit ebenso ehrlichem wie angebrachtem, allerdings unterdrücktem Entsetzen zu Gesicht bekommen. Als ihn Marie-Theres, sichtlich stolz auf ihre inspiratorischen Fähigkeiten, um seine ehrliche Meinung zu den um größtmögliche Hässlichkeit bemühten Bildern bat, verschwieg er diese zugunsten fadenscheiniger Ausflüchte, die sie dennoch überzeugten, und zog es nach diesem peinlichen Zusammentreffen mit ihr und ihren entblößten Konterfeis oder besser contrefaits vor, bei künftigen Parisbesuchen im Georges V. abzusteigen, ohne seine Kusine davon in Kenntnis zu setzen. Nach Paris fuhr er – auch weiterhin – regelmäßig aus eben jenen Gründen (er hatte sich zum Grafen vorgebeugt), aus denen kleine Geister die Stadt gerade mieden; dem lockenden Ruf des restaurierten Babels hatte er nur selten widerstehen können. Obwohl seine Ausführungen den rügenden Worten, mit denen Feurer seine befreite Kusine bedacht hatte, ausdrücklich widersprachen, verzog der Graf keine Miene, was Dr. Feurer dazu bewog, zum ursprünglichen Gegenstand seiner Konversation zurückzukehren und eine passendere Gelegenheit abzuwarten, um von weiteren Ausschweifungen zu sprechen.
Marie-Theres’ Tod hatte ihn (»… wie ich schon sagte …«) völlig überraschend getroffen, nachdem er – im Flug waren die Jahrzehnte vergangen – immer seltener Nachricht von ihr erhalten hatte. Es war ihm bekannt gewesen, dass sie sich um die Jahrhundertwende im Westen von Paris, in der Nähe des Bois de Boulogne niedergelassen und von sämtlichen schöpferischen wie darstellerischen Ambitionen Abstand genommen hatte. Auch war ihm durch Bekannte aus Rhäzüns zu Ohren gekommen, dass um 1905 die letzte Urmeiner Stiftsdame gestorben, jedoch erst etliche vierzehn Tage nach ihrem Ableben, mumientrocken, fast unverwest und offenbar verhungert, entdeckt worden war. Mit gefalteten Knochen hatte sie in ihrem schmutzigen Bett gelegen.
So verging die Bahnfahrt von Chur nach Thusis und die Kutschfahrt von dort ins fast sechshundert Meter höher gelegene Urmein mit Erzählungen des mangels Gelegenheiten äußerst redseligen Rechtsanwalts. Wenn ihn der wortkarge Graf hin und wieder durch kurze Fragen unterbrach, dann nicht etwa, um ihn zum Schweigen zu bringen, sondern um den ungehinderten Redefluss zu fördern, der ihn selbst der Sorge enthob, mit dem Geplauder des Schweizers konkurrieren zu müssen. Sein Blick schweifte ins scharf umrissene, blau getönte Gebirge ab, das zum Bersten gläsern wirkte. Während Pferde und Wagen sich allmählich den Bergen näherten, entfernte er selbst sich immer weiter davon.
Die beiden Pferde hatten Mühe, den steilen, stellenweise aufgeworfenen, mit Geröll bedeckten Pfad zu überwinden, der sich in engen Serpentinen nach oben wand und den quer über dem Weg liegende Aste schwer passierbar machten. Mehrmals blieben die Tiere einfach stehen, scheuten vor niedrigen Gesteinswänden, die, wie der Graf entdeckte, spärlich mit blühenden Alpenrosen bedeckt waren, und setzten sich erst wieder in Bewegung, nachdem der Kutscher laut fluchend auf sie eingeschlagen hatte. Als Dr. Feurer diesen, in einem dem Grafen unverständlichen, ihn geradezu peinlich berührenden breiten Dialekt um etwas mehr Zurückhaltung bei der Verwendung solcher Ausdrücke bat, wandte sich der Kutscher grinsend zu den beiden Herren um, riss sich den fleckigen, mit einer beinahe fahnenlosen Feder besteckten grauen Filzhut vom Kopf, grüßte mit ausgestrecktem Arm in die menschenleere Landschaft und gab einen so wilden Laut von sich, dass selbst seine Pferde erschraken; auf der Stelle verfielen sie in eine schnellere Gangart. »Will der Kerl uns in die Hölle fahren?«, fragte Galli Dr. Feurer, doch war auch diesem unklar, was das animalische, von Felswänden zurück- und aus Senken heraufhallende Gebrüll des Kutschers zu bedeuten hatte. Doch wenn es sich auch ihrem Verständnis entzog, hatte es jedenfalls, wie sich bald herausstellen sollte, die Wirkung eines Signals und ersetzte somit die vorauseilende Botschaft eines Horns.
Nach einer letzten, von den Pferden gefährlich schwungvoll genommenen Biegung nach links, gelangten sie zu einer lärchenbestandenen Anhöhe, zu deren Füßen Urmein in einer ovalen Mulde lag. Von dieser Arena stiegen ringsum zahllose Stufen von unterschiedlicher Höhe an und verliehen der Landschaft, in die das Dorf gebettet war, das Aussehen eines Stadions, das in die Berge versetzt worden war und sich hier in allen Einzelheiten der in dieser Höhe noch fast sanften, kaum zerklüfteten Bergwelt angepasst hatte. Befremdet und entzückt, staunte vor allem der Graf über dieses vom Föhn in scharfen Umrissen wiedergegebene Landschaftswunder, das sich ausnahm, als sei es von einem in hohem Maße beseelten Baumeister angelegt worden, der seinen ganzen Ehrgeiz darein gesetzt hatte, der kühnen, hochgegriffenen Welt hier oben einen Anstrich von mediterraner Gelassenheit und antiker Größe zu geben. Das Dorf selbst, an dessen äußerstem Ende sich unübersehbar der runde, tatsächlich an ein Schloss erinnernde Turm des ehemaligen Stifts erhob, bestand aus schwermütig wirkenden Holz- und Steinhäusern, deren Schindeldächer an vielen Stellen schadhaft waren.
Etwa fünfzehn Einheimische, die zweifellos durch den merkwürdigen Ruf des Kutschers angezogen worden waren, standen herum und bildeten im Verein mit einigen Hunden ein misstrauisches Empfangskomitee, als das Gefährt mit den beiden Fremden den Dorfplatz erreichte, der sich im Zentrum jener naturgegebenen Arena befand, die sich von der Anhöhe aus ihren Blicken geboten hatte. In der Mitte des Platzes stand ein oktogonaler Brunnentrog, dessen gewölbter Rand mit dunklem Moos bedeckt war. Mehrere Kinder saßen darauf, darunter ein blondes, recht hübsches Mädchen mit geröteten Wangen, das die Fremden mit verdüsterter Miene anstarrte. Den Grafen fror beim Anblick dieses Kindes, das die Fingerspitzen seiner nach hinten gebogenen Hände ins kalte Wasser getaucht hatte, sodass Dr. Feurer ihm riet, sich eine der Wolldecken, die in der Kutsche lagen, um die Schultern zu legen. Galli winkte ab, und Feurer wandte sich an die Umstehenden. Er erkundigte sich nach dem Kloster, dessen neuer Eigentümer er sei. Dem Grafen unverständliche Stimmen wurden laut und erstarben, wonach ein etwa sechzigjähriger Mann vortrat, dem Grafen – nicht etwa Feurer – die Hand entgegenstreckte (die zu nehmen sich dieser weigerte) und den beiden Herren anbot, sie zur Klosterruine zu führen. Da dieser zwar willkommenen, aber recht unspektakulären Alltagsunterbrechung offenbar keine weiteren Höhepunkte abzugewinnen waren, zogen sich die Neugierigen zurück, teils in ihre Häuser, teils unter die Haustüren; man entfernte sich oder hielt in kleinen, schweigenden Gruppen Abstand zu den beiden nicht ganz geheuren Städtern, denen man mit einer Reserve begegnete, die dem Grafen keineswegs unangenehm war. Denn die Zurückhaltung, die die Urmeiner heute an den Tag legten, würde ihm, im Fall, dass er sich hier niederließ, morgen jene Ruhe gewährleisten, die er suchte. »Sie scheinen ein wenig verunsichert zu sein«, meinte Dr. Feurer leise zum Grafen und wandte sich dann an den Mann, der sie zum Kloster führen wollte, das von diesem tiefer gelegenen Punkt aus nicht zu sehen war. »Wir nehmen Ihre Dienste dankend in Anspruch«, sagte Dr. Feurer und unterstrich seine Worte mit einer Bewegung zu seinem Begleiter hin, der lediglich nickte und mit seinem Stock leicht auf das unregelmäßig gesetzte Pflaster schlug. Inzwischen hatte der Kutscher, der den Urmeinern wohl bekannt war, die Pferde ausgespannt und zur Tränke geführt, wo sie sogleich zu trinken begannen. Das blasse Mädchen erhob sich von seinem natürlichen Polster und entfernte sich durch eine der fünf schmalen Gassen, die vom Platz ins dunkle Nichts zu fuhren schienen, während sich hoch über dessen Häuserreihen eine nahtlose Kette von Bergen erhob, deren höchster der Beverin sei, wie man den Besuchern aus dem Tal erklärte. Dem Grafen fiel auf, dass dem Mädchen, das nun gerade verschwand, nichts Bäuerisches, im Gegenteil etwas sehr Weltgewandtes eigen war, das auffallend mit seiner Umgebung kontrastierte. Das Kloster befinde sich nur wenige Schritte außerhalb des Dorfes, auf der anderen Seite des Orts, erklärte der hilfsbereite Mann, den der Graf daraufhin in gebrochenem, aber verständlichem Deutsch nach seinem Namen und Beruf fragte. Erfreut darüber, von dem alten Herrn angesprochen worden zu sein, von dem eine einschüchternde Wirkung ausging (eine Mischung aus schneidender Kälte und unbestechlicher Hellsichtigkeit), antwortete er, er heiße Roth und habe früher, als die frommen Madames noch lebten, im Kloster hin und wieder kleinere Arbeiten verrichtet, denn er sei Schmied – man unterbrach ihn, er möge vorausgehen, was er auch tat.
Es entging dem Grafen nicht, dass die Zurückgebliebenen ihren Abgang von der dörflichen Bühne dazu nutzten, sich dem Kutscher zu nähern, um ihn mit Fragen nach den beiden Städtern zu bedrängen. Dieser wusste allerdings nicht mehr, als dass der Schweizer, den er für einen Arzt hielt, Doktor Feurer heiße und in Chur wohne (»… aber er ist Zürcher, das hört man!«), von wo aus man die Kutsche für diesen Tag bestellt hatte. Dass er der neue Besitzer des Schlosses sei, wüssten sie ja nun, und dass der alte Mann, ein italienischer Graf, sich für das verfallene Gemäuer interessiere, liege seiner Meinung nach auf der Hand. Man wunderte sich ein wenig über den Besuch eines ausländischen Adeligen in dieser Gegend, und der eine oder andere mochte sich in diesem Augenblick insgeheim ausmalen, welche Annehmlichkeiten die Zuwanderung eines solchen Mannes für das heimische Handwerk, für die weibliche Bevölkerung und das Gemeinwesen im Allgemeinen mit sich bringen würde. Oft schon hatte man, mehr befremdet als neidisch, von den segensreichen Auswirkungen des Ferienaufenthalts von Engländern und Franzosen gehört, die Berg- und Gletscherwanderungen oder gar Kletterpartien unternahmen oder Ski fuhren, deren Anwesenheit den Einheimischen mithin zahlreiche Möglichkeiten bot, sich an den Diensten, die man diesen sogenannten Touristen erwies, auf unverfängliche Weise zu bereichern.
Roth schritt voran, ihm folgte der aufmerksame Dr. Feurer, der Graf bildete den Schluss und schien in Gedanken versunken. Die gewundene Gasse, an der die kleine protestantische Kirche mit dem zwiebelförmigen Helm, einige unbewohnt wirkende Häuser und etliche Misthaufen lagen, auf denen Hühner kratzten, wurde breiter und mündete schließlich in einen Feldweg, der steil anstieg.
Der Graf blieb stehen. Er konnte sich eines Ausrufs des Entzückens nicht enthalten: Hinter einer von lang andauernden Frösten stark beschädigten, an manchen Stellen völlig zusammengebrochenen Mauer, die den Besitz längst nicht mehr schützte, ragte – durch hohe Bäume den Blicken halb entzogen – der aus Quadern geschichtete, rötlich schimmernde Turm des Klosters auf. Die drei Fußgänger gelangten zu einem schmiedeeisernen Tor jüngeren Datums, hinter dem sich eine verwilderte Allee erstreckte, deren von mannshohem Gebüsch umwucherte Bäume wohl seit Jahrzehnten nicht mehr geschnitten worden waren. Am Ende dieser künstlichen Passage, die sich die Natur längst zurückerobert hatte, stand das Kloster, eine unübersichtliche Anlage, die, so viel war selbst von hier aus zu erkennen, aus zwei Gebäudekomplexen ungleichen Umfangs und unterschiedlicher Höhe bestand, die lediglich durch einen Säulengang – und den Turm – miteinander verbunden waren.
Roth stieß einen der Torflügel auf. Es machte den Anschein, als seien die beiden unvereinbaren Gebäudeteile willkürlich zusammengefügt und schließlich, vermutlich erst im vergangenen Jahrhundert, durch einen Turm gekrönt worden, der sie weit überragte. Die Strapazen der Reise hatten sich gelohnt, wie teuer den Grafen der Erwerb des Grundstücks auch zu stehen käme, das, laut Dr. Feurer, insgesamt drei Hektar Land und Wald umfasste. Die Begeisterung, die Galli beim Anblick des Besitzes nicht zu unterdrücken vermochte, war so ansteckend, dass sie sich auf den ursprünglich von Dr. Feurer vorgesehenen Kaufpreis übertrug, der in seinem Kopf augenblicklich in die Höhe schnellte.
Lage und Architektur des Anwesens, das auf den Italiener keineswegs klösterlich wirkte, entsprachen seinen Vorstellungen, ja erreichten fast das Idealbild seiner lang gehegten Träume, und übertrafen jedenfalls alles, was er bis zu diesem Tag besichtigt und nach langen Überlegungen – am Ende beinahe entschlossen, sein vermutlich viel zu ehrgeiziges Vorhaben aufzugeben – doch immer wieder verworfen hatte. Es müsste hier, an diesem Ort, wo alles darauf angelegt schien, seinen Absichten zu dienen, ein leichtes sein, jene sich aus dem Ungewissen, Verschwimmenden, Auseinanderstrebenden bildende Einheit zu verwirklichen, die ihm vorschwebte. Die architektonischen Bedingungen, die nach außen und innen wirkenden baulichen Gegebenheiten, schienen wie geschaffen, dem Ideal des Grafen einen festen Rahmen zu geben, den selbst die Forderung nach uneingeschränkter Bequemlichkeit nicht sprengen konnte. Es würde gewiss keiner besonderen Anstrengungen bedürfen, die Wirtschaftsgebäude und Unterkünfte der Dienerschaft von den Wohnräumen seiner Gäste zu trennen, sodass deren und sein eigenes Wohlbefinden durch den Lärm und die Gerüche, welche die verschiedenen Tätigkeiten der Domestiken notwendig verursachten, nicht unnötig gestört wurde. Die zur Allee hin offenen Arkaden, die in recht gutem Zustand waren, eigneten sich vortrefflich als Verbindungsglied zwischen der Welt der Pensionäre und jener der Bediensteten und garantierten, vorausgesetzt das Personal war ausreichend geschult, die prompte und korrekte Ausführung von Anordnungen und zugleich absolute Diskretion (auf deren Einhaltung man besonders achten würde), während von der Gesamtheit der Räumlichkeiten gewiss auch nach einem gründlichen Umbau der Zauber des Vergangenen, der Reiz versteinerter Beständigkeit ausginge, die durch nichts mehr zu erschüttern war, weder durch ihn noch seine Gäste noch gar durch jene neue Zeit, der sich zu entziehen er fest entschlossen war. Der rechte, etwas kleinere Komplex war wie geschaffen, die Dienstbotenräume aufzunehmen, während er und seine Freunde sich für den Rest ihrer Tage in den linken Teil zurückziehen würden.
Sie passierten das eiserne Tor, das Roth ihnen aufhielt, im selben Augenblick, als sich ein Sonnenstrahl längs über die Allee legte; von drängenden Wolken gejagt, huschte er darüber hinweg und öffnete sich wie ein brennender Vorhang über den kannelierten Säulen, dem schadhaften Dach, das sie trugen, und über dem Turm. Gewiss, was sie da sahen und was der Graf so fassungslos bewunderte, dass er nun leise stöhnte, ähnelte gemalten, mittels Licht- und Schattenspielen belebten Kulissen, die ihre Wirkung besser in jenen Opernhäusern entfalteten, für die sie erdacht waren, als draußen in der Welt, von der sie nur ein schwaches Abbild geben konnten; aber war es nicht gerade das, wonach Emilio Guido Conte Galli seit über einem Jahr in Frankreich, Italien und der Schweiz so rastlos wie vergeblich gesucht hatte: Ein Ort, an dem er selbst bestimmen konnte, wie spät es wirklich war? Ein Ort, an dem die Zeit desinteressiert und achselzuckend vorbeigeflossen war, weshalb die einzigen Spuren, die sie hinterlassen hatte, die Spuren des Zerfalls waren. Reglos, steinern und von der alles erstickenden Epoche vergessen, lag das Urmeiner Schloss als ein hereingeschobenes Requisit vor ihnen, zeitlos und fordernd. Es wartete darauf, auch im Inneren beleuchtet zu werden. Zwischen diesen Mauern würde es ihm zweifellos besser als irgendwo anders gelingen, seine mit zunehmendem Alter fast störrisch verfolgte Absicht zu verwirklichen, die ihm verbleibenden, vielleicht nur wenigen und wohl ein bisschen mageren Jahre auf eine Weise und in einer Umgebung zu verbringen, die von seinem bisherigen Leben den denkbar größten Abstand nahm. Dem Tod würde auch er nicht entwischen. Doch war er entschlossen, sich nicht überrumpeln zu lassen; er wollte den Fremden zu sich bitten, bevor es diesem gelang, ihn bei sich einzusperren. Der unbequeme, aber notwendige Weg ließ sich besser an einem unbekannten Ort beschreiten, als in jener gewohnten Umgebung, in der ihn die neue Zeit längst eingeholt, ihr Geist schon überholt hatte; jene Gegenwart, die sich darin erschöpfte, mit unvorstellbarer Geschwindigkeit, gleich einem rasenden, sich durch eigene Kraft vertausendfachenden Athleten, in bisher gemiedene, unerforschte oder verbotene Bezirke vorzustoßen, konnte hier mit List umgangen werden. Es war entbehrlich, ein Prophet zu sein, der die mit stinkenden Gasen gefüllte Schweinsblase über kurz oder lang platzen sah. Die Abgeschiedenheit im Kreis von gleichgesinnten Altersgenossen versprach heilsame und dauerhafte Abkehr von allem, was ihn – und die anderen – nun nicht mehr kümmerte, oder was um jeden Preis zu ignorieren er entschlossen war; mochten Jüngere davon halten, was sie wollten.
Feurer, der nicht die Gabe besaß, in Gesichtern zu lesen oder Gesten zu deuten, bemerkte gleichwohl das nervöse Zucken, das an den Augenwinkeln seines Begleiters zerrte; er konnte es sich nicht erklären. Er verhielt den Schritt und gab dem Grafen Gelegenheit, ihn zu überholen. »Seltsam«, sagte er. »Fast eine Ruine und doch noch einiges Leben. Als ob die alten Fräuleins uns beobachteten.«
»Ich kaufe das Schloss«, sagte Galli unvermittelt, und Dr. Feurer nickte und sprach im Gehen: »Sie wollen es kaufen? Sie haben recht. Wäre ich jünger, würde ich keinen Augenblick zögern, mich hier niederzulassen. Ich fürchte auch ein wenig die Einsamkeit. Sie werden den Kauf nicht bereuen, Conte.« Er horchte auf und bemerkte in einer Anwandlung romantischer Empfindung: »Man möchte meinen, die Hufe von Pompejus Plantas Pferd zu hören!« Doch der in der deutschen Literatur wenig bewanderte Italiener hörte nichts dergleichen (und hätte sicher auch dann nichts gehört, wäre er es gewesen).
»Sie scheuen die Kosten, den Aufwand und die Arbeit, all das nicht?« Der Graf schüttelte den Kopf und ging weiter. Sogleich setzte sich auch Roth in Bewegung, ihm folgte der Rechtsanwalt, dessen letzte Worte im auffliegenden Rauschen der Bäume untergingen, während seine Gedanken das Alter umkreisten, das ihm nunmehr noch etwas gesicherter schien als am Tag zuvor.
II
Da sie keine Koffer besaß, war sie gezwungen, ihren gesamten Besitz – viel war das nicht – in dem aus Weiden geflochtenen, mit zwei Schlössern versehenen sperrigen Reisekorb unterzubringen, der aufgeschlagen neben dem abgezogenen, schmalen Leutebett stand, in dem sie, abgesehen von ihrem Aufenthalt im St.Josephs-Hospital, an den sie sich nur mit Schaudern erinnerte, jede Nacht der vergangenen vier Jahre verbracht hatte; meist zu erschöpft, um geheimen Gedanken feste Konturen zu geben. Hatte ihre Kindheit nur in Träumen stattgefunden? Nichts war ihr, die längst zum stets verfügbaren Bestand fremder Haushalte gehörte, ferner als die eigene, unendlich weit zurückliegende Vergangenheit. Sie nahm den Stapel rüschenbesetzter Küchenschürzen aus hellblauem Cretonne vom Bett, bückte sich zum Reisekorb und legte sie auf die schneeweißen, mit Lochstickerei versehenen Tändelschürzen, die sie auf ausdrücklichen Wunsch der Herrschaft stets nachmittags zum Tee getragen und alle zwei Tage gewechselt hatte. Sie richtete sich wieder auf, hielt inne, starrte auf die dreiteilige, hoch gefederte Matratze, auf der sie sich zumindest nachts für Augenblicke der Täuschung hatte hingeben können, von einer unsichtbaren Last befreit zu sein, und bemerkte nun zum ersten Mal zwei faustgroße, braun geränderte Flecken auf der mittleren Matratze sowie mehrere kleine Brandlöcher auf dem Keilkissen; Verunstaltungen, die darauf hindeuteten, dass eine ihrer Vorgängerinnen (oder deren Liebhaber) heimlich geraucht hatte und eine andere, wenn nicht dieselbe, das beklagenswerte Opfer starker Blutungen gewesen war, deren Ursache sie nie erfahren würde. Spuren, die ihr bisher entgangen waren, weil sie nur selten Zeit gefunden hatte, sich bei Tageslicht hier oben aufzuhalten; Spuren, ähnlich jenen, die sie an anderer Stelle wohl selber hinterlassen hatte.
Sophie trug einen Unterrock, eine weiße, mit Spitzenborten verzierte Bluse, schwarze Lackschuhe und graue Strümpfe, die den Blicken ihrer Mitmenschen selbst die Farbe ihrer Fesseln entzogen. Auf dem Stuhl lag der Hut, der kürzlich aus Breslau eingetroffen war; in Wirklichkeit nicht ganz so herrlich wie das Exemplar, das im Katalog des Modehauses Henel gelockt hatte. Die Ohrringe, in Gold gefasste, tropfenförmige Granate, waren ebenso wie der kleine, smaragdäugig blitzende Schlangenring am Mittelfinger ihrer rechten Hand Hinterlassenschaften ihrer Mutter, Erinnerungen an Versprechungen einer sorglosen Kindheit, die in jede nur erdenkliche leuchtende Zukunft außer eben jener gewiesen hatte, die sich schließlich in erzwungener Bescheidenheit und dienstfertiger Abhängigkeit erfüllte. Sie trug die Ohrringe und den Ring nur selten; aber wenn sie sich damit schmückte, an Feiertagen etwa, fühlte sie, wie sich das unbekümmerte Auftreten ihrer verstorbenen Mutter auf sie übertrug und ihr für Augenblicke sogar das schmerzhafte Gehen erleichterte. Sobald sie aber an den Ort zurückkehrte, wohin das Verhalten ihrer Mutter sie geführt hatte, fiel jede Fröhlichkeit von ihr ab. Sie wich dem stetig glimmenden, schmerzlichen Hass auf jene Frau, die ihr gesamtes Vermögen einer Person vermacht hatte, deren Namen Sophie niemals aussprach, wenngleich er immer in ihr umging. Die eigene Mutter hatte sie leichtfertig jener Zukunft beraubt, für die sie sie erzogen hatte. Kaum lagen die Schmuckstücke wieder in ihrer wattierten Hülle, kehrten die unerklärlichen Schmerzen in ihren fehlenden Gliedmaßen zurück.
Was ihr überflüssig erschienen war oder worauf sie glaubte verzichten zu können, lag nun zusammengedrängt auf der dicht an die Wand geschobenen Waschkommode, die den Wind davon abhalten sollte, durch den breitesten der unzähligen senkrechten Risse zu dringen, die kalte Wintertage und heiße Sommer in die Giebelwand gesprengt hatten. Sophies Wohnung lag ungeschützt, durch keine Umfassung begrenzt, unter dem Dach und war nicht mehr als eine in eine Ecke des weitläufigen Dachbodens gedrängte Schlafgelegenheit, die aus einem Bett bestand, um das herum sich in trostloser Verlorenheit ein spiegelloser Schrank mit fehlender Rückwand, ein selten benutzter Stuhl und eben die Kommode gruppierten, an der sie sich jeden Morgen gewaschen und gekämmt hatte und auf deren Marmorplatte nun jene Habseligkeiten lagen, die sie entbehren konnte: Die Taschenbibel, die ihr eine der frommen Schwestern des Hospitals zum Abschied überreicht hatte, ein gänzlich entfärbter Strauß Trockenblumen, der all die Jahre an einem der vier Bettpfosten gehangen hatte und von dem noch immer ein herber Geruch ausging, ein einfältig bemaltes Kästchen, in dem sich, wie sie sich vergewissert hatte, nichts außer einem fast zahnlosen Kamm befand – lauter Dinge, die sie vergessen haben würde, sobald dies Haus sowie die Zeit, die sie darin verbrachte hatte, hinter ihr lag.
Sie beugte sich, zwei frisch gebügelte Mullblusen in den Händen, über den Reisekorb, als sie durch eines jener Geräusche, an die sie sich nie gewöhnt hatte, in ihrer Tätigkeit unterbrochen wurde. Sie erstarrte, wandte sich in gebückter Haltung langsam um, sah aber nichts außer jener unveränderlichen, in die Jahre gekommenen, staubbedeckten Unordnung, an die zu rühren niemand seine Zeit verschwenden wollte und deren Anblick Sophie noch immer in leise Angst vor dem versetzte, was sie nicht sehen, aber ahnen konnte, weshalb sie nachts ihre Schritte niemals von jener Gasse weggelenkt hatte, die von Stühlen, Kisten und andere Gegenständen gebildet wurde, jener Gasse, die auf Umwegen von der Dachbodentür zu ihrem Bett führte, vorbei an grinsenden Schränken, selbstgefälligen Koffern, amputierten Tischen und vielen undeutlichen Gebilden, die im Schein des flackernden Kerzenlichts, das sie vor sich hertrug, bedrohliche Schatten warfen, die ihr entgegeneilten und hinter ihr verschwanden.
Sie glaubte weder an Gespenster noch an finstere Mächte, doch gegen die Gewalt rätselhafter Geräusche, deren Ursache sie nicht kannte und von denen sie nicht wusste, wo sie entstanden, war auch sie nicht gefeit. Sie schrie nicht auf, sie schrie nie auf, sie zuckte vor dem, was ihr kalt über die Haut fuhr, lediglich zusammen und dachte dann, wie immer, dass sie ja Schlimmeres gewöhnt sei. Es verstrich auch tagsüber kaum eine Minute, in der es im Dachgestühl, das unter der Hitze und Kälte ebenso zu leiden schien wie seine Bewohner, nicht knarrte. Doch jetzt, am helllichten Tag, schreckten die Geräusche sie weniger als nachts. Bereits morgen würden sie für immer der Vergangenheit angehören, denn auf einem Speicher würde sie in ihrer neuen Anstellung nicht wohnen.
Sie drückte die Blusen fest auf die gestärkten Schürzen und versenkte dann das Paar kostbarer Handschuhe in der Lücke zwischen den bunten wollenen Servierkleidern und dem halben Dutzend Schiffchen- und sichelförmiger Batist- und Baumwollhäubchen. Frau von Schmidthals hatte ihr die selten getragenen sämischledernen Handschuhe am selben Tag geschenkt, an dem die nach Ansicht der Herrschaft längst überfällige elektrische Klingelvorrichtung über eine Entfernung von vier Etagen bis zum Dachboden verlegt und die kleine, schrill tönende Glocke über ihrem Bett installiert worden war. Von da an waren Sophie, die Köchin und der Hausdiener stets und überall im Haus zu erreichen gewesen, selbst dann, wenn sie zwei Stockwerke über den oberen Wohnräumen ihrer Herrschaft oder, im Falle der Köchin, in unmittelbarer Nähe der Küche schon schliefen. Kürzere oder längere Klingelzeichen gaben – nicht immer deutlich genug – zu verstehen, nach welchem der Hausangestellten gerade verlangt wurde; zweimaliges, langes Schellen hatte Sophie gegolten.
Anders als Johann Hunger, der um einige Jahre älter war als Sophie und Herrn von Schmidthals bereits in seiner Jugend als Offiziersbusche gedient hatte (ohne in der Fremde seinen kuriosen Akzent verloren zu haben), anders als diesem war Sophie keines der beiden mit Fenstern versehenen Mansardenzimmer, sondern bloß dieses frei stehende Bett auf dem offenen Dachboden zugewiesen worden, während die Köchin im Hängeboden untergebracht war, der sich zwischen Küche und Badezimmer befand und nur über eine kleine Leiter erreicht werden konnte.
Von ihrem Bett aus, auf dem sie sich erst dann behaglich fühlte, wenn die eigene Körpertemperatur die Laken zu erwärmen begann, hatte Sophie vier Jahre lang auf schwammfeuchte, schwarz gesprenkelte Backsteinwände, auf morsche Dachsparren, nackte, mit Schindeln unterlegte Ziegel und verlassene Spinnennetze geblickt und ständig fürchten müssen, dass es einer der ihr äußerst widerwärtigen Tauben gelingen könnte, durch ein unerreichbar hoch gelegenes, unsichtbares Schlupfloch in den Dachstuhl einzudringen, wie es schon öfters vorgekommen war. Ohne fremde Hilfe hatte bisher keine den Ausgang gefunden, und wenn Johann Hunger nicht in der Nähe war, den sie nur ungern behelligte, blieb ihr nichts anderes übrig, als den Vogel eigenhändig ins Freie zu scheuchen. Während ihr die Vorstellung, heimlich von einer oder mehreren Tauben angestarrt zu werden, alles andere als behagte, hatte sie sich bald an die Holzteilchen und Ziegelsplitter gewöhnt, die dann und wann auf sie herunterrieselten, und geradezu beruhigend wirkte das Geräusch des Regens, der aufs Dach prasselte; selbst das Pfeifen und Trippeln hin und her huschender Mäuse hatte sie nicht geängstigt.
Während vier langen Jahren war sie bei den von Schmidthalsens in Diensten gewesen und, wie ihr schien, um das Dreifache gealtert (sie war nun vierunddreißig), obwohl man ihr das Leben weder unnötig noch absichtlich schwer gemacht zu haben glaubte. Ihr Arbeitstag hatte sich in nichts von den Arbeitstagen anderer Hausangestellter unterschieden – er dauerte von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends und jeweils länger, wenn die Herrschaften ausgingen oder empfingen –, man hatte sie gerecht behandelt und nicht über Gebühr zu beanspruchen versucht. Zudringlichkeiten seitens des Hausherrn, vor welchen man sie vor Antritt ihrer Stellung im Vermietungscomptoir gewarnt und denen nötigenfalls nachzugeben man ihr ganz unverblümt geraten hatte, waren ausgeblieben. Herr von Schmidthals, Offizier zur Disposition, untersetzt und kahlköpfig, schien über seine eigene Gattin hinaus – die er nur dann betrachtete, wenn sie sich unbeobachtet glaubte – kein Interesse an Frauen zu haben, und die beiden oft reisenden, deshalb nur selten in Erscheinung tretenden, nicht sonderlich attraktiven Söhne waren bereits aus dem Haus (einer schon verheiratet), als Sophie ihre Berliner Stellung antrat.
Emilie, Henriette und Alexandra, die drei Schmidthals’schen Töchter, waren nach anfänglicher Zutraulichkeit von herablassender Freundlichkeit. Sie hatten inzwischen wohl vergessen, dass ihre Herkunft sich von der des elsässischen Hausmädchens nur unwesentlich unterschied. Als könnte kühle Unverbindlichkeit sie davor bewahren, von einem ähnlichen Schicksalsschlag heimgesucht zu werden wie Sophie, behandelten sie das Mädchen noch etwas förmlicher als die Köchin – und sprachen freier, geradezu vorlaut immer nur dann, wenn sie allein waren oder wenn Johann sich näherte (um zu verstummen, sobald er da war), an den sie seit frühester Kindheit gewöhnt waren, der aber, so glaubte Sophie erkannt zu haben, der einzige ihnen nahestehende Erwachsene war, der in ihren Augen im Lauf der Zeit nicht etwa älter oder vertrauter, sondern jünger, fremder und deshalb begehrenswerter geworden war. Wie sonst ließen sich das Gekichere und Erröten und die verschämten Blicke der Mädchen erklären, mit denen sie den ungehobelten Mann unweigerlich jedes Mal aus der Fassung brachten, wenn er sich ihnen näherte, um etwa im Esszimmer die verrußten Lampen zu putzen oder das Silber zu polieren, das Sophie zuvor mit Hirschhornpulver gereinigt hatte? Ohne besondere Anstrengungen war es ihm gelungen, in ihre Mädchenträume, über die sie mit niemandem, am allerwenigsten mit ihm selbst zu sprechen gewagt hätten, vorzudringen. Über Johann Hungers zwar alles andere als einnehmendes, dennoch anziehendes Aussehen bestand kein Zweifel, und auch Sophie musste sich eingestehen, dass sie, trotz seiner ruppigen Natur und schroffen Art, nach allem, was zwischen ihnen vorgefallen war, noch manchmal nach ihm hinsah. Dass er ihre Blicke nicht mehr erwiderte, kümmerte sie wenig. Kummer war sie gewohnt.
Nun nahm sie ihre Geldbörse von der Waschkommode, in der sich ihre gesamten Ersparnisse befanden (beinahe fünfhundert Mark), öffnete sie und legte die zusammengefaltete Beurteilung dazu, die Frau von Schmidthals ihr vor wenigen Tagen ausgestellt hatte und die sie inzwischen beinahe auswendig kannte: Sophie Kohler, geboren den 3. Mai 1883 zu Mülhausen, aufgewachsen in Ammerschweiher; Abgängerin der Hausmädchen-Schule in Kolmar, hat zu unserer Zufriedenheit zunächst als Stütze, später als Dienstmädchen insgesamt vier Jahre lang gute Arbeit geleistet. Sie ist zuverlässig, zupackend und freundlich, ein zurückhaltendes, stilles Wesen. Sie putzt vorzüglich Silber und Haushalt, ist eine flinke Näherin und hat auch kochen gelernt. Sie serviert sehr leise und mit Anstand. Spricht trefflich auch Französisch. Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft und sind überzeugt, dass künftige Herrschaften so zufrieden sein werden wie wir. Gertrud Freifrau v. Schmidthals.
Sie konnte die Tränen, die zu weinen es keinen Grund gab, nicht zurückhalten. »Wir hatten bisher keine, die stiller war als unsere Sophie, sie ist, was die Arbeit betrifft, ein wahres Juwel, ein gutes, anstelliges Wesen, unser freundlicher Maulwurf, eine Seele von einem Menschen …«, hatte sie Frau von Schmidthals eines Abends während eines kleinen Empfangs zu einer ihrer ehemaligen Schulfreundinnen sagen hören und war sich im selben Augenblick, in dem sie sich geschmeichelt fühlte, bewusst geworden, dass man sich mit solchen Referenzen nicht jene Position zurückeroberte, die man, wenn auch ohne eigenes Verschulden, verloren hatte. Hoffte sie etwa noch immer, dorthin zurückzukehren, wo niemand war und niemand wartete! Das Grab über ihrer verfluchten Mutter war mit Erde versiegelt und barg nichts als Gebeine! Sie streckte die tränenfeuchte Hand nach ihrem hellgrauen Reisekleid aus, das an einem Bügel über der offenen Schranktür hing, versuchte, dem Fluss ihrer Tränen Einhalt zu gebieten, und machte sich fertig, indem sie das leichte Kleid über den Unterrock streifte. Weiteren Geräuschen, die sie kaum wahrnahm, schenkte sie keine Beachtung. Ihre gesellschaftliche Herabsetzung war allem Anschein nach so perfekt gelungen, dass nicht einmal mehr Staubkörner ihres früheren Lebens an ihr hafteten. So durfte sie nunmehr – eine fragwürdige Verklärung – als das Idealbild eines weiblichen Dienstboten gelten, was durch den Umstand, dass sie ein Holzbein hatte, das sie in ihrer Arbeit nicht zu behindern, nein, eher zu beflügeln schien, noch unterstrichen wurde. Als sie das Kleid über die Hüften zog und auf den Oberschenkeln glatt strich, spürte sie die unempfindliche, harte Fläche der lackierten Pappelholzprothese, die das halbe rechte Bein ersetzte, welches ihr drei Jahre zuvor, am 10. August 1910, nach einem Unfall, bei dem sie ebenso gut hätte sterben können, hatte abgenommen werden müssen.
Der unaufmerksame, durch die hochsommerliche Hitze und einige erfrischende alkoholische Getränke in seinem Reaktionsvermögen offenbar stark beeinträchtigte Straßenbahnfahrer war losgefahren, als sich ihr rechter Fuß bereits auf dem Trittbrett, ihr linker jedoch noch auf dem Straßenpflaster befand. Zwar hatte sie versucht, die vordere Plattform, auf der sich niemand aufhielt, der ihr zu Hilfe hätte eilen können, auf Knien zu erklimmen, war dadurch aber in eine noch unglücklichere Lage geraten. Unaufhaltsam war sie unter die Bahn gerutscht. Der Fahrer hatte die entsetzten Schreie der Fahrgäste und Passanten, die das kurze Schauspiel von der Straße aus verfolgten, erst gehört, als Sophie das Gleichgewicht bereits verloren hatte. Als er – von einem jungen Mann an den Schultern gepackt – endlich die Bremse zog, hatte die Straßenbahn Sophie schon mitgerissen. Funkensprühend und kreischend war sie zögernd über sie hinweggeglitten. Als das vordere Rad auf ihrem Bein zum Stillstand kam, verlor sie das Bewusstsein.
Als sie kurz darauf aus ihrer Ohnmacht erwachte, ohne sich noch darüber im Klaren zu sein, dass das unbarmherzige Fahrzeug ihr Bein am Kniegelenk zertrümmert hatte – sie fühlte keinen Schmerz, spürte nur, dass warme Flüssigkeit aus ihrem Körper sprudelte –, standen etwa zwanzig Männer um den Wagen herum (was sie nicht sehen konnte, sie sah bloß Hände, die unter den Rahmen des Wagens griffen, und angewinkelte Beine, die sich dehnten) und versuchten, ihn mit vereinten Kräften und unter den Zurufen einer wachsenden Menge von Neugierigen hochzustemmen, die einen weit gezogenen Ring um die Stelle bildeten, an der sich der Unfall ereignet hatte. Ein Schutzmann und der Schaffner, die hinter sie getreten waren, versuchten nun, die Verletzte unter der sich hebenden und senkenden Straßenbahn hervorzuziehen, was ihnen endlich auch gelang. Sie trugen sie unter einen Baum. Der Kreis der Zuschauer verlagerte sich und setzte sich unter der schattigen Linde neu zusammen. Sophie erkannte den Fahrer, der benommen vor sich hinstarrte und unverständliche Laute von sich gab. Von ferne vernahm sie die Stimme einer Frau, die immer wieder »C’est ma fille!« rief und sich erfolglos einen Weg durch die Neugierigen zu bahnen versuchte. Sie rief nach ihr, Sophie, die ihr antworten wollte. »Das Blut! Sie stirbt! Ihr fließt alles Blut aus den Adern«, wurde geschrien, während die eine Stimme, die sie rief und nach der es sie so sehr verlangte, allmählich nach hinten abgedrängt wurde und dann verstummte. Sophie schlug um sich. Vergeblich hielt sie nach ihrer toten Mutter Ausschau, die durch ein Wunder als Stimme auferstanden war, und verlor von Neuem das Bewusstsein, um erst im Hospital in eine verdüsterte Wirklichkeit zurückzukehren, die vom Gestank nach Blut und (ihren eigenen) Exkrementen, nach Schweiß, Phenol und Äther erfüllt war.
Sie kannte keine der Personen, die um sie herumstanden und mit verschlossenen Mienen auf sie herniederblickten. Mit dem Erwachen hatte sich ein schwerfällig pulsierender Schmerz eingestellt, der sie durchflutete und ihr Innerstes und Empfindlichstes aus der dünnen Hülle, ihrer Haut, herauszupressen versuchte. Sie umklammerte die harte Unterlage, auf die man sie gelegt hatte, hielt sich mit beiden Händen daran fest, um nicht aus sich herausgeschleudert zu werden, und schrie immer wieder, immer lauter nach ihrer Mutter. Der Schmerz war so mächtig und nah, dass sie die Stelle, von der er ausging, nicht zu bestimmen vermochte. Sie erinnerte sich zunächst nicht an das, was geschehen war, und niemand versuchte, es ihr zu erklären. Die flachen Gesichter der Umstehenden wichen Schatten, die sich unfühlbar an ihr zu schaffen machten. Dann endlich gelang es ihr, sich hinter die dünnen Knochen zurückzuziehen, die jenes fest gefügte Korsett bildeten, das sie vor den Verlockungen des Todes bewahrte. Sie erhörte ihn nicht, so begehrlich er sie auch bedrängte. Man verabreichte ihr Morphium, und sie wurde selber zum Schatten.
Als Sophie wieder zu sich kam, stand eine der Clarissinnen neben ihrem Lager, das sich kalt wie Stein anfühlte, und hielt ihre Hand, während sich eine Krankenschwester in ziviler Tracht mit einem Schwamm und scharf riechenden Flüssigkeiten an einem ihrer Beine zu schaffen machte. Sie hatte die Ärmel ihrer blau-weiß gestreiften Bluse bis über die Ellbogen zurückgekrempelt. »Schauen Sie nicht hin, da ist nichts zu sehen«, sagte die Nonne und erbleichte, als ihr Blick an Sophies Körper entlang nach unten glitt.
Ein Arzt erschien und teilte ihr mit, dass man keine andere Wahl habe, als das beschädigte rechte Bein oberhalb des Kniegelenks abzulösen, wenn man Schlimmeres wie Wundbrand et cetera vermeiden wolle, der unweigerlich zum Tode führt. In das Gesicht der Nonne kehrte – vielleicht durch die Anstrengung, die Hand der unglückseligen Patientin zu drücken – allmählich etwas Farbe zurück, indes Sophie sich verzweifelt darum bemühte, zu verstehen, was man ihr sagte. »Was bedeutet ablösen?« – »Ablösen bedeutet amputieren.« Was das bedeute, wiederholte sie. Der Chirurg hatte sich inzwischen abgewandt und rief nach Instrumenten (die bald darauf auf einem emaillierten Wägelchen hereingerollt wurden). Das verstehe sie nicht. Was das bedeute. Sie verstehe es nicht! Mühsam bahnte sich ihre Stimme einen Weg durch die Schmerzen, bis der Arzt, offenbar ungerührt, die Worte aussprach, auf die sie bereits gewartet hatte: »Das Bein muss ab. Das begreifen Sie, nicht wahr? Es bleibt uns nichts anderes übrig. Sie wollen weiterleben? Wenn Sie weiterleben wollen, dann muss es ab.« Sie wollte nicht weiterleben, aber weder die Nonne noch die Krankenschwester noch der Arzt verstanden, was sie sagte. Und der Tod hatte sich enttäuscht zurückgezogen.
Als das Chloroform zu wirken begann, hörte sie auf zu schreien. Wenngleich sie keinen Schmerz mehr empfand, spürte sie doch die Eisenzähne der unerbittlichen Säge, die sich durch Haut, Sehnen, Blutgefäße und Muskeln ihres absterbenden Beins bis an die Knochen und durch diese hindurchfraßen. Deutlich war das gleichmäßige Geräusch des Geräts an ihr für jeden ungewohnten Laut besonders empfängliches Ohr gedrungen, ebenso das Keuchen des Arztes, der sich so schwer an ihr zu schaffen machte, dass ihm der Schweiß von der Stirn tropfte. Es fiel etwas zu Boden, wonach man sich bückte. Es wurde aufgehoben und weggetragen. Ein einziges Mal hatte sich Sophie am folgenden Tag nach dem Verbleib ihres Beins erkundigt und zur Antwort erhalten, das sei unwichtig. »Gott gebe dir die Kraft, diese leidvolle Prüfung zu bestehen«, sagte die Nonne. »Du bist stark. Bete also. Lass uns zusammen beten.«
Sie fuhr heftig herum und atmete sogleich erleichtert auf, als sie Johann Hunger hinter sich bemerkte. In offener Reisekleidung, mit gelösten Schnürsenkeln und ungekämmtem Haar unter dem Strohhut, lehnte er an einem der mit Mörtel beworfenen Kamine und betrachtete sie wortlos, mit offenem Mund, wie es seine Gewohnheit war (er zeigte seine gesunden Zähne). Er deutete auf ihr Gepäck und fragte, ob man das Ungetüm, in dem sie ihre Beute aufbewahre, endlich holen könne, es sei Zeit. Er zog die Uhr, die er von seinem Vater geerbt hatte, aus seiner Hosentasche und bemerkte, es sei schon elf, »die Züge warten auf niemanden, zumindest nicht auf uns«. Sie nickte und hob die Schultern.
Sophie war reisefertig. Deck- und Unterbetten, Bettzeug, Bettlaken und Bettdecken lagen ordentlich zusammengefaltet auf dem Bett, als Johann Hunger und sein Freund Plattler, der Kutscher aus dem Nachbarhaus, eine Viertelstunde später den Dachboden betraten, um den schweren Weidenkorb abzuholen, nachdem Hunger sein eigenes Gepäck bereits in der wartenden Kutsche verstaut hatte. Gemäß Sophies Erwartungen wurde das »Scheißding!« mit dem »Weiberkrempel!« von den beiden kräftigen Männern zunächst die schmalen Stufen vom Dachboden ins breite Treppenhaus und dann – aus Rücksicht auf die empfindsamen Hausbewohner unter Auslassung weiterer Kraftausdrücke – von der dritten Etage ins Erdgeschoss getragen. Sophie blieb stehen, zog die Dachbodentür hinter sich ins Schloss und ließ die beiden Männer vorangehen. Sich nach dem Ort umzudrehen, an dem sie vier Jahre lang ihre einsamen Nächte verbracht hatte, deren trostlose Leere nur selten, zu Zeiten, da sie noch zwei gesunde Beine hatte, durch Johann Hungers Gegenwart ein wenig aufgehellt worden waren, gab es keinen Grund; wenn er sie auch nicht geliebt, sich ihrer also lediglich in Ermangelung eines anderen so dicht benachbarten Objektes barmherzig angenommen hatte, so waren ihr seine gelegentlichen Überraschungsangriffe doch stets wie heimliche Siege über die drei sich nach ihm verzehrenden, ebenso dreisten wie ahnungslosen Schwestern erschienen, die unten in ihren ungleich weicheren, aber keineswegs wärmeren Betten lagen und sich nichts sehnlicher wünschten, als dort zu liegen, wo sie lag (was sie nicht wussten).
Nun, da sich die beiden um Lautlosigkeit bemühten Diener mit ihrer Last nach unten entfernt hatten, wo sich auch die von Schmidthalsens aufhielten, wurde es in den oberen Stockwerken des Hauses still. Hunger und Plattler stellten den Reisekorb in der Eingangshalle ab und begaben sich nach draußen, wo Pferd und Wagen warteten. Niemand war da, ihr irgendwelche Botengänge aufzutragen. Sie war nicht gehalten, mit vollen Serviertabletts treppauf, treppab zu eilen und Fenster zu schließen oder Läden zu öffnen. Heute, am Tag ihrer Abreise, während der letzten Stunden ihres Aufenthalts in Berlin, war alles anders. Zu keiner Tätigkeit verpflichtet, stand sie, die gestern noch bis spät in die Nacht das neue Mädchen Luise eingeführt hatte, auf dem Flur des ersten Obergeschosses, streckte die Hand aus, griff nach der Türklinke und drückte sie herunter. Nichts band sie mehr an ihre Herrschaft; was sie noch einmal sehen wollte, erblickte sie nunmehr aus freien Stücken, von jenen losgelöst, die es besaßen.
Sophie betrat den Salon in der unschuldigen Absicht, einige Augenblicke untätig in dem geräumigen Zimmer zu verweilen, in dem sie sich vor allem morgens so oft alleine aufgehalten hatte. Die vier Fenster, die sie, wenn die Temperatur es erlaubte, vor dem Saubermachen stets geöffnet hatte, damit der Straßenlärm ungehindert an ihre nach Geräuschen begierigen Ohren dringen konnte, waren jetzt geschlossen, die Fensterläden ebenfalls, sodass das geräumige Zimmer erfrischend kühl im Zwielicht lag. Um sich später einmal an die Farben der Vorhänge und des Stoffs zu erinnern, mit denen die sechs Sessel, das Sofa und die beiden zierlichen Stühle, die niemals von der Wand gerückt wurden, bezogen waren, bedurfte es gewiss keiner eingehenden Betrachtung mehr; sie hatten sich Sophies Gedächtnis eingebrannt, wenngleich sich ihre Beziehung zu diesen gebauschten goldgelben Faltenwürfen und ausgiebig mit kunstvollen Drechslerarbeiten verzierten Möbeln, die noch aus der Zeit der Eheschließung der von Schmidthalsens stammten, darin erschöpft hatte, sie regelmäßig abzustauben und zu bürsten. Vier Jahre lang war sie darum bemüht gewesen, den Hausrat in jenem Zustand zu erhalten, in dem sie ihn vorgefunden hatte (was nicht leicht war). Sie schloss die Augen, ging langsam auf das Sofa zu und setzte sich. Sie legte ihre rechte Hand auf das Prothesenscharnier und bog, bevor sie die Augen wieder aufschlug, den unteren Teil des Holzbeins so zurecht, dass er im rechten Winkel zum Oberschenkel stand. Sie trug den Ring und die Ohrringe ihrer Mutter, und an ihrem rechten Arm hing eine kleine Tasche, in der sich ihre Geldbörse, der erforderliche Reisepass (zum ersten Mal seit ihrer Kindheit verließ sie deutschen Boden) und die schriftliche Bestätigung ihrer neuen Anstellung befanden. Sie blickte auf. Aus Gründen, die ihr nicht bekannt waren, hatte man kürzlich eines der großen Ahnenbilder von der an mehreren Stellen zerschlissenen hellblauen Seidentapete genommen und Johann Hunger damit zum Einrahmer geschickt. Sophie fragte sich, wer es nun, da kein Diener mehr im Haus war (und, wie sie wusste, kein neuer beschäftigt werden sollte), dort abholen würde. Sie klappte das Scharnier ihrer Prothese wieder auseinander, stand auf und verließ den Salon.
Gewiss, es war das gute (und verbriefte) Recht jeder Hausfrau (und manche sah es sogar als erzieherische Notwendigkeit an), sich der Ehrbarkeit ihrer Angestellten durch Augenschein zu versichern; ihr blind zu vertrauen, war sie ja nicht verpflichtet. Dennoch versetzte es Sophie einen Stich, als sie sich über das Treppengeländer beugte und Frau von Schmidthals erblickte, die vor dem aufgeschlagenen Reisekorb kniete, der unbeaufsichtigt in der Eingangshalle stand. Wohl in der tiefen Überzeugung, möglichen Schaden nicht nur von sich, sondern auch von der Seele ihres Dienstmädchens abzuwenden, das bislang (wie Sophie glaubte) keinen Anlass zu Misstrauen gegeben hatte, durchsuchte sie mit beiden Händen den Korb nach etwaigen darin verborgenen gestohlenen Gegenständen. Zweifellos glaubte sich Frau von Schmidthals, der Sophie eine so niedrige Denkart nicht zugetraut hätte, allein und unbeobachtet; niemand war in der Nähe, die Eingangshalle leer, die Köchin beschäftigt, die Töchter, von denen sich Sophie bereits nach dem Frühstück verabschiedet hatte, noch nicht von der Kirche zurück, Herr von Schmidthals vermutlich im unteren Salon in seine Sonntagslektüre vertieft. Frau von Schmidthals dachte gewiss nicht im Entferntesten daran, dass jene, die sie völlig grundlos verdächtigte, in diesem Augenblick auf sie herunterblickte. Darum bemüht, keine verräterische Unordnung zu hinterlassen, griff sie immer tiefer unter Sophies Kleider, Wäsche und persönliche Sachen, unter denen sie offenbar Dinge vorzufinden hoffte oder fürchtete, die sie einst vermisst und womöglich wieder vergessen hatte und die gestohlen zu haben sie Sophie all die Jahre wohl verdächtigt haben musste, ohne es sie jemals spüren oder gar wissen zu lassen. Hielt sie es tatsächlich für möglich, dass ihr Juwel Sophie sie bestohlen hatte?
Auch ihr war nicht gestattet gewesen, den Reisekorb, den sie bei Antritt ihrer Stellung mitgebracht hatte und der damals kaum halb so voll gewesen war wie heute, außerhalb des Hauses aufzubewahren; eine vorsorgliche Maßnahme, von der die meisten Dienstboten betroffen waren und die verhindern sollte, dass hinter dem Rücken der Herrschaften Silber, Geld, Schmuck und andere kostbare Effekten beiseitegeschafft wurden.
Der Anblick der Knienden, dieses stillen menschlichen Argwohns, entsetzte Sophie und berührte sie zugleich peinlich. Vergeblich wünschte sie sich, es um einer freundlicheren Erinnerung willen nicht gesehen zu haben; doch nun war es zu spät; auch dieses letzte Bild würde sich – kaum nachhaltiger als alle anderen – in ihr Gedächtnis fügen. Es dauerte eine Weile, bis sie sich aus ihrer Erstarrung befreit und die zusammengekrampften Finger vom Handlauf des Treppengeländers gelöst hatte. Der Entschluss, zu schweigen, sich auch nichts anmerken zu lassen, war jedoch schnell gefasst. Jetzt, da sich ihre Zukunft nicht mehr entscheiden konnte, wo allenfalls der Blick auf die Vergangenheit ein wenig verdüstert wurde, war es ein leichtes, sich – nicht etwa großzügig, sondern einfach blind und taub für derlei Dinge – über das ebenso unverzeihliche wie lächerliche Benehmen dieser sonst um Haltung so sehr bemühten Frau hinwegzusetzen. Mochte Frau von Schmidthals ihren unausgesprochenen, haltlosen Unterstellungen nun freien Lauf lassen, Sophie blieb ihrer Empörung Herr. Lautlos zog sie sich rückwärts bis zur Salontür zurück und drückte die Klinke noch einmal herunter. Sie öffnete den rechten Flügel und warf ihn nunmehr geräuschvoll ins Schloss. Das Schlagen der Tür konnte Frau von Schmidthals keinesfalls überhören.
Als Sophie den Flur entlangging, war sie darauf bedacht, mit ihrem rechten Fuß so vernehmlich wie nur möglich aufzutreten. Während der Schritt ihres linken Fußes durch den Läufer gedämpft wurde, schlug ihr Holzbein umso lauter auf dem Parkett auf. Jedem Bewohner dieses Hauses war das unverwechselbare Geräusch ihrer Schritte vertraut; das gleichmäßige Pochen des Holzbeins kündigte unzweifelhaft Sophie an. Als sie auf dem Treppenabsatz stand und in die große Halle hinunterblickte, von deren Decke ein schwerer flämischer Bronzeleuchter hing, unter dem ein runder Tisch stand, der der Ablage von Hüten und Zeitungen diente, war Frau von Schmidthals natürlich verschwunden und der Deckel des Reisekorbs zugeklappt; nichts deutete auf die heimliche Durchsuchung ihres bescheidenen Eigentums hin.
Die beiden Flügel der Haustür waren nach außen geöffnet, und warme Luft schlug ihr entgegen, als sie darauf zutrat; der Wind trug den beißenden Geruch des Pferds in sich, das jenseits des Vorgartens vor den Wagen gespannt war, der sie und Johann Hunger zum Bahnhof befördern würde. Über die Szene, deren unfreiwillige Zeugin sie soeben geworden war, würde sie mit niemandem sprechen, auch mit Johann Hunger nicht. Nicht nur die Scham, die sie bei der Schilderung dieser unerfreulichen Begebenheit für eine andere empfunden hätte, auch das Wissen um den unschätzbaren Wert ihres kostbarsten Vermögens – ihrer Verschwiegenheit – hielt sie vom Reden ab. Unauffälliges Auftreten und uneingeschränkte Diskretion waren die einzigen Pfunde, mit denen sie wuchern konnte und die sie bereits erfolgreich über ihre Jugend hinweggerettet hatte; ein anderes zinstragendes Kapital besaß sie nicht und würde sie vermutlich nie besitzen. Nie war es ihr besonders schwergefallen, Stillschweigen über all das zu bewahren, was sie gesehen hatte und wovon sie wusste, dass es die Räume nicht verlassen durfte, in denen es geschehen, gesprochen oder mehr schlecht als recht unterdrückt worden war. Uneinnehmbar durch Angriffe auf ihre Integrität, galt sie als unbestechliche Hüterin familiärer Geheimnisse nicht allein bei den Hausangestellten, denen sie täglich auf dem Markt, auf der Straße oder beim Krämer begegnete, sondern auch bei den Stellenvermittlerinnen und deren vorwiegend weiblicher Kundschaft, die außer ihrem eigenen Wohlergehen kaum etwas höher schätzten als Takt und Feingefühl bei ihren Untergebenen. Sophie würde ihrem Grundsatz nicht untreu werden, was auch geschehen mochte. Ihr in langen Jahren erworbenes, durch Johann Hunger, ihren nicht weniger verschwiegenen Förderer, nun in die Welt hinausgetragenes Ansehen durch Geschwätzigkeit zu gefährden, mit der man sich kurzfristig Freundschaft erwarb, auf Dauer aber lediglich Undank erntete, wäre kein guter Dienst an ihrem Fortkommen gewesen. Mochten die, denen sie diente, begangene Sünden in ihrer Gegenwart beichten, sie würde ihre freiwillige Schweigepflicht niemals verletzen, auch nicht in einem Fall, der sie selbst betraf.
Kaum hatte sie die letzte Treppenstufe erreicht und ihren linken Fuß auf eine der schwarzen Steinfliesen gesetzt, als Frau von Schmidthals durch die angelehnte Tür aus dem Esszimmer trat, in dem der Mittagstisch bereits sonntäglich gedeckt war. Gegen alle Eventualitäten geschützt, trug die Hausherrin ihre Perlenkette noch enger als gewöhnlich, was ihre Untersuchungen gewiss erleichtert hatte. Als habe man sich zwecks einer besonders dramatischen Wirkung abgesprochen, kam fast zur selben Zeit ihr Gatte, ein unscheinbares Büchlein an die Brust gedrückt, aus der angrenzenden Bibliothek, und wenig später erschien auch die rot erhitzte Köchin in Begleitung des neuen, sehr schüchternen Mädchens in der Küchentür (offenbar um dem Abschied eine gewisse zeremonielle Form zu verleihen, hatten beide ihre Schürzen abgelegt). Ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprechend, verabschiedete sich zunächst das Ehepaar von Schmidthals, erst dann wurde auch den beiden Angestellten, die in gebührendem Abstand auf ihren Auftritt warteten, gestattet, Sophie eine angenehme Reise, eine glückliche Zukunft und alles Gute zu wünschen und sie – wie die weinende Köchin es tat – an ihr Herz zu drücken.
Während dieser kurzen Szene, in der ihr der von seiner eigenen Großzügigkeit sichtlich gerührte Hausherr mit einer irgendwie unvollständigen Bewegung einen kleinen Briefumschlag zugesteckt hatte, dessen Übergabe ernstlich niemandem entgehen konnte, hatten Hunger und Plattler das Haus betreten; sie bückten sich, packten den Weidenkorb an den Henkeln und trugen ihn hinaus, während Frau von Schmidthals den Schätzen, die sich unentdeckt darin verbergen mochten, beinahe sehnsüchtige Blicke hinterherschickte. Draußen lud man das unhandliche Gepäckstück auf den Wagen, und als ob die frische Luft sie unabhängig machte, begannen die beiden Männer wieder zu fluchen. Zur Köchin gewandt, versprach Sophie, aus der Schweiz zu schreiben, sobald sie sich dort eingerichtet habe. Dann verließ sie das Haus. Herr und Frau von Schmidthals, die Köchin und das Mädchen (das seinen Tränen nun ebenfalls freien Lauf ließ) standen noch unter der Tür und winkten, als Sophie sich längst nach vorne gewandt hatte und unbeteiligt an sich vorüberziehen ließ, was sie wohl nie mehr sehen würde – die abgewandte Seite der Stadt, die prunkvollen Vorderfronten der Häuser, die von geschwungenen Löwenpranken und geflügelten Frauenköpfen getragenen, sich türmenden Balkone, auf denen niemand zu sehen war, kein mutiges Kind, keine verhärmte Magd, kein Müßiggänger, nur ein paar bellende Hunde. Berlin versank in Sophie Kohlers Schlaf.
Pünktlich setzte sich der Zug, in dem Sophie und Hunger über Frankfurt und Basel nach Chur reisten, in Bewegung, und während Sophie auf ihren Begleiter blickte, der vor sich hindöste, versuchte sie noch einmal, wie schon so oft, sich jenen hoch in den Bergen gelegenen Ort vorzustellen, der ihr Ziel war. Doch auch diesmal erwies sich das Kunststück, sich ein Bild des völlig Unbekannten zu machen, das einer inneren Betrachtung standgehalten hätte, als schier unmöglich. Was sie zu sehen glaubte, schmolz in der Landschaft, die sie in Wirklichkeit durchquerten, schnell und unwiederbringlich dahin. Als sie ihren Blick vom Fenster wandte, hinter dem die Bäume wie Mäntel davonflogen und die Felder sich wie auf einer Scheibe drehten, schob sich der reizlose Anblick der anderen Reisenden ernüchternd vor ihr inneres Auge. Dicht gedrängt saßen sie da, starrten vor sich hin oder schliefen, nicht anders als sie und Johann, dem im Lauf der Bahnfahrt ein stoppeliger Bart wuchs.
Das wenige, was Johann Hunger, der sein Heimatdorf im Alter von sechzehn Jahren verlassen hatte, von Urmein, dem Domleschg, seinen Verwandten, dem Gebirge im allgemeinen und dem Kloster im Besonderen, erzählt hatte, genügte nicht, um sich eine genaue Vorstellung von den Verhältnissen dort oben zu machen. Zwar hatte das, was er über tückische Gletscher, ewigen Schnee und donnernde Lawinen erzählte, ihre Einbildungskraft insofern zu beflügeln vermocht, als sie, die am Fuß der Vogesen aufgewachsen war, die schneebedeckten Berge als eine majestätisch schroffe Vergrößerung derselben vor sich zu sehen meinte, doch war ihre Fantasie nicht bereit, ihr auch nur die geringste Ansicht des Dorfs oder des Klosters zu gönnen, in dem mindestens zwei Jahre zu dienen sie sich schriftlich verpflichtet hatte.
Was sie erwartete, war, außer einer gänzlich fremden Umgebung, eine Menge Arbeit und mehr Verantwortung, als sie je zuvor getragen hatte. Roth, Hungers Onkel, durch dessen Vermittlung es zu diesen einschneidenden Veränderungen in ihrem und Johanns Leben gekommen war, hatte die beiden in zwei (von fremder Hand redigierten) Briefen nicht darüber im Zweifel gelassen, dass das außergewöhnlich hohe Gehalt, das ihnen in Aussicht gestellt wurde, auch hervorragende Arbeit von ihnen verlangte. Roth ließ, wie er mitteilte, seine guten Beziehungen zu dem neuen Besitzer des Schlosses spielen, als er sich bei seinem Neffen, dem Sohn seiner ältesten Schwester, schriftlich danach erkundigte, ob er nicht Interesse daran habe, seine in der fremden Großstadt erworbenen »servilen Fähigkeiten« (genau diese Worte hatte er in seinem Deutschen Wörterbuch gefunden) nunmehr zu Hause anzuwenden; eine seltene Gelegenheit, die sich mit Sicherheit so schnell nicht wieder bieten werde. Des Weiteren hatte er sich im Namen seines Auftraggebers, des italienischen Grafen Emilio Guido Galli, der das Kloster mit unvorstellbarem Aufwand renovieren lasse, bei Johann nach weiterem verlässlichen Hauspersonal erkundigt, das bereit wäre, sich »in die raue Wirklichkeit von Rätien zurückzuziehen«, ohne all der guten Manieren zu ermangeln, die man von den Land- und Bergbewohnern kaum erwarten könne, weshalb man unbedingt auf Personal zurückgreifen wolle, das in der Stadt geschult worden sei. Sophie, die Erste, der Johann im Namen seines Onkels, der nach eigenen Worten im Auftrag des Grafen handelte, ein förmliches Angebot gemacht hatte, war am Ende auch die Einzige gewesen, die sich nach einiger Bedenkzeit dazu entschließen konnte, ihm in die Berge und damit ins Ungewisse zu folgen. Es ihr nicht gleichgetan zu haben, sollten bei Kriegsausbruch vor allem jene Männer bereuen, die Hungers Ansinnen leichtfertig als schlechten Scherz zurückgewiesen hatten und eingezogen wurden. – Magdeburg lag hinter ihnen, als auch Sophie die Augen schloss.
III
O