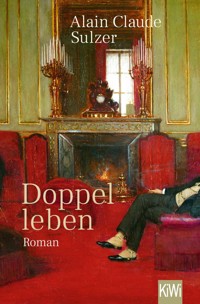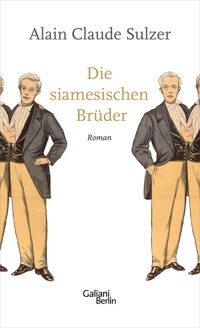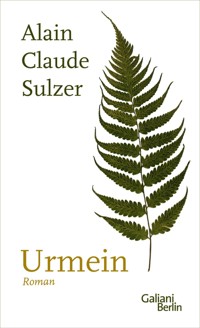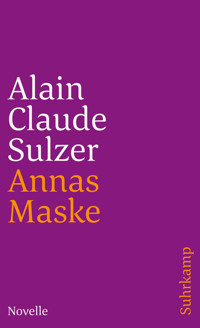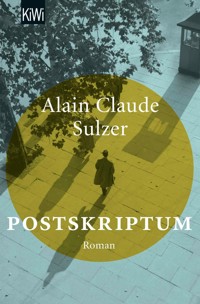9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unhaltbare Zustände - Ein eindringliches Porträt eines Mannes, der sich gegen den Wandel der Zeit auflehnt Schaufensterdekorateur Stettler lebt für die Momente, wenn seine kunstvoll arrangierten Waren im alteingesessenen Kaufhaus Quatre Saisons in neuem Glanz erstrahlen. Doch als ihm überraschend ein jüngerer Kollege zur Seite gestellt wird, beginnt Stettlers Welt zu bröckeln. Es ist das Jahr 1968 und überall weht der Wind der Veränderung - die Jugend trägt Bluejeans, am Münsterturm hängt eine Vietcong-Fahne. Stettler fühlt sich zunehmend bedroht und sinnt auf Rache gegen den vermeintlichen Rivalen. In Unhaltbare Zustände zeichnet Alain Claude Sulzer einfühlsam das Porträt eines Mannes, der sich mit aller Kraft gegen den Lauf der Zeit stemmt. Ein zähes Ringen mit dem Alter, bei dem Stettler nur verlieren kann. Einzig der Briefwechsel mit der von ihm bewunderten Radiopianistin Lotte Zerbst gibt ihm Halt in einer Welt, die ihm immer fremder wird. Eine bewegende Geschichte über das Festhalten an Vergangenem und die Sehnsucht nach menschlicher Verbindung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alain Claude Sulzer
Unhaltbare Zustände
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alain Claude Sulzer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alain Claude Sulzer
Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, darunter die Bestseller Zur falschen Zeit und Aus den Fugen sowie die Romane Postskriptum und Die Jugend ist ein fremdes Land. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Prix Médicis étranger, den Hermann-Hesse-Preis und den Kulturpreis der Stadt Basel.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zwei Tage sind sie hinter Papier versteckt, dann werden die sieben großen Schaufenster feierlich enthüllt – und lassen die Waren des alteingesessenen Quatre Saisons in neuem Glanz erstrahlen. Für diese Momente lebt und arbeitet Schaufensterdekorateur Stettler, und das schon mehrere Jahrzehnte. Nun, mit knapp sechzig, wird ihm überraschend ein jüngerer Kollege zur Seite gestellt – ein Rivale, ein avisierter Nachfolger, ein Feind! Stettlers Welt beginnt zu bröckeln. Es ist das Jahr 1968, und es bröckelt auch sonst alles, die jungen Leute tragen Bluejeans und wissen nicht mehr, was sich gehört. Am Münsterturm hängt auf einmal eine Vietcong-Fahne. Stettler ist entsetzt. Immer mehr fühlt er sich bedroht, spioniert dem Rivalen sogar nach, sinnt auf Rache. Allein mit einer von ihm bewunderten Radiopianistin, Lotte Zerbst, wechselt er Briefe und fühlt sich nicht so verloren. Er hofft sogar auf eine Begegnung …
»Alain Claude Sulzer ist ein kluger, feinfühliger und bisweilen schalkhafter Roman gelungen, der sichtbar macht, was der Wandel für den Einzelnen bedeuten kann – damals wie heute.« SRF
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2019, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © Piotr Marcinski / Getty Images (Mann) sowie © Dan Thornberg / Getty Images (Schaufensterpuppen)
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-32028-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
1 Winter
2 Herbst
3 Sommer
4 Sommer
5 Frühling
6 Herbst
7 Frühling
8 Sommer
9 Herbst
10 Winter
11 Winter
12 Winter
13 Frühling
14 Sommer
Coda
Epilog
Danksagung
Niemals waren ihm früher derlei Überlegungen bekannt gewesen! Jetzt flogen sie ihm zu wie eine Schar Vögel, nisteten sich in seinem Gehirn ein und flatterten unruhig darin herum.
Joseph Roth, Radetzkymarsch
Prolog
Im Sommer 1969 war ich sechzehn Jahre alt und mit Dingen beschäftigt, für die Sechzehnjährige heute vermutlich bloß noch ein müdes Lächeln übrighaben.
Ich war ein fauler, aber unauffälliger Schüler, was mir vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern zugutekam; man nahm mich auf den hinteren Rängen nicht zur Kenntnis und rief mich nicht auf, Fragen zu beantworten, von denen man wusste, dass ich sie nicht beantworten konnte. Als ich dem Unterricht schließlich ganz fernblieb, vermisste mich niemand und niemand suchte nach mir. Meine Interessen beschränkten sich auf klassische Musik und Literatur, zwei Disziplinen, denen schon damals etwas Anachronistisches anhaftete. Außer meinem Schulfreund Joachim, der später Pianist wurde, hörte niemand Mozart oder Beethoven und schon gar keine Opern, auch Joachim nicht, ich wurde das Gefühl nicht los, dieses Genre sei auch in seinen Augen eine minderwertige Gattung, etwas, was seriösen Musikern peinlich war. Während meine Mitschüler entweder die Beatles oder die Stones hörten – und ihre Songs auswendig kannten –, hörte ich französische Chansons und klassische Musik. In gewisser Weise setzte ich einfach fort, was bereits meine Eltern interessiert hatte, mit denen ich sonst so wenig wie möglich gemein haben wollte.
Ich war in allen Schulfächern – selbst in Deutsch – von geradezu spektakulärer Mittelmäßigkeit. Es war, als müsste ich der ganzen Welt beweisen, dass man es auch mit nichts zu etwas bringen kann, denn trotz meiner Bequemlichkeit war das mein Ziel. Ich hatte eine ausgeprägte Vorstellung davon, wie es sein würde, eines Tages Schriftsteller zu sein. Was um mich herum geschah, interessierte mich allerdings wenig. Mit einer einzigen Ausnahme habe ich damals über Dinge geschrieben, die ich mir ausdachte, nicht über die Wirklichkeit. Sie war nicht Gegenstand meiner ersten Schreibversuche, an die ich mich heute nur noch sehr undeutlich erinnere.
Das, worüber ich in einer der ersten Schulstunden nach den Sommerferien schrieb, hatte sich Ende Juli 1969 in einem Warenhaus zugetragen, das heute nicht mehr existiert, auch wenn ältere Leute noch immer vom Quatre Saisons sprechen, wenn sie das Gebäude meinen, in dem sich heute Büros und – immer weniger – Wohnungen befinden. Das Warenhaus stand nicht dort, wo ich aufwuchs, sondern in einer Stadt, in der ich seit Jahren meinen Sommerurlaub verbrachte. Dann wohnte ich bei Ida, einer Cousine meiner Mutter, und Onkel Walter, ihrem Ehemann. Die beiden waren – gewiss nicht freiwillig – kinderlos geblieben. Das Bedauern darüber trugen sie wie ein unsichtbares kleines Bündel mit sich herum. Einige Tage lang nahm ich jeden Sommer die Stelle eines Ersatzsohnes ein und wurde verwöhnt, aber auch nach Walters Prinzipien erzogen, die nicht die Prinzipien meiner Eltern waren. Ich ließ es klaglos über mich ergehen, weil ich wusste, dass es mir nicht schadete, und weil ich die alten Leute mochte.
Als ich eine Geschichte aufschrieb, die sich dort zugetragen hatte, konnte ich nicht wissen, dass es der letzte Sommer gewesen war, den ich dort verbracht hatte. Dass es so sein würde, wurde mir erst klar, als Ida wenige Monate später an einer Lungenentzündung starb und Walter kurz nach der Beerdigung in ein Altersheim zog. Er konnte weder kochen noch waschen. Er hatte nie eine Waschmaschine oder einen Herd bedient. Allein zu Hause wäre er verhungert, hieß es, und er wiederholte es selbst. Hin und wieder schrieb er mir in seiner unleserlichen Schrift kolorierte Ansichtskarten.
Wie jedes Jahr hatte uns der Deutschlehrer auch im August 1969 die Aufgabe gestellt, ein bemerkenswertes, erinnerungswürdiges Ereignis zu beschreiben, das sich in den sechs Ferienwochen, die hinter uns lagen, zugetragen hatte. Es konnte sich dabei um eine besondere Begegnung oder um eine Geschichte handeln.
Die meisten verfassten nun ziemlich lustlos jene immer gleichen Ferienbeschreibungen – Ausflüge an den Strand, Grillen im Freien, Schwimmen im Meer, Essen im Hotel –, mit denen ich nicht dienen konnte, weil wir mit unseren Eltern nie in den Urlaub fuhren. Über den Besuch des Tierparks, das Füttern der Bären im Bärengraben oder die Versuche meines Onkels, mir im Rosengarten Schachspielen beizubringen, hatte ich bereits in früheren Jahren geschrieben, dieses Mal aber hatte ich etwas zu erzählen, was die Erzählungen der anderen Schüler in den Schatten stellen würde.
Denn ich hatte etwas erlebt, was während ein paar Tagen über die Stadtgrenzen hinaus für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Es war eine merkwürdige Sache.
1Winter
Zu keiner Jahreszeit war Stettlers untrüglicher Sinn für Schönheit so gefragt wie in den Wochen vor Weihnachten. Sein Wissen über unterschiedliche Farben, Formen und Materialien, sein Sinn für Raum und Symmetrie, für Hell und Dunkel, Licht und Schatten, kurzum die Summe all seiner Fähigkeiten war unverzichtbar. Die Vorweihnachtszeit war seine beste Jahreszeit, nie war das Interesse der Kollegen an seiner Arbeit größer als Anfang Dezember, am ersten Donnerstag des Monats, wenn das Zeitungspapier vorsichtig von den Schaufenstern entfernt und die Kunstwerke, die er erschaffen hatte, endlich enthüllt wurden und man die Passanten dabei beobachten konnte, wie sie ehrfürchtig vor dem Resultat seiner Bemühungen stehen blieben, wenn also die Zeit für die Bewunderung gekommen war. Weder Fremde noch Angestellte wollten sich das entgehen lassen und konnten sich von dem, was sich ihren Blicken nun bot, nicht losreißen. Mit offenen Mündern standen sie da, hingerissen, fassungslos wie Kinder vor dem Weihnachtsbaum, und es dauerte meist ein paar Augenblicke, bis sie die Sprache wiederfanden und andere Neugierige – meist Menschen, die ihnen völlig fremd waren – mit Fingern auf dieses oder jenes Detail aufmerksam machen konnten, sofern sie sich nicht damit begnügten, das Ganze schweigend zu bestaunen. Man schmolz zu einer frohen Gruppe zusammen, warm und zufrieden, man fror nicht mehr, da die Vitrinen vor Verheißung glühten, und auch die Herzen der Anwesenden hatten Feuer gefangen, egal, ob sie dünne Mäntelchen trugen oder in Nerz gehüllt waren. Sein Werk war vollendet, von seinem zuverlässigen Gespür für das Schöne wie aus dem Nichts erschaffen, tatsächlich aber Ergebnis jahrzehntelanger Übung und Vervollkommnung, Folge wochenlangen Überlegens und Nachdenkens, wie das Geschmackvolle am wirkungsvollsten in Szene zu setzen sei, aber auch – was niemand sehen sollte und niemand sehen konnte – eine Folge schlafloser Nächte, in denen er so lange über halbfertigen Ideen und unverhofften Geistesblitzen gebrütet hatte, bis sie allmählich Gestalt annahmen und sich zuletzt immer klarer vor seinem inneren Auge abzeichnete, was er mit sicherer Hand umsetzen würde. Dann begann er zu planen und zu kalkulieren. Auf großen, rechteckigen Zeichenblöcken, die er stets horizontal in der Form des Schaufensters beschrieb, kam eines zum anderen, meist von links nach rechts, weil er sich dem Schaufenster stets von links näherte, wenn er sich vorstellte, ein ahnungsloser Passant zu sein. Der Aufbau begann in der linken Ecke, hier nahm – was niemand sehen konnte – die Realisation stets ihren Anfang. Das karierte Papier wurde zur Auslage, vor der ein einsamer Betrachter stand: Das weiße Blatt war eine leere Bühne, die sich allmählich mit Gegenständen füllte.
Entscheidender als die höchst ehrenwerte Zustimmung seiner Kollegen war der Beifall der Kunden. Noch wichtiger als die Meinung der Stammkunden – die wussten, was sie erwarten durften, weil sie das Warenhaus schon lange kannten – war die Meinung der unvorbereiteten Laufkundschaft, welche zum Innehalten verführt wurde. Mehr als um alle anderen ging es um sie, um Menschen, die zufällig vorbeikamen, mit nichts gerechnet hatten und nun vor den erleuchteten Schaufenstern standen und staunten.
Unbekannte anzulocken, die das Quatre Saisons nie zuvor betreten hatten, war unbestreitbar die wichtigste Aufgabe eines Schaufensterdekorateurs. Das war das oberste Ziel, the top goal, wie man in England sagte, das sich Stettler immer steckte, nicht nur im Dezember, sondern alle zwei Monate des Jahres, wenn die Schaufensterdekorationen wechselten. »Vorsätzliche Verführung.« Bereits sein Lehrmeister, der alte Bickel, hatte es nicht oft genug wiederholen können: »Verführ sie und du hast sie in der Tasche. Und hast du sie dort, kommen sie auch in den Laden, schauen sich um und prüfen heimlich ihre Geldbeutel. Das Schaufenster ist der Türöffner zum Tempel. Wenn sie einmal drin sind, gehen sie so schnell nicht mehr weg. Sie müssen sich verlieben. Das ist der Beginn einer lebenslänglichen Verbindung – wie die Ehe!« So ähnlich vermittelte auch Stettler es seit Jahren seinen Mitarbeitern, vor allem den jungen Kollegen und Lehrlingen, sechzehn-, siebzehnjährigen Knaben, halbe Kinder noch, die nichts vom Leben und schon gar nichts von der Kunst des Verkaufs und der Verführung verstanden, ja selten wussten, warum sie ausgerechnet diesen Beruf ergriffen hatten, einen Beruf, der sich dem Abenteuer nicht in der Ferne, sondern innerhalb der engen Grenzen eines vorgegebenen Rahmens aussetzte.
»Verführung ist eine Kunst, die einem nicht in die Wiege gelegt wird, geht das in eure Spatzenhirne, also müsst ihr sie lernen, dazu seid ihr da, von morgens bis abends, und es gibt nur einen, der sie euch beibringen kann, und das bin ich«, pflegte er ihnen immer wieder einzuhämmern, wobei er es manchmal nicht unterlassen konnte, einem der pickeligen Jünglinge mit der flachen Hand auf die Stirn zu schlagen, wenn er merkte, dass er unaufmerksam war.
»Ich meine euch alle«, sagte er dann, und augenblicklich war es mucksmäuschenstill, während der Lehrling, den er berührt hatte, mit den Tränen kämpfte. »Damit du es dir merkst. Kapiert? Damit es sich in deiner Hirnmasse verflüssigt und in dein Knochenmark rieselt. Und auch in eures!« Eifriges Nicken. Rote Köpfe. Betretenes Schweigen. Man wagte in seiner Gegenwart kaum zu atmen.
Die Lehrlinge fürchteten ihren Lehrmeister so wie Stettler seinen Lehrmeister Bickel gefürchtet hatte, der selbst nur einen fürchtete, den alten Schuster nämlich, wenn er, die Linke auf dem Rücken, sein Reich durchmaß. Dass Schusters Söhne es eines Tages übernehmen würden, lag auf der Hand. Sie hatten keine andere Wahl und würden es nicht bereuen. »Und Waschen hat auch noch keinem geschadet«, fügte Stettler hinzu, wenn der Schweißgeruch im engen Lehrlingszimmer überhandnahm. Auch diese Ermahnung hatte er von Bickel übernommen: Er duldete keine üblen Gerüche, schon gar nicht, wenn man in Strümpfen auf allen vieren in den Schaufenstern herumkroch.
Insbesondere zur Vorweihnachtszeit ging es darum, den Umsatz des Vorjahres zu toppen, wie man jetzt neumodisch sagte – Stettler war achtundfünfzig und spürte das nicht nur beim Bücken und Knien, sondern daran, dass sich um ihn alles zu verändern begann. Während die Bademode im Sommer immer gewagtere Einblicke auf den weiblichen Körper gewährte, der im Fall der Schaufensterpuppen inzwischen weder aus Gips noch Pappmaché, sondern aus einem Kunststoff war, der die Haut täuschend imitierte (früher hatten die Mannequins nicht einmal Köpfe gehabt), hatte es der Jahr für Jahr höher und höher werdende Weihnachtsbaum auf dem nahe gelegenen Rathausplatz mit den größer und größer werdenden Kugeln auf geradezu beängstigende Weise übernommen, die modernen Exzesse zu versinnbildlichen, die man mit der Ausdehnung von allem, nicht nur von nackter Haut und übertriebener Weihnachtsfeierlichkeit, trieb.
Stettler konnte von Glück sagen, dass sich zumindest die Ausmaße seiner Schaufenster nicht verändert hatten und in absehbarer Zeit auch nicht verändern würden. Die Maße der sieben Schaufenster, die sich innerhalb eines zweihundertjährigen Laubengangs befanden, hatte er genau im Kopf: drei Meter achtzig breit, zwei Meter zehn tief, zwei Meter siebzig hoch.
Über Stettlers Anteil am Jahresumsatz im Allgemeinen und am gesteigerten Weihnachtsumsatz im Besonderen war sich vom Laufburschen bis zu den Direktoren jeder im Klaren. Obwohl sein Beitrag in Zahlen nicht zu schätzen war, galt dieser Anteil als feste Größe, man konnte sich darauf verlassen.
Jeder Mitarbeiter des Quatre Saisons wusste um Stettlers Bedeutung für das Warenhaus, das vor rund fünfundfünfzig Jahren – wenige Jahre nach der Jahrhundertwende – von Johann Schuster sen. eröffnet worden war, sechs Jahre, nachdem man mit den Bauarbeiten begonnen hatte; ein Haus mitten in der Stadt, schwindelerregend hoch, wie manche fanden, ein Haus mit Karyatiden, ausladendem Stuck und emaillierten Mosaiken, blinden Fenstern, hinter denen sich die Verkaufsräume verbargen, und einem Haupteingang, der dem des städtischen Opernhauses in nichts nachstand. Eine Glaskuppel, die von weitem zu sehen war. Der vierfarbige Schriftzug Les Quatre Saisons. Die vierfarbigen Fahnen, die bei besonderen Anlässen im Wind wehten. All das erhob sich mächtig über den mittelalterlichen Lauben, die erhalten geblieben waren, weil die Behörden deren Abriss nicht gestattet hatten.
Nie hatte der alte Schuster einen Hehl daraus gemacht, dass sein Vorbild das Kaufhaus La Samaritaine war, so wie sich diese vordem Le bon marché zum Vorbild genommen hatte, wo Schuster drei Jahre lang sein Handwerk unter den Augen von Monsieur et Madame Cognaq, den Gründern und Besitzern des Hauses, als Chef de Rayon in der Abteilung Vêtements pour hommes verfeinert und geschliffen hatte, nachdem er zuvor je ein halbes Jahr in Köln und London tätig gewesen war, zunächst unschlüssig, ob er nach dieser Zeit nach New York wechseln sollte. Doch er war froh gewesen, sich für Paris entschieden zu haben.
Welche Vorstellungen er von seiner Zukunft gehabt hatte, als er die Stelle am rechten Seineufer antrat, wusste niemand außer seiner Frau. Als er den Heimweg in die Schweiz antrat, war er jedenfalls längst entschlossen, dort gemeinsam mit Christine, einer waschechten Pariserin, ein ähnliches Warenhaus wie die Samaritaine zu eröffnen. Sie wagten das Abenteuer, ein eigenes Geschäft zu gründen. Die Kantonalbank war ihnen behilflich.
Auch wenn der Einfluss der Samaritaine auf das Quatre Saisons nicht zu übersehen war, passte sich die bescheidenere Version doch sehr geschickt der Provinzstadt an, für die es gebaut worden war. Dennoch war das hochmoderne Warenhaus größer und repräsentativer als alles, was man dort kannte. Hatte man sich hier bislang mit spezialisierten Geschäften, Werkstätten oder Ateliers für Damen- und Herrenbekleidung, für Hüte, Schirme, Schuhe, Taschen, Mercerie- und Bonneteriewaren et cetera begnügt, bot Schuster sen. diese Artikel nun unter einem Dach an. Teile der mittelalterlichen Stadt – heruntergekommene, teils ruinöse, brandgefährdete und brandgefährliche Häuser ohne Wasser, Gas oder Elektrizität, ohne sanitäre Einrichtungen und teilweise ohne Fensterscheiben – wurden abgerissen, um dem neuen Haus Platz zu machen. Schuster, der das Areal, in dem sein Kaufhaus errichtet wurde, mit Hilfe der Bank nach und nach aufgekauft hatte, war täglich zur Stelle, um die Bauarbeiten zu überwachen. Man begegnete ihm hier öfter als dem Architekten, und oft begleitete ihn seine elegante Frau, die man nur »die Pariserin« nannte.
Es ging darum, die Kundinnen zu überzeugen. Das ließ sich zum einen durch die einzigartige Fülle des Angebots bei gleicher oder sogar noch besserer Qualität der Ware erreichen, zum anderen aufgrund von Preisen, bei denen die kleinen Ladenbesitzer, die seit jeher an einen beschränkten Absatz gewöhnt waren, nicht mithalten konnten. Die Waren mussten verlockend und erschwinglich und in beeindruckendem Übermaß verfügbar sein – und zwar jederzeit und stets auf dem neuesten modischen Stand. Der Satz »Das führen wir nicht« durfte niemals über die Lippen eines Verkäufers oder einer Verkäuferin kommen, er durfte nicht einmal gedacht werden. Auf längere Sicht sollte die Kundschaft keine Wahl – wenngleich weiterhin andere Möglichkeiten – haben, als im Quatre Saisons einzukaufen. Das würde nicht von einem Tag auf den anderen geschehen, aber es würde geschehen, über kurz oder lang, und es geschah.
Die Kraft der Überzeugung war stärker als die zahnlos gewordene Macht der Gewohnheit. Letztere, die in Lumpen ging, konnte ausgeschaltet werden, wenn man erstere nur prächtig genug präsentierte und sie in Samt und Seide hüllte. Auf die wenigen Hochnäsigen, die das Quatre Saisons mieden, weil sie sich der besseren Gesellschaft zugehörig fühlten und sich nicht zum Pöbel herablassen wollten, konnte man gut und gerne verzichten. Da Johann Schuster nicht aus ihren Kreisen stammte, kümmerte ihn ihre Arroganz wenig.
Schuster sen. hatte ein Händchen für die Verdrängung unliebsamer Konkurrenten, deren Todfeind er innerhalb kürzester Zeit geworden war, nicht anders als Aristide Boucicaut, der Gründer von Le bon marché im vergangenen Jahrhundert in Paris. Zu Beginn hatte Schuster sen., der sich für einen Visionär hielt, viel zu verlieren, am Ende aber war er der große Gewinner. Nichts anderes hatte er erwartet.
Die Zeit war günstig gewesen, die moderne Kundin, die es sich nicht leisten konnte, Kleingewerbetreibende nach Hause kommen zu lassen, war es leid, von der Näherin zur Putzmacherin, vom Täschner zum Schuhmacher zu laufen und missgelaunt und müde darauf zu warten, dass die Aufträge – oft erst nach wiederholter Reklamation – ausgeführt wurden und die Bestellungen, selten genug zum verabredeten Termin, eintrafen. Um wie vieles angenehmer war es, alles, was man suchte, was man brauchte, was man sich wünschte, was man kannte oder wovon man nur gerüchteweise gehört hatte, unter einem einzigen Dach im Quatre Saisons zu finden, also stets Zugriff auf ein atemberaubend vielfältiges Sortiment zu haben, das sich auf sage und schreibe sechs Stockwerke verteilte, die man über das dank der Glaskuppel und beeindruckender Lüster hell erleuchtete Treppenhaus erreichte, in deren oberstem einen das mit Porzellan ausgekleidete chinesische Teehaus erwartete, in dem nebst Gebäck und Kuchen natürlich auch Kaffee serviert wurde.
In Schusters Warenhaus, das nun seit einem halben Jahrhundert existierte, wurde so gut wie alles feilgeboten, was das Herz begehrte, nicht zuletzt auch Güter, von denen die begehrliche, möglichst generöse Kundin noch nicht einmal wusste, dass sie existierten. Zu ahnen, dass sie sie hier entdecken würde, war umso verführerischer, es lockte sie aus ihrem Haus, ihrer Wohnung, aus ihrem Dorf, aus der Nachbarstadt, fort von ihren Gewohnheiten. Von allem und für alle etwas: Beständiges und Luxuriöses, Teures und Günstiges, Raffiniertes und Schlichtes, Praktisches und Überflüssiges, Bekanntes und Unbekanntes, ein Paradies für Käuferinnen, das zu Weihnachten für Kinder zum Himmel auf Erden wurde, weil dann ein Teil der Herrenabteilung in ein Weihnachtsgeschenkeparadies verwandelt wurde.
Der alte Schuster war kurz nach Kriegsende im Juli 1945 in seinem Bett gestorben. Lieber wäre es ihm sicher gewesen, das Zeitliche in seinem kleinen, unscheinbaren Direktionsbüro zu segnen, das sich im ersten Stock hinter einer schmucklosen Tür befand, die sich hinter einem gefütterten Seidenparavant verschanzte, den Schuster als junger Mann aus Paris mitgebracht hatte. Er war mit rosa- und hellblauen Phantasiepfauen bedruckt. Schuster hatte stets behauptet, er stamme aus China, was aber nicht stimmte, er war in Lyon gefertigt worden.
Die gesamte Belegschaft hatte sich bei seiner Beerdigung auf dem Friedhof eingefunden, um gemeinsam mit seinen beiden Söhnen von ihm Abschied zu nehmen. Das Quatre Saisons war einen Tag lang geschlossen gewesen. Die ganze Stadt wusste, dass Schuster tot war.
Wie alle Dekorateure stand Stettler im Schatten seiner Kunst. Niemand außer den Angestellten und ein paar Eingeweihten kannte seinen Namen, kaum jemand wusste, wie er aussah, dass ausgerechnet er, dieser schlaksig wirkende ältere, unscheinbare Herr mit der Hornbrille und dem schütteren Haar, für die Schaufenster verantwortlich zeichnete, mit denen er – darüber herrschte Einigkeit – stets den Nerv der Kundinnen traf. Im Gegensatz zu den Verkäuferinnen und Verkäufern, deren Namenszüge auf blau geränderten Schildern auf den Revers ihrer weißen Uniformen prangten, blieb er meist unsichtbar; ein solches Schild besaß und wünschte er sich übrigens nicht, das verbot ihm der Stolz.
Wenn umdekoriert wurde – was zwei intensive Arbeitstage in Anspruch nahm, die oft bis in die Nacht dauerten –, verhüllte man die Schaufenster, damit sie vor den Blicken neugieriger Passanten geschützt blieben. Die übrige Zeit verbrachte Stettler mit seinen Mitarbeitern in der weiträumigen Werkstatt im Souterrain, wo wochenlang intensiv an den Einzelteilen gearbeitet und an Details gefeilt wurde. In Modellschaufenstern, die den Ausmaßen der Originale entsprachen, wurden alle möglichen Variationen durchgespielt (das große Magazin mit den bereits verwendeten, stets griffbereiten Requisiten und Hilfsmitteln befand sich außer Haus nur ein paar Straßen entfernt; oft pendelte Stettler mehrmals am Tag hin und her).
Um Qualität zu erkennen, war es nicht nötig, zu wissen, wie er hieß, so wie es nicht nötig war, den Namen eines Musikers zu kennen, um sich von seiner Kunst überzeugen zu können. Weder das Äußere der Person noch der Name, den man ihr bei ihrer Geburt gegeben hatte, spielten eine Rolle. Im einen Fall genügten aufmerksame Ohren, im anderen gute Augen, die für das Schöne empfänglich waren. Stettler wiederum genügte es, das Leuchten in diesen Augen zu sehen, um mit sich und der Welt zufrieden zu sein. Und glücklich darüber, diesen und keinen anderen Beruf gewählt zu haben. Er übte ihn nun schon so lange aus, dass er sich kaum entsinnen konnte, je etwas anderes in Erwägung gezogen zu haben. So jedenfalls hätte er es formuliert, wenn ihn jemand danach gefragt hätte.
Als am ersten Mittwoch im Dezember die neuen Dekorationen enthüllt wurden und er sich unter die Schaulustigen draußen gesellte, breitete sich in seinem Inneren Genugtuung aus, die so süß und heilsam war wie warme Honigmilch. Er bedauerte, dass seine Mutter es nicht mehr erleben durfte. Niemand hatte seine Arbeit mehr zu schätzen gewusst und so uneingeschränk bewundert als sie. Abgesehen von ihrem letzten Lebensjahr hatte sie sich keine Gelegenheit entgehen lassen, seine Schaufenster in Augenschein zu nehmen, und da ihr Erinnerungsvermögen von nicht nachlassender Präzision war, wusste sie oft besser als er, welche Sujets er bereits verwendet hatte: Die spiegelnde Eisfläche, auf der drei kleine Mädchen auf Schlittschuhen dahinglitten, der Heuhaufen, auf dem eine Katze lag, die mit einem Garnknäuel spielte, die herbstlich gefärbten Ahornblätter, die den Boden des Schaufensters bedeckten, über dem ein bunter Reigen von Schals und Handschuhen an unsichtbaren Fäden schwebte.
Wie hoch der Umsatz des Weihnachtsgeschäfts landesweit gewesen war, wurde seit neuestem sogar in den Nachrichten durchgegeben, üblicherweise zwei, drei Tage nach Weihnachten, spätesten am 2. Januar. Der Hunger der Menschen nach Neuigkeiten jeder Art war kaum zu stillen, man interessierte sich für alles, vor allem aber für Dinge, über die man vor wenigen Jahren, wenn überhaupt, höchstens hinter vorgehaltener Hand gesprochen hätte: Geschlechtstrieb, Drogen, Krebs, Selbstmord, Perversionen. Täglich kam etwas Neues hinzu, fast so schlimm wie während des Kriegs, den Stettler als Soldat an der Front, wartend, erlebt hatte.
Stettler wurde älter, er merkte es an allem. Er merkte es nicht nur an der schlaffer werdenden Haut, an den grauen, schütteren Haaren, an den Haaren, die ihm aus Nase und Ohren wuchsen, an den Haaren, die morgens im Waschbecken lagen, er merkte es auch, wenn er die jungen Leute Worte in den Mund nehmen hörte, die auszusprechen er sich niemals getraut hätte, Worte und Redewendungen, die ihm die Schamröte ins Gesicht trieben, wenn er nur daran dachte, und deren Bedeutung sich ihm oft nicht auf Anhieb erschloss.
Nach den Umtauschtagen zum Jahresbeginn brach das Geschäft nach dem 6. Januar jeweils dramatisch ein. Dramatisch war in diesem Zusammenhang ein oft und gern gebrauchtes Wort, obwohl es der Situation nicht gerecht wurde. Womit man rechnen konnte, war nicht dramatisch, sondern vorhersehbar. Richtig war, dass der Januar der schlechteste Verkaufsmonat des ganzen Jahres war, noch schlechter als der Juli, wenn die Menschen im Urlaub waren. Man musste die Januarverluste also schon im Dezember einholen und wettmachen.
Aufs volle Jahr gesehen war der Umsatz dennoch kontinuierlich gewachsen, seit der Krieg zu Ende war, Januarflauten hin oder her. Jährlich wuchs der Umsatz um einige Prozentpunkte. Er steigerte sich so verlässlich, dass Stettler sich manchmal fragte, wann das böse Erwachen käme und was dann geschähe, wenn alle, Käufer wie Verkäufer, den Gürtel enger schnallen mussten. Da das nicht geschah, konnte die Geschäftsleitung seit einigen Jahren den Angestellten ein dreizehntes Monatsgehalt auszahlen, das ihnen am Monatsende in einem braunen Umschlag im Büro des weißhaarigen Prokuristen ausgehändigt wurde; manche zählten nach, andere, wie Stettler, hatten keine Veranlassung, dem Mann zu misstrauen. Er war der vertrauenswürdigste Mensch, den er kannte.
Stettler wunderte sich jedes Mal, wie die Umsatzzahlen so rasch und genau ermittelt worden waren. Das Jahr 1963 war besser gewesen als 1962 und 1967 noch besser als 1966 – und nichts deutete darauf hin, dass der Boom, wie man die stete Aufwärtsbewegung der wirtschaftlichen Entwicklung nannte, jemals zum Stillstand kommen würde. Man lebte in prosperierenden Zeiten. Alles war besser als früher. Die Behaglichkeit hatte zugenommen. Das Bildungswesen stand allen offen. Karriereleitern wurden mit Leichtigkeit erklommen. Sport und Freizeit waren eins. Um Kultur und Vergnügen brauchte man sich nicht zu sorgen. Im Theater wurden Klassiker und Zeitgenossen gespielt, Frisch und Miller, Schiller und Shakespeare. Im städtischen Konzertsaal traten die großen Namen auf, Fischer-Dieskau und Casals, Irmgard Seefried, das hiesige Orchester ebenso wie die Wiener Philharmoniker.
Bereits im August begann Stettler, sich Gedanken über Weihnachten zu machen. Während die anderen im Strandbad in der Sonne lagen und hinter ihren dunklen Sonnenbrillen leicht bekleidete Frauen in Bikinis beobachteten, die sich ungeniert den Blicken fremder Männer aussetzten, brütete er in der stickigen Werkstatt darüber, wo er dieses Jahr Nikolaus, Ruprecht, den Esel und die Engel platzieren würde. Mit welchen Accessoires würde er die Schaufensterpuppen behängen, in welcher Umgebung würden sie diesmal stehen? Während er überlegte, bewegte er sich kaum. Nur das Ende des Bleistifts, den er zwischen den Fingerspitzen hielt, rollte unaufhörlich von einem Mundwinkel zum anderen. Er hatte das Gefühl, als übe der Geschmack von Graphit und Zedernholz einen positiven Einfluss auf seine Phantasie aus. Dann und wann schlug er ein Bein übers andere, oder er streckte sich. Seine Mitarbeiter sprachen mit gesenkter Stimme, wenn sie ihn so sahen. Nie gähnte er. Manche fanden, diese Phasen der Stille hätten zugenommen, seit seine Mutter gestorben war. Aber während der Arbeit dachte er nicht an seine Mutter, sondern an die leeren Schaufenster, die gefüllt werden mussten. »Mit Leben erfüllt«, wie er seinen Mitarbeitern erklärte.
Manchmal stellte er sich vor, die Schaufensterpuppen seien atmende Wesen. In seiner Vorstellung, manchmal auch in seinen Träumen, neigten sie ihre Köpfe, hoben und senkten ihre Augen, senkten und hoben Hände und Arme, rückten wie Automaten vor und zurück, immer nur wenige Zentimeter, es war aussichtslos, hätten sie das Weite suchen wollen, sie waren Gefangene.
Im Grunde arbeitete er ähnlich wie ein Bühnenbildner. Im Gegensatz zu diesem schrieb ihm jedoch niemand vor, was er zu tun und zu lassen hatte; einzige Vorgaben waren die wechselnden Saisons und damit einhergehend wiederkehrende Themen wie Schnee, Frühling, Osterhasen, Sonne, Meer, Herbst, Weihnachten und so weiter, Eckpunkte, die unzählige Variationen zuließen und seine Fantasie ebenso herausforderten wie sie sie beflügelten – so wie es die wechselnden Moden taten, die ausgestellt werden mussten.
Als Stettler jünger war, hatte er die Angewohnheit gehabt, sich bei der Konkurrenz umzusehen; das Quatre Saisons war seit über zwanzig Jahren nicht mehr das einzige Kaufhaus der Stadt, inzwischen gab es drei weitere, die sich gegenseitig Konkurrenz machten und mit immer neuen Ideen auftrumpften, natürlich auch mit jahreszeitlich bedingten Ausverkäufen. In den letzten Jahren hatte die Versuchung, sich seinen Rivalen zu stellen, stetig abgenommen. Seine Überzeugung, er sei besser als sie, weil er mehr Erfahrung hatte, war unerschütterlich. Von modernen Tendenzen wollte er nichts wissen, und auch die Kunden schienen nicht daran interessiert, an der Nase herumgeführt zu werden.
2Herbst
Der Himmel war verhangen. Wenn die Wolkendecke hin und wieder aufriss, brach eine gleißende Herbstsonne hervor und traf die Erde wie der Strahl eines Brennglases. Doch Lotte hatte den Eindruck, dass niemand nach oben blickte. Sie hatte ihre Sonnenbrille zu Hause vergessen. Hüte trug sie schon lange nicht mehr. Sie fühlte sich schutzlos.
Sie erkannte Berlin kaum wieder, nicht im Detail, noch weniger als Ganzes. Ob sie aus dem Fenster der kleinen Pension blickte oder durch die Straßen ging, Berlin blieb fremd. Der Bahnhof am Zoo, an dem sie am Vortag nach einer langen, durch lästige Grenzkontrollen unterbrochenen Zugfahrt angekommen war, war ihr nicht mehr vertraut. Sie erinnerte sich nicht, hier je einen Zug bestiegen zu haben. Stettiner und Schlesischer Bahnhof lagen jetzt unerreichbar weit entfernt hinter der Mauer. Es war nicht nötig, das Bauwerk zu sehen, um es zu spüren. Noch hatte sie es nicht mit eigenen Augen erblickt.
Den Weg vom Zoo zum Hotel war sie zu Fuß gegangen, ein Leichtes für sie, da sie nichts weiter als den kleinen Strohkoffer dabei hatte, auf dem die verschossenen Etiketten klebten, die von den Orten zeugten, an denen sie in den letzten zwanzig Jahren Urlaub gemacht hatte: Rom, Abano, Venedig, Paris, Bad Wörishofen und Bozen. Sie empfand sich als privilegierte Reisende, auch wenn sie den Atlantik nie überquert hatte und wohl kaum je überqueren würde. Nun also war sie wieder in Berlin, zum ersten Mal nach dem Krieg.
Sie hätte am liebsten kehrtgemacht. Sie hatte hier nichts zu suchen und nichts zurückgelassen außer unangenehmen Erinnerungen. Die Stadt, die sich ihr eingeprägt hatte, war durch eine Unmenge abstoßender Einzelheiten ersetzt worden, die sich mit dem Berlin ihrer Jugend nicht mehr deckten. Alles war fremd und abweisend. Manche Orte, die sie wiederzuerkennen glaubte, wirkten geschrumpft, entfärbt und bedrückend. Schatten fielen auf den holperigen Asphalt der Bürgersteige. Von wem sie geworfen wurden, war nicht zu erkennen. Sie erschrak, als eine Horde junger Männer in hautengen Blue Jeans johlend an ihr vorbeizog. Nie zuvor hatte sie Halbstarke gesehen. Pomade im Haar. Dann war es um sie herum wieder still. Es roch nach Feuchtigkeit und Laub. Sie bemerkte größere und kleinere Hundekothaufen und schmierige Spucke am Boden. Sie roch den alten beißenden Geruch der Braunkohle, der von Ost nach West, von West nach Ost über der Stadt waberte, und natürlich erkannte sie auch die Unfreundlichkeit und den nörgeligen Ton der Einheimischen wieder, der sich nicht entscheiden konnte, ob er beleidigend oder beleidigt klingen sollte. Diesmal blieb ihr keine Zeit, sich daran zu gewöhnen wie damals, denn in zwei Tagen würde sie schon wieder wegfahren. Es war zum Glück ein kurzer Besuch. Kein notwendiger Besuch. Sie verspürte keine Freude über dieses Wiedersehen, sondern Bedrückung und Kleinmut.