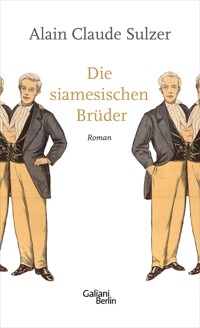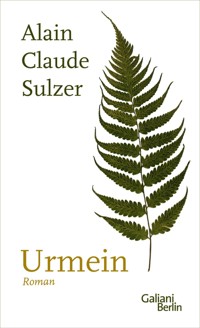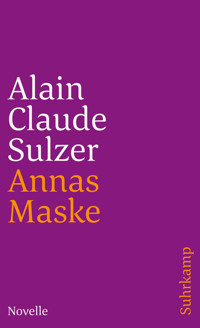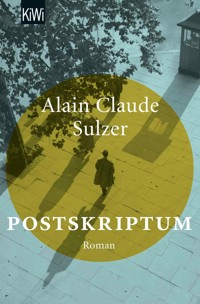8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer zur falschen Zeit den Falschen liebt … Es ist die Uhr am Handgelenk seines Vaters, die ihn aus unerfindlichen Gründen plötzlich interessiert. Siebzehn Jahre lang hatte das Foto, auf dem der Vater sie trägt, wenig beachtet im Regal in seinem Zimmer gestanden. Gekannt hatte er seinen Erzeuger nicht, die Mutter hatte ungern von ihm erzählt. Doch jetzt, mit siebzehn, erwacht seine Neugier. Es ist das Bild eines professionellen Fotografen, die Uhr aber steht auf Viertel nach sieben. Welcher Berufsfotograf macht zu solch einer Zeit Bilder? Der Erzähler beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Auf der Rückseite des Porträts findet er eine Pariser Adresse – und stellt mit Erstaunen fest, dass der Fotograf sein mysteriöser Patenonkel ist, der sich seit der Taufe nie mehr gemeldet hat. Ohne die Mutter oder den Stiefvater in seine Pläne einzuweihen, hebt er all sein Geld ab, hinterlässt einen knappen Abschiedsbrief und reist nach Paris. Dort gerät er auf die Spur der wahren Geschichte seines Vaters. Einer Geschichte, die den Boden unter seinen Füßen zum Wanken bringt. Mit großer Dezenz und dennoch mit der Wucht einer griechischen Tragödie entfaltet Alain Claude Sulzer in seinem Roman die Geschichte eines Mannes, der an sich selbst und an den Zeitumständen, in denen er lebt, scheitert. Die Geschichte eines Mannes, der erkennen muss, dass die Heirat mit seiner Frau, die ihm selbst lange wie die Rettung schien, ein Fehler war. Und dass er sie betrügen und hintergehen muss, um die wahre Liebe seines Lebens zu leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Alain Claude Sulzer
Zur falschen Zeit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alain Claude Sulzer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alain Claude Sulzer
Alain Claude Sulzerwurde 1953 geboren. Er lebt in Basel und im Elsass als freier Schriftsteller. Er hat zahl reiche Romane veröffentlicht, zuletzt »Aus den Fugen« (KiWi 1360). Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. In Frankreich gewann sein Roman »Ein perfekter Kellner« gegen Ian McEwan, Richard Ford, Don DeLillo, Denis Johnson u. a. den Prix Médicis étranger 2008 und wurde ein Bestseller. Seine letzte Auszeichnung war der Literaturpreis des Freien Deutschen Autorenverbands, den er 2014 verliehen bekam.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit siebzehn erwacht seine Neugier. Gekannt hat er seinen Erzeuger nicht; er starb kurz nach seiner Geburt. Jahrelang hat er die Fotografie, die in seinem Zimmer steht und offenbar von einem Berufsfotografen gemacht wurde, kaum beachtet, bis ihm eines Tages die Uhr am Handgelenk des Vaters auffällt. Warum zeigt sie viertel nach sieben? Welcher Fotograf macht um diese Zeit Bilder? Der Erzähler beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen, und gerät in Paris auf die Spur der wahren Geschichte seines Vaters. Mit der Wucht einer griechischen Tragödie entfaltet Alain Claude Sulzer die Geschichte eines Mannes, der an sich selbst und den Zeitumständen, in denen er lebt, scheitert.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2010, 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Manja Hellpap und Lisa Neuhelfen, Berlin
Covermotiv: © Time & Lide Picutres / Getty Images
ISBN978-3-462-30194-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
Dank
Für Martin
…denn es gibt Ereignisse, die erst gekommen sein müssen, damit wir weiter denken können.
Eduard von Keyserling (»Wellen«)
I
Mein Vater starb nur wenige Wochen nach meiner Geburt. Mir blieb nichts als ein Foto. Es gehörte zur Einrichtung wie das Bett und der Tisch, wie Schongauers Maria im Rosenhag, die Gardinen und der Schrank, Dinge, mit denen meine Mutter schon vor Jahren mein Zimmer ausgestattet hatte. Obwohl das gerahmte Porträt meines Vaters schon immer Teil der Einrichtung gewesen war, hatte ich ihm lange keine besondere Aufmerksamkeit mehr geschenkt, bis ich eines Nachmittags während der Herbstferien vor dem Bücherregal stehenblieb und es, zum ersten Mal seit langer Zeit, genauer betrachtete. So genau wie nie zuvor. Ich war siebzehn, es war ein Mittwochnachmittag, es ist lange her.
Der Mann auf dem Foto, mein Vater, hatte das Kinn leicht auf die schmalen Knöchel der umgeknickten linken Hand gestützt. Vielleicht war es Zufall, daß die Uhr, die er am Handgelenk trug, mein Interesse auf sich zog. Bislang hatte ich sie übersehen. Da das Zifferblatt dem Betrachter zugewandt war, konnte man die Uhrzeit und das Markenzeichen erkennen. Die Zeiger standen auf Viertel nach sieben, es handelte sich unverkennbar um eine Omega. Plötzlich sprang mir ins Auge, was ich bislang übersehen hatte, und ich war irritiert.
Obwohl die Uhrzeit deutlich zu erkennen war, blieb die Tageszeit ebenso im Dunkeln wie die Umgebung, in der das Bild entstanden war. Die Aufnahme konnte ebenso um sieben Uhr fünfzehn morgens wie um sieben Uhr fünfzehn abends aufgenommen worden sein. Wer hatte sie gemacht?
Irgendein Fotograf natürlich. Das Foto, das meinen Vater für immer festhielt, war, so mein Eindruck, in einem professionellen Atelier aufgenommen worden, nicht in natürlicher Umgebung, entweder von einem Fotografen oder von einem talentierten Laien, jedenfalls von jemandem, der sein Handwerk verstand. Das würde sich mit Leichtigkeit überprüfen lassen. Es genügte, das Foto aus dem Rahmen zu lösen, den festen Schutzkarton zu entfernen und nach einem Firmenstempel auf der Rückseite des Fotos zu schauen, jedoch erst später, jetzt hielt mich irgend etwas davon ab. Sieben Uhr fünfzehn war weder morgens noch abends die übliche Zeit für einen Termin beim Fotografen, sieben Uhr fünfzehn war in jedem Fall ungewöhnlich.
Das war kein Gelegenheitsfoto. Ein Schnappschuß in ungezwungener Atmosphäre wäre niemals so gut gelungen, die Aufnahme mußte während einer längeren Sitzung entstanden sein. Gegen ein Amateurfoto sprach auch, daß das Licht nicht zufällig, sondern gezielt auf sein Gesicht gefallen war, das zumindest war mein Eindruck. Es war zur Gänze ausgeleuchtet, wirkte aber weder flächig noch unkonturiert. Jede Härte war mit Geschick vermieden worden, aber auch jede Weichheit. Die Schatten unter den Augen, unter der Nase und der Unterlippe waren fein, eher schraffiert als gezeichnet. Alles war deutlich, aber nicht überdeutlich hervorgehoben, die Nase, der Mund, das Kinn und die Wangen. Die Augen bildeten den Mittelpunkt, die Attraktion des Bildes, und waren mit meinen fast identisch, zumindest die Form und die Helligkeit, etwas Durchdringendes, ein wenig Befremdliches. Sie waren etwas dunkler als meine. Ich sollte vielleicht nachtragen, daß es sich um ein Schwarzweißfoto handelte, es war vor zwei Jahrzehnten in den 50er Jahren entstanden.
Es zeigte, was es zeigen sollte, und vielleicht noch etwas mehr. Zunächst einmal war darauf ein sehr junger Mann zu erkennen, dessen Gesicht, anders als der Kragen seines Hemds oder der Stil dieser Aufnahme, nicht aus der Mode gekommen war wie andere Gesichter auf anderen alten Fotos, die einem, wenn die Jahre vergangen sind, fast immer unzeitgemäß erscheinen, zeitgemäß im Rahmen ihrer, aber unzeitgemäß im Rahmen unserer Zeit. Bei diesem Foto war es ganz anders. Es klaffte kein unüberwindlicher Abgrund zwischen heute und damals.
Vielleicht hatte die Aufnahme etwas Bestimmtes bezwecken wollen, weshalb sie den Abgebildeten in ein von ihm gewünschtes Licht zu rücken versuchte. Mir war nicht klar, in welches, aber mir schien diese Möglichkeit nicht allzuweit hergeholt. Allerdings wollte mir nicht einfallen, zu welchem Zweck man solche Fotos brauchte, für welche Bewerbungen sie hilfreich oder gar unerläßlich sein konnten. Die Zeit, in der es entstanden war, kannte ich nur vom Hörensagen.
Um ein Paßfoto handelte es sich auf keinen Fall. Dagegen sprach nicht nur das ungewohnte Format, sondern auch der regelwidrige Ausschnitt, das aufgestützte Kinn und die Armbanduhr, deren helles Zifferblatt ein fast gleichwertiges, wenn auch vergleichsweise unbedeutendes Pendant zum Gesicht bildete. Anders als bei einem Paßfoto wurde hier nicht das Signifikante, sondern eine Persönlichkeit hervorgehoben. Das alles hatte ich bislang übersehen, an jenem Mittwochnachmittag aber traf es mich mit voller Wucht.
Ein Fotograf hatte sich entschieden, die Blende zu öffnen und zuschnappen zu lassen. Er hatte das Bild entwickelt und fixiert. Auf Fotopapier gebannt, hatte man es hinter Glas in einen Holzrahmen gesteckt, der so aussah, als habe es ihn schon lange vor meiner Geburt gegeben, als er mit seinen vier gewölbten Holzärmchen noch ein Aquarell oder eine Stickerei umfaßt hatte. Nun bewahrte er das Bild meines Vaters für die Nachwelt auf. Ich war die Nachwelt.
Wie viele Jahre hatte dieses Foto dort gestanden, ohne daß ich es eines Blickes gewürdigt hatte, wie viele tausend Male war ich, seitdem ich dieses Zimmer bezogen hatte, achtlos daran vorbeigegangen, wie wenig fehlte, und ich hätte das Bild an irgendeinem Ort verstaut und vergessen. Doch plötzlich war das Foto meines Vaters nicht mehr so belanglos wie der Stoffteddybär, der ebenfalls im Bücherregal stand und dem einst meine uneingeschränkte Zuneigung und Aufmerksamkeit gehört hatten. Ohnmächtig winkte er mir jetzt mit seinen fast haarlosen Tatzen aus einer anderen Welt zu. Während ich mich aber des salzigen Geschmacks entsinnen konnte, den seine Filzohren auf meiner Zunge hinterlassen hatten, wenn ich darauf herumkaute, weckte der Abgebildete keine Erinnerung, weder an einen Geruch noch an eine Berührung. Das Foto war ohne Anfang und Ende. An jenem Mittwochnachmittag aber zeigte es mir etwas, was ich nicht kannte. Ich spürte den Verlust eines Menschen, dem ich nie begegnet war. Vielleicht hatte ich siebzehn Jahre alt werden müssen, um darauf zu stoßen, mit sechzehn hatte ich es nicht sehen können, mit achtzehn wäre ich womöglich schon wieder blind dafür gewesen.
Viertel nach sieben. Was für eine ausgefallene Zeit für einen Fototermin, dachte ich und nahm die Fotografie vom Regal. Ich führte sie so dicht vor meine Augen, bis ich gar nichts mehr sah. Das Glas beschlug leicht, als ich es anhauchte. Ich fuhr mit dem Handrücken darüber. Das Gefühl eines großen Verlusts, das ich beim Anblick dieses Bildes empfand, war neu und veränderte meine Wahrnehmung.
Plötzlich sah ich ein anderes Bild und einen anderen Menschen. Plötzlich fühlte ich etwas, was mir bis anhin fremd gewesen war. Daß es so kommen würde, war eine Frage der Zeit, und die Zeit war gekommen, ohne sich lautstark und glanzvoll anzukündigen. Kein Blitz, kein Donner, nur ein Lidschlag. Die Veränderung ging innerhalb kurzer Zeit vor sich, und dennoch hatte ich das Gefühl einer deutlichen Verlangsamung, zunächst auch großer Ruhe.
Ich sah einen Mann, den ich nie zuvor gesehen hatte, einen Mann, der nicht viel älter war als ich, der im Gegensatz zu mir erwachsen war und mir ähnlich sah. Nie zuvor war mir so klar gewesen, daß ich nichts über ihn wußte und daß ich das einzige, was ich von ihm hätte besitzen müssen, nicht besaß: die Uhr auf diesem Foto. Wo war die Omega, wer hatte sie an sich genommen, warum besaß ich sie nicht?
Ich würde nie erfahren, wie der Mann auf dem Foto gesprochen hatte, ob seine Stimme tief oder hoch, entschlossen oder zögerlich, laut oder leise, deutlich oder undeutlich, hell oder dunkel, brüchig oder klangvoll gewesen war. Wozu war sie fähig gewesen? Wozu war er fähig gewesen? Ich konnte ihn nicht sprechen hören, ich würde ihn nie sprechen hören. Daß er nicht sprach hieß nicht, daß er schwieg, und daß ich nichts hörte hieß nicht, daß ich nichts vernahm. Wie hatte ich das Foto so lange vernachlässigen können, warum war ich so lange blind dafür gewesen? Ich stellte den Rahmen ins Regal zurück, ging aber nicht weg, ich wendete mich nicht um, trat lediglich einen Schritt zurück und sah weiter gebannt auf das Foto. Dann legte ich mich aufs Bett. Das Foto behielt ich im Auge. Ich hatte viele Fragen und keine Antworten.
Meine Mutter hatte seine Papiere verloren. Einige Wochen vor jenem entscheidenden Mittwoch hatte sich eine der seltenen Gelegenheiten ergeben, über meinen Vater zu sprechen, denen meine Mutter andere Male so geschickt auszuweichen verstand. Ich hatte mich an ihre Ausweichmanöver gewöhnt und redete mir ein, über meinen Vater zu sprechen sei zu schmerzhaft für sie.
Wir hielten uns im Garten auf, sie saß unter dem Sonnenschirm, ich lag auf einem Liegestuhl in der prallen Sonne. Auf dem Tisch lag ein aufgeschlagenes Buch mit dem Rücken nach oben, sie war im Begriff, sich die Fingernägel zu färben. Der Schutzumschlag war so rot wie der Nagellack, den sie in gleichmäßigen Bewegungen über ihre Nägel strich und dessen filigraner Acetongeruch angenehm in der Nase kitzelte. Schon als kleiner Junge hatte ich hinter ihrem Rücken oft an dem offenen Fläschchen gerochen, bis mir schwindelig wurde.
Sie wirkte etwas nervös und war blaß. Dann sagte sie unvermittelt, sie müsse mir etwas Unerfreuliches mitteilen.
Ich war auf alles mögliche gefaßt, nur nicht auf das. Und so gelang ihr, gegen ihren Willen, eine Überraschung. Sie räusperte sich und sprach von den Sachen meines Vaters.
»Die Sachen sind verlorengegangen, ich weiß nicht, wie«, sagte sie hastig, wobei sie sich bemühte, betont bekümmert zu klingen.
Ich wäre auch dann stutzig geworden, wenn sie freiwillig etwas ausführlicher gewesen wäre. Ich merkte, daß sie diese Information loswerden wollte, wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit. Sie würde nicht lange darüber sprechen, sie wollte nur, daß ich es wußte. Es war die Beiläufigkeit, mit der sie diesen Verlust erwähnte, die mich aufhorchen ließ. Sie war mir fast verdächtiger als der Ton, in dem sie darüber sprach.
Ich fragte nach, und sie erzählte mir, daß sie diese Hinterlassenschaft verloren hätte, ich habe beide Worte noch heute im Ohr, »Hinterlassenschaft« und »verloren«. Sie erwähnte nicht wann und nicht wo. Doch ließen ihre Worte keinen Zweifel daran, daß der Verlust endgültig war. Vielleicht hatte sie seine Sachen schon vor Jahren verloren. Jetzt schien es ihr an der Zeit, mir die Wahrheit zu sagen. Sie hätte mir die Existenz dessen, was es nun nicht mehr gab, auch verheimlichen können. Sie war so ehrlich, es nicht zu tun.
Ich bin sicher, daß ihr meine Fassungslosigkeit nicht entging. Sie hatte aufgehört, das Pinselchen über ihre Nägel zu streichen, und sah mich an. Als sich unsere Blicke trafen, hielt der ihre dem meinen nicht stand. Sie sah auf ihre halbfertig bemalten Nägel und rollte geistesabwesend das Pinselchen zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. Daß ich schwieg, war ihr peinlich, ihr fiel aber nicht ein, was sie sagen sollte. Ich hatte meinen Vater nicht gekannt, was sollte ich also vermissen? Wo nichts aus der Vergangenheit spricht, kann sie sich auch nicht melden. Das dachte sie wahrscheinlich. Das hoffte sie vielleicht.
Das war nun eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen wir über ihn sprachen, doch anders als sonst empfand ich sie als dramatisch, und ihr erging es offenbar genauso. Sonst wäre sie nicht dagesessen, als hätte ich sie bei einer Indiskretion ertappt. Jetzt war klar, daß außer einem Foto und ein paar wertlosen Schnappschüssen nichts von ihm übrigblieb, daß selbst die schriftlichen Spuren seiner Existenz verloren waren, daß es nichts gab, woran ich mich festhalten konnte, wenn ich mir Gedanken über ihn machen wollte.
Während sie vielleicht gedacht hatte, ich würde mich mit dieser dürftigen Information zufriedengeben, wunderte ich mich, wie etwas, was einem anderen wichtig gewesen war, der einem wichtig gewesen war, verlorengehen konnte, ohne daß man es vermißte. Das einzige Problem meiner Mutter hatte offenbar darin bestanden, mir den Verlust zu melden, ihn selbst schien sie spielend zu verkraften. Lag es daran, daß er eine Weile zurücklag? Ich ging nicht so weit, mich zu fragen, ob sie die Sachen in einem unbedachten Augenblick achtlos weggeworfen hatte. Oder besser gesagt, ich schob diesen Gedanken von mir, weil ich ihr genau das unterstellte.
Meine Mutter war anständig. Sie bemühte sich so sehr darum, ihr Haus sauberzuhalten, daß ihm, wie ich manchmal fand, etwas beinahe Unbelebtes innewohnte, was mir ein bißchen peinlich war, wenn Freunde kamen, die in anderen Verhältnissen lebten, um die ich sie manchmal fast beneidete. Während sie mein Zimmer längst mir selbst überlassen hatte und dieses entsprechend ungepflegt war, sahen die anderen Räume wie Hotelzimmer aus, die auf Gäste warteten. Wie hatte sie, die Ordnungsliebende, etwas so Aufschlußreiches wie den schriftlichen Nachlaß ihres verstorbenen Mannes verlieren können, warum hatte sie die paar verbliebenen Dinge nicht wie ihren Augapfel gehütet, wenn schon nicht ihretwegen, dann meinetwegen? Wie erklärte sich dieser Verlust? Das Unerklärliche erklärt sich nicht, sagte ich mir, aber diese Antwort war altklug und unbefriedigend. Plötzlich kam mir der naheliegende Gedanke, diese Papiere seien ihr von dem Augenblick an nicht mehr wichtig gewesen, als ihr mein Vater nicht mehr wichtig war. Zählten tatsächlich nur noch mein Stiefvater und ich?
Sie machte mir keinerlei Hoffnung, die Papiere irgendwann wiederzufinden, sie waren weg. Worum hatte es sich dabei gehandelt? Sie überlegte kurz und sagte dann: »Papierkram.«
»Papierkram?« Seine Geburtsurkunde, sein Paß, sein Führerschein, ich wußte nicht einmal, ob er einen besessen hatte, Schulzeugnisse, Briefe, Tagebücher, ich wußte nicht, was mir entging, ich wußte nicht, was ich vermißte, ich wußte nicht, was man mir weggenommen hatte. Meine Mutter zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nur noch, daß es eine schwarze Mappe war, in die ich vor Ewigkeiten zuletzt hineingeschaut hatte. Ich glaube, sie war rot gefüttert, mit roter Seide. Ich kann mich kaum erinnern.« »Und was war drin?« »Ich kann mich nicht erinnern.«
Schließlich seufzte sie, aber ihr Seufzen kam mir so unglaubwürdig vor wie der Kummer von vorhin. Was sie mir auch vorzumachen versuchte, der Verlust seiner Sachen ging ihr nicht nah.
Dinge kommen ständig abhanden, natürlich. Es hatte mehrere Anlässe gegeben, bei denen man Sachen verlieren konnte, zwei Umzüge, von einer Wohnung, an die ich mich nicht erinnere, in eine andere, an die ich mich kaum erinnere, und später in das Haus, das ich stets als mein Elternhaus betrachtet habe, das Haus meiner Mutter und meines Stiefvaters, in dem ich lebte und das ich zwei Jahre später, für niemanden überraschend, verließ.
Je länger ich in meinem Liegestuhl lag, desto unverständlicher wurde mir das Verhalten meiner Mutter. Es war, als hätte sie tatsächlich ausgesprochen, was ich nur unterstellen konnte, daß ihr die Mappe nicht wichtig gewesen war. Sie hatte gedacht, mein Vater sei mir so gleichgültig wie ihr, ich hatte ihn nicht gekannt, wie konnte ich ihn vermissen? Dabei konnte ich ihr nichts vorwerfen. Weder war ich mit Geschichten über einen beispiellos guten Vater gequält worden, noch hatte ich Grund, eifersüchtig auf Halbgeschwister zu sein, die es nicht gab, oder auf Roland, der sich mir gegenüber loyal verhielt. Daß die Vergangenheit eine Lücke aufwies, war nicht ihre Schuld. Lange hatte ich sie gar nicht gespürt. Worüber hätten mir die Papiere meines Vaters Auskunft und Aufschluß gegeben? Sie hatte nie schlecht über ihn gesprochen, sie sprach kaum über ihn.
Unser Gespräch, das keines war, wurde beendet, als meine Mutter den Nagellack auf den Tisch stellen wollte. Da sie kurzsichtig war, aber meist keine Brille trug, stieß sie mit dem Fläschchen gegen die Tischkante und ließ es fallen. Lautlos kippte es ins Gras, wo sich sein zähflüssiger Inhalt über den grünen Rasen ergoß und einen grellroten Fleck hinterließ, der, zusehends dunkler werdend, noch Wochen später zu erkennen war.
Ich mußte mich damit abfinden, daß es von meinem Vater kein weiteres Porträt gab. Bei den anderen Fotos, die meine Mutter in einem zerknitterten Umschlag in ihrem Sekretär aufbewahrte, handelte es sich um Schnappschüsse, auf denen er nur undeutlich zu erkennen war. Ich nahm mir vor, auch diese Bilder, die ich bislang bloß flüchtig betrachtet hatte, einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Dazu genügte es, aufzustehen und den Sekretär meiner Mutter zu durchsuchen, der nie abgeschlossen war, ich würde sie finden, doch ich blieb liegen. Das, sagte ich mir, hatte Zeit.
Doch wenig später stand ich auf, öffnete den Sekretär und stieß bald auf die Bilder.
Sie waren klein und quadratisch und waren ein Jahr vor meiner Geburt, im Sommer 1953, entstanden. So war es auf der Rückseite des Umschlags vermerkt. Die wenigen Personen auf diesen undatierten Aufnahmen blinzelten in die Sonne, schützten ihre Augen vor der Helligkeit oder waren zu weit von der Kamera entfernt, um mehr als Umrisse abzugeben. Auf diese Weise hatten sie sich fast unkenntlich gemacht. Auf den meisten Bildern war mein Vater abgebildet, einmal im Sand sitzend allein, einmal mit meiner Mutter, einmal mit einem verwahrlosten Hund, der traurig und rastlos in die Kamera blickte, von der er Zuwendung zu erhoffen schien. Bei den restlichen Fotos handelte es sich um Landschaftsaufnahmen: Heller Strand ohne Menschen. Wasser, Wolken, Sand und Himmel und ein streunender Hund.
Die matt glänzende Haut meines Vaters hob sich dunkel von der weißen Badehose mit dem breiten Gürtel ab, ein schlaksiger, mittelgroßer junger Mann, dessen Gesicht unter der breiten Krempe eines Strohhuts ausdruckslos war. Augen und Nase waren verdeckt, deutlich zu erkennen waren die vollen Lippen des halb geöffneten Mundes und das runde Kinn. Um den Hals trug er eine dünne Muschelkette, die er vermutlich bei einem Strandverkäufer erworben hatte, vielleicht beim selben Mann, der später das Foto geschossen hatte. Auf diesem Foto war er allein, rechts im Bild lag ein Gummiball, ein einzelner fremder Fuß hatte sich links ins Bild geschoben.
Nicht die Menschen auf den Fotos, sondern die Fotos selbst spielten hier die Hauptrolle. Sie waren der Beweis dafür, daß die abgelichteten Menschen tatsächlich in der Fremde gewesen waren, wo sie sich, Hunderte von Kilometern von zu Hause entfernt, an Orten aufgehalten hatten, wie es sie zu Hause nicht gab, wo Menschen auf sie warteten, die das Meer nur von anderen Fotos kannten oder im Kino gesehen hatten, und denen man später anhand dieser Bilder erklären würde, wie es dort wirklich gewesen war, was man aß, was man trank, wie es roch, was anders war als zu Hause, die Hitze, das Salz und der Sand.
Es waren, wie gesagt, lediglich Schnappschüsse. Darauf sah man meine Mutter und meinen Vater, ein paar Fremde, alle in Badeanzügen, dazu das Meer, den Strand, ein winziges Strandcafé, bestehend aus Sonnenschirmen, Stühlen und Tischen sowie einem Reklameschild für Crêpes und Eis. Ich kannte das alles, denn seit ich denken konnte, fuhren wir jedes Jahr in den Süden, wenn auch nicht nach Frankreich. Aber nie kam meine Mutter während dieser Reisen auf meinen Vater zu sprechen, nie hörte ich sie sagen: Da waren wir auch, oder: Das erinnert mich an deinen Vater, nie nahm ihre Miene einen träumerischen Ausdruck an, wenn sie über ihn sprach. Sie hatten ihren einzigen Sommerurlaub in Frankreich verbracht, ihre kurze Hochzeitsreise hatte sie nach Venedig geführt.
Wenn sie über ihn sprach, tat sie es, wie mir schien, um mir einen Gefallen zu tun, nicht um die Erinnerung an ihn aufzufrischen, meinetwegen, nicht ihretwegen. Ihre Erinnerungen waren fast zwanzig Jahre alt. Ich wußte nicht einmal, ob die Urlaubsfotos vor oder nach ihrer Hochzeit entstanden waren. Zu jener Zeit war es nicht üblich, daß Verlobte ihren Urlaub gemeinsam verbrachten. War sie damals schon schwanger? Es existierte kein Hochzeitsfoto. Waren es Fotos von ihrer Hochzeitsreise?
Sicher waren Hochzeitsfotos gemacht worden, aber wahrscheinlich hatten auch die sich in der verschollenen Mappe befunden. Die Fotos, die anläßlich der Hochzeit meiner Mutter mit Roland entstanden waren, gab es hingegen noch. Vielleicht aus Rücksicht auf mich standen sie nicht an prominenter Stelle, sondern wurden im Sekretär aufbewahrt, zwei Fotos, datiert auf August 1957, ich war damals drei Jahre alt. Drei Jahre nach dem Selbstmord meines Vaters hatte meine Mutter zum zweiten Mal geheiratet.
Wie lange war sie mit meinem Vater glücklich gewesen, wie glücklich war sie mit ihm, hatte er mit Rücksicht auf ihren Zustand meine Geburt abgewartet, bevor er seine Entscheidung traf?
Der Kontakt zu meinem Großvater väterlicherseits war nicht völlig abgebrochen, auch nicht, als er ein Jahr nach dem Tod meiner Großmutter nach Lugano gezogen war und ein paar Jahre später wieder geheiratet hatte. Aber es war nicht einfach, die Beziehung über diese Entfernung aufrechtzuerhalten. Regelmäßig zum Geburtstag schickte er eine Karte, aber eine Einladung, ihn im Tessin zu besuchen, erfolgte nicht. Seine alte Heimat schien er nicht zu vermissen, und so konnte ich mich kaum an ihn erinnern. Bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr erhielt ich nebst einem Hunderter farbige Ansichtskarten mit Seeblick und Bergen und »Grüße aus Lugano und alles Gute zu Deinem Geburtstag, Gott beschütze Dich, Dein Opa«, Worte, die mir manchmal ein Gefühl gaben, als striche eine Hand über mein Haar, etwas, was Roland nie tat und wogegen ich mich wahrscheinlich gewehrt hätte, hätte er es versucht. Das Gefühl war stark, hielt aber nicht lange an. Mein Großvater oder seine neue Frau horteten offenbar einen ganzen Packen dieser Ansichtskarten, jahrelang erhielt ich abwechselnd immer dieselben.
Wir hätten meinen Großvater auf der Durchfahrt in den Süden natürlich besuchen können. Warum wir es nicht taten, blieb ein Rätsel, das zu lösen mir nicht wichtig schien.
Das Geld wurde auf einem Sparheft zurückgelegt, das ich nicht antastete. Mit siebzehn besaß ich fast zweitausend Franken. »Dein Geld aus Lugano«, wie meine Mutter sagte.
Ich erinnerte mich dunkel an einen großen Mann mit weißen Haaren und einer gelben Strickjacke. Ich wurde angehalten, ihm zu schreiben und mich zu bedanken, was mir nicht leicht fiel, weil ich mir einbildete, man könnte die richtigen Worte nur finden, wenn man wisse, an wen man schreibe. Ich nehme an, daß ich mehr oder weniger stets dasselbe schrieb und daß nur meine Schrift sich allmählich veränderte. Sie wurde immer nachlässiger, was man vor allem in der Schule bemängelte. Statt vorwärts zu streben, neigten sich meine Buchstaben nach hinten, und je mehr man das kritisierte, desto schräger wurden sie. Ich strengte mich an, eine häßliche Klaue zu haben.
Den letzten Scheck erhielt ich zu meinem fünfzehnten Geburtstag. Danach schrieb er mir nicht mehr, und ich brauchte nicht zu antworten, ich hatte keinen Grund, und niemand forderte mich dazu auf. Falls mein Großvater starb, würde man es sicher erfahren. Offenbar hatten er und seine neue Frau meinen Geburtstag vergessen. Ich fühlte mich nicht vernachlässigt. Das Gefühl, durch seine Worte berührt zu werden, stellte sich nicht mehr ein. Ich hatte nur selten an ihn gedacht, nun dachte ich noch seltener an ihn. Er lebte und hatte mich vergessen.
Ich hatte keine Ahnung, ob mein Großvater noch berufstätig war und in welchen Verhältnissen er lebte, nahm aber auf Grund seiner Zuwendungen an, daß er gutsituiert sei.
Mein Vater war das einzige Kind meiner Großeltern gewesen so wie ich das einzige Kind meiner Eltern war.
Plötzlich wollte ich das Bild nicht mehr sehen. Abrupt drehte ich mich zur Wand um. Ich wollte nicht. Ich wollte nichts von ihm. Was ich verlangt hätte, hätte ich nicht erhalten. Eine Weile starrte ich an die Wand, auf die Tapete mit dem einfachen Muster, das ich so gut kannte. Im Haus war es still, ich hörte meinen eigenen Atem.
Meine Mutter war ausgegangen. Wenn ich am Mittwochnachmittag zu Hause blieb, nutzte sie oftmals die Gelegenheit, Freundinnen zu treffen. Obwohl es keinen Grund zur Besorgnis gab, ließ sie das Haus ungern allein. Sie ging nicht weg, wenn niemand zu Hause war, sie hütete das Haus wie ein Hund, der eine Aufgabe braucht, das waren ihre eigenen Worte. Dabei lebten wir in einer sicheren Gegend. Gab es bei uns unsichere Gegenden? Die mochte es dort geben, wo mein Großvater lebte. Warum hatte mein Vater keinen anderen Ausweg gesehen, hatte er überhaupt nach einem Ausweg gesucht? Ich wußte wenig über ihn und so gut wie nichts über sein tragisches Ende. Nicht mehr als das, was ein paar Halbsätze, die ich im Lauf der Jahre gehört hatte, an dürftigen Auskünften abwarfen. Mir kam es vor, als wäre ich aus einer Erstarrung erwacht. Ich drehte mich wieder zur Fotografie um. Ich wußte nichts über die Umstände, die dazu geführt hatten, daß er Selbstmord beging. Lag das einzig und allein daran, daß ich nie danach gefragt hatte?
Wahrscheinlich hatte man vor der Sitzung die Vorhänge zugezogen und einen Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Wahrscheinlich hatte man einen dieser weißen Fotografenschirme aufgestellt, um das Licht besser zu verteilen. Das Gesicht, die Hand und die Armbanduhr hoben sich deutlich vom dunklen Hintergrund ab. Doch gab es nicht den geringsten Anhaltspunkt, wo das Bild entstanden war. Er trug ein dunkles Jackett, ein weißes Hemd und eine diagonal gestreifte Krawatte. Es war ein Brustbild, vom Scheitel bis etwa zur Höhe des Brustbeins.
Die Haare trug er ziemlich lang, länger, als es zur Zeit der Aufnahme Mode gewesen war. Der Haarschnitt paßte eher zu einem Künstler als zu einem Lehrer. Die Haare waren nach hinten gekämmt und dunkel, vielleicht mit etwas Gel gefestigt. Vielleicht hatte er sich durch die Art, wie er seine Haare trug, von den anderen unterscheiden wollen.
Ich wußte nicht, welche Klassen und Altersgruppen er unterrichtet hatte. Ich wußte nicht, ob er, anders als ich, sportlich gewesen war. Auf den Urlaubsfotos war ein schlanker, aber nicht sonderlich athletischer Mann zu sehen. Ich wußte, daß er nach dem Abschluß seines Pädagogikstudiums zwei oder drei Jahre lang unterrichtet hatte, ich wußte aber nicht, an welcher Schule und in welchem Schulhaus. Er hatte Französisch und Deutsch unterrichtet, das hatte man mir erzählt. Als er starb, war er vierundzwanzig, ein Jahr älter als meine Mutter.
Ich wußte mehr über die Frisuren, die in seiner Jugend Mode gewesen waren, als über seine Vorlieben und Abneigungen. Ich wußte nichts über sein Verhältnis zu den Eltern und zu fremden Autoritäten. Ich wußte nichts über seine Lehrer und nichts über seine Schüler, ich wußte nicht, ob er sich je einen Sohn gewünscht hatte. Ich war siebzehn und ahnungslos, ich hatte nie über den Tellerrand meiner eigenen Existenz geblickt, es war bislang auch nicht nötig gewesen. Ich war zugeknöpft und schüchtern.
Zurückhaltung und Versöhnlichkeit sind keine Tugenden, die ein Siebzehnjähriger anstrebt. Doch genau so muß ich damals auf andere gewirkt haben, zurückhaltend und vernünftig, vielleicht auch nur langweilig. Wie hätte ich dagegen aufbegehren können? Indem ich mir einen Bart wachsen ließ und rauchte? Ich rauchte, aber das bißchen Flaum, das auf meinen Wangen sproß, hätte das fehlende Selbstvertrauen nur unterstrichen. Ich hatte keine ausgeprägten Abneigungen. Ich hatte Freunde, aber wenn sie nicht da waren, vermißte ich sie nicht. Ich nehme an, es ging ihnen nicht anders. Niemand empfand besondere Antipathien gegen mich, man ließ mich in Ruhe. In der Schule gehörte ich zu keiner Gruppe, wurde aber auch von keiner gemieden. Kaum jemand wußte über meine familiäre Situation Bescheid. Mein Stiefvater hatte mich adoptiert, ich trug seinen Namen. Ich glaube, man sah uns nicht an, daß wir nicht verwandt waren.
Ich war in einer Familie aufgewachsen, die ich stets als intakt empfunden hatte. Ich liebte meinen Stiefvater wie einen leiblichen Vater oder so, wie ich mir vorstellte, daß man seinen leiblichen Vater lieben sollte. Vielleicht war es auch Wertschätzung, aber war die für das Zusammenleben nicht ebenso notwendig wie Zuneigung? Ich wußte, daß Wertschätzung mit Liebe nicht gleichzusetzen ist. Ich wußte, daß es Formen der Verbundenheit gab, die mit Liebe oder Wertschätzung nur wenig zu tun hatten, sie reichten von Nichtbeachtung zu Mißachtung und nicht selten zur Verachtung. Völlige Abneigung war nicht selten der sichtbarste Ausdruck der Zusammengehörigkeit, aber auch der Unverträglichkeit. Ich glaubte bei meinen Mitschülern alle möglichen widersprüchlichen Empfindungen erkennen zu können, die ich vermissen ließ. Meine Achtung vor Roland war keinen Schwankungen unterworfen. Vielleicht war sie nichts weiter als Gleichgültigkeit.
Kurz nach der Einschulung, als ich sieben Jahre alt war, hatte man mir schonend beigebracht, daß mein leiblicher Vater wenige Wochen nach meiner Geburt gestorben war. Eine Enthüllung, die keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Ich speicherte die nackte Mitteilung. Man hatte nicht erwähnt, auf welche Art und Weise er gestorben war, das erfuhr ich erst später, mit zehn oder elf, von meiner Mutter. An dieses Gespräch allerdings erinnere ich mich in fast allen Einzelheiten. Es fand an einem Sonntagnachmittag im Winter statt, draußen tauten alte Schneehügel in der Sonne, irgendwo quietschte ein Autoreifen, als müsse jemand scharf bremsen. Wie alle wichtigen Gespräche, die meine Mutter und ich über meinen Vater führten, hatte sie auch dieses Mal dafür gesorgt, daß Roland nicht dabei war. Daß mir seine Gegenwart in diesem Augenblick lieb gewesen wäre, konnte sie nicht wissen. Heute frage ich mich, weshalb er nie mit mir darüber sprach. Ich frage mich auch, warum ich ihn nicht zur Rede stellte. Habe ich damit gerechnet, ihn, der nichts mit der Sache zu tun hatte, aus der Fassung zu bringen, habe ich das befürchtet, oder wollte ich »die Sache« einfach mit niemandem teilen?
Meine Mutter schuf eine Situation, die ihn ausschloß, eine Situation, die außer uns beiden niemanden etwas anging. Sie saß auf dem Sofa und forderte mich auf, mich neben sie zu setzen, etwas Ungewohntes, dem ich mich nicht verweigern konnte. Ich habe vergessen, ob wir etwas tranken.
Es ergab sich, daß wir uns anschauten, oder es gelang ihr, es irgendwie zu erzwingen. Sie legte eine Hand auf meine Schulter und sah mir in die Augen. Ich konnte eine Weile die Augen nicht von ihr abwenden. All das war ungewöhnlich. Es war dramatisch, und das paßte nicht zu ihr. Es paßte nicht zu ihr, sich zu beherrschen, sie hatte niemals Grund, sich zu beherrschen. Sie sagte, mein Vater sei nicht einfach so gestorben. Er sei weder krank gewesen noch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich staunte und schaute vermutlich erstaunt. Vorsichtig begann sie über sein Ende zu sprechen, über seinen »Tod«, wie sie schließlich sagte. Alles, was sie sagte, sagte sie freiwillig. Und dennoch redete sie, als ob jemand sie nötigte, über Dinge zu sprechen, über die sie lieber geschwiegen hätte. Ich stellte keine Fragen, ich hörte nur zu. Ich war es nicht, der etwas von ihr forderte. Ich hörte aufmerksam zu, ich sah sie an, und plötzlich hielt sie meinem Blick nicht mehr stand. Vielleicht hatte sie sich jeden Satz genau überlegt, vermutlich hatte sie sogar mit meiner Reaktion gerechnet. Ich schwieg und starrte sie an. Es war, als versuchte ich trotzig die Annahme dieser Information zu verweigern. »Hast du mich verstanden«, fragte sie schließlich. Ich weiß noch, daß ich nickte. Ich hatte verstanden, daß mein Vater Selbstmord begangen hatte, aber nicht, was das bedeutete.
II
Ich brauchte eine Lupe. Ich fand sie nach längerem Suchen in Rolands Arbeitszimmer in der oberen Schublade seines neuen Schreibtischs. Ich mußte vergrößern, was kaum zu erkennen war, das, was meinem Vater etwas bedeutet hatte. Mich interessierte die Uhr an seinem Arm. Sie war elegant und wirkte kostbar.
Ich legte die gerahmte Fotografie unter meine Schreibtischlampe, knipste das Licht an und fuhr mit der Lupe langsam über das Bild, vom Scheitel zum Hals, weiter zur Brust und zum Handgelenk. Endlich war das Glas auf die Armbanduhr gerichtet. Das Markenzeichen, das im oberen Viertel des Zifferblatts zu erkennen war, sah aus wie der Körper eines nach Luft schnappenden Plattfischs. Das offene Maul zeigte nach oben, darunter stand in Blockschrift der Firmenname und Automatic. Ein weiterer, kursiv gesetzter Schriftzug im unteren Viertel des Zifferblatts hatte ohne Hilfe der Lupe keinen Sinn ergeben. Nun wurde mir klar, weshalb ich das Wort nicht hatte entziffern können. Ich hatte den ersten Buchstaben für ein schwungvolles G gehalten und eine reiche Auswahl aller möglichen Absurditäten gelesen: Gernastor, Gamsaseit, Garmador, Gumraster.
Nachdem ich das Vergrößerungsglas zu Hilfe genommen und sich der erste Buchstabe als S entpuppt hatte, entschlüsselte ich mit Leichtigkeit das ganze Wort: Seamaster. Ein Modell, von dem ich nie zuvor gehört hatte. Noch wußte ich nicht, daß dieses Wort von nun an wie die Nadel eines Kompasses in jene Richtung weisen würde, in der allmählich ein Bild meines Vaters entstehen sollte. Eine Lupe stand mir dazu nicht zur Verfügung, und so würde dieser Prozeß sehr viel länger dauern als die Entzifferung des Wortes.
Eine Übersetzung für Seamaster fand ich in keinem Wörterbuch, auch später konnte mir niemand erklären, was es eigentlich bedeuten sollte. Hatte man dieses Modell nur deshalb so benannt, weil man damit tiefer tauchen konnte als mit allen anderen wasserdichten Uhren, die es schon gab? Wahrscheinlich war eine buchstäbliche Deutung gar nicht angestrebt worden, im Gegenteil, die Erfinder dieses Wortes hatten sich offenbar darum bemüht, ein geeignetes Sprungbrett für die Fantasie der Käufer zu schaffen. Mein Vater Seamaster, dachte ich manchmal, Herrscher über ein Meer von Andeutungen und Wunschbildern.
Die Armbanduhr meines Vaters wirkte auf mich so anziehend, daß ich mir kaum vorstellen konnte, sie sei wertlos. Ich hatte keine Ahnung, zu welchen Preisen alte Uhren gehandelt wurden, ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Wert alter Uhren.
Bei den hellen Einlassungen der dünnen Stunden- und Minutenzeiger mußte es sich um leuchtende Radiumeinlagen handeln, etwas, was zwanzig Jahre später als gesundheitsgefährdend galt und deshalb nicht mehr hergestellt wurde.
Ein weiterer Blick durch die Lupe ließ mich einzelne Härchen auf dem Handrücken meines Vaters erkennen. Seine Hand und was vom Handgelenk zu sehen war, hatte große Ähnlichkeit mit meiner Hand und meinem Handgelenk. Das Handgelenk war schmal, die Uhr aber verdeckte es fast. Ich empfand so etwas wie Stolz, daß dieses Detail auf mich übergegangen war. Nun war es Teil meiner selbst und zugleich eine nachgezeichnete Spur. Ich blickte auf meine Hand, auf der noch keine Härchen wuchsen, und dann auf seine Hand, und plötzlich hatte ich das Gefühl, als lege sich seine Hand auf meine. Ich spürte einen sanften Druck. Ich wußte, es war Einbildung, aber die Einbildung war nicht weniger stark als eine wirkliche Berührung. Ich beugte mich hinunter, legte meine Wange auf das kalte Glas und wartete, bis es sich erwärmte. Dann richtete ich mich wieder auf.