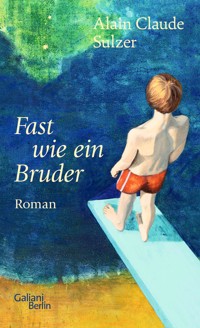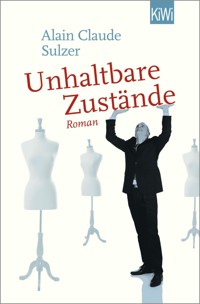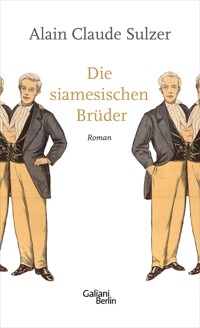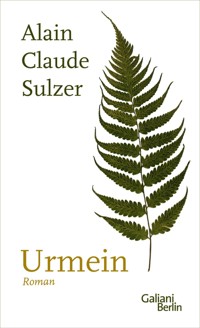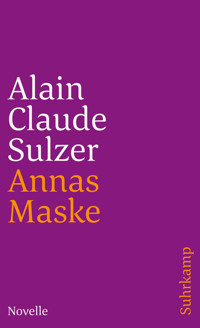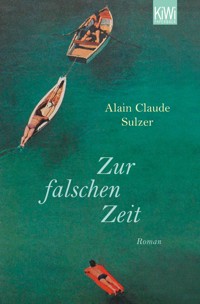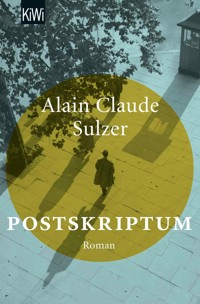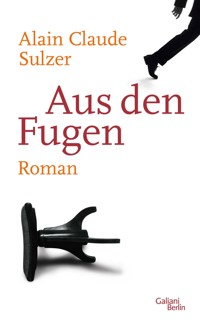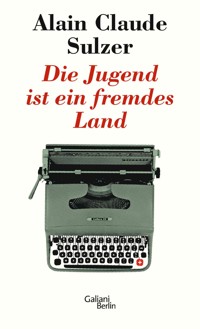
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anrührend, zuweilen urkomisch und manchmal abgründig traurig beschreibt Alain Claude Sulzer eine ganz normale Jugend in einem ganz normalen Vorort. Ein Erinnerungsmosaik der 60er- und 70er-Jahre, bei dem Nostalgie und stilles Grauen nah beieinanderstehen. Tatort: Riehen. Ein Vorort von Basel nahe der deutschen Grenze. Eine Welt der zugezogenen Gardinen, in der niemand geschieden ist und Frauen, die Auto fahren, eine anrüchige Sensation. Hier wächst Alain Claude Sulzer auf, als einer von drei Söhnen einer französischsprachigen Mutter, die kaum Deutsch kann (und es zeitlebens nie lernen wird), und eines Vaters, dessen ganzer Stolz das formstrenge Avantgarde-Haus ist, das es bis in eine angesehene Architekturzeitschrift schafft. Dumm nur, dass das Flachdach nie richtig dicht ist und die Rest-Familie dem Clou der Inneneinrichtung, den schwarz-weißen Tapeten und schwarzen Spannteppichen, wenig abgewinnen kann. In kurzen Erinnerungsblitzen erzählt Sulzer seine Jugend. Seine so komischen wie unbarmherzig detailscharfen Beobachtungen bilden zusammen ein Erinnerungsmosaik, das es in sich hat: Da ist der Ballettunterricht, bei dem Alain einer der wenigen Jungen ist und aus dem er entfernt wird, als das Gerücht aufkommt, der russische Choreograf habe ein Auge auf ihn geworfen; oder Fräulein Zihlmann, die sich von Alains Vater gern zur Arbeit in die Stadt mitnehmen lässt – und dafür von der Mutter mit stillem Hass verfolgt und am Ende erfolgreich vertrieben wird; und schließlich die Ausflüge in die verheißungsvoll-zwielichtige Welt des Theaters und die gescheiterte Flucht nach Paris. »Kein Roman, keine Autobiographie, aber hinreißende Erinnerungen an Buckeliturnen, schaumbedeckte Tänzer und die Wirkung von Haferflocken auf den Sexualtrieb. Zum Glück wurde Alain Claude Sulzer dann doch nicht Papst, sondern sogar Schriftsteller. Fameux!« Harald Schmidt »Die Vergangenheit ist ein fremdes Land, dort gelten andere Regeln.« J. P. Hartley
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alain Claude Sulzer
Die Jugend ist ein fremdes Land
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alain Claude Sulzer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alain Claude Sulzer
Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt die Bestseller Zur falschen Zeit, Aus den Fugen und Postskriptum (2015). Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Prix Médicis étranger, den Hermann-Hesse-Preis und den Kulturpreis der Stadt Basel.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Anrührend, zuweilen urkomisch und manchmal abgründig traurig beschreibt Alain Claude Sulzer eine ganz normale Jugend in einem ganz normalen Vorort. Ein Erinnerungsmosaik der 60er- und 70er-Jahre, bei dem Nostalgie und stilles Grauen nah beieinanderstehen.
Tatort: Riehen. Ein Vorort von Basel nahe der deutschen Grenze. Eine Welt der zugezogenen Gardinen, in der niemand geschieden ist und Frauen, die Auto fahren, eine anrüchige Sensation.
Hier wächst Alain Claude Sulzer auf, als einer von drei Söhnen einer französischsprachigen Mutter, die kaum Deutsch kann (und es zeitlebens nie lernen wird), und eines Vaters, dessen ganzer Stolz das formstrenge Avantgarde-Haus ist, das es bis in eine angesehene Architekturzeitschrift schafft. Dumm nur, dass das Flachdach nie richtig dicht ist und die Rest-Familie dem Clou der Inneneinrichtung, den schwarz-weißen Tapeten und schwarzen Spannteppichen, wenig abgewinnen kann.
In kurzen Erinnerungsblitzen erzählt Sulzer seine Jugend. Seine so komischen wie unbarmherzig detailscharfen Beobachtungen bilden zusammen ein Erinnerungsmosaik, das es in sich hat: Da ist der Ballettunterricht, bei dem Alain einer der wenigen Jungen ist und aus dem er entfernt wird, als das Gerücht aufkommt, der russische Choreograf habe ein Auge auf ihn geworfen; oder Fräulein Zihlmann, die sich von Alains Vater gern zur Arbeit in die Stadt mitnehmen lässt – und dafür von der Mutter mit stillem Hass verfolgt und am Ende erfolgreich vertrieben wird; und schließlich die Ausflüge in die verheißungsvoll-zwielichtige Welt des Theaters und die gescheiterte Flucht nach Paris.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © Associazione Archivio Storico Olivetti
ISBN978-3-462-31745-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Mein portugiesischer Vater
Hochzeit im engsten Kreis
Szene auf dem Bauernhof
Bauernhof
Schwarze Tapeten
Sofa I
Charles’ Schnecken
Beromünster
Samstag
Willisauer Ringlein
Hinauf und hinüber
Frau Barth
S-I-W
Theater mit Fee
Danseur étoile
Formen des Schwebens
Die Spinnuhr
Enttäuschte Erwartung
Schulschriftsteller
Frau Überwasser singt
Schwule Friseure
Afrika!
Parterre und erster Stock
Freilicht und Weihrauch
Fräulein Zihlmann
Sommer auf dem Land in Domdidier
Der Graf und das Plumpsklo
Märchen aus aller Welt
Nackt und aufgeklärt
Die Schaufensterfrauen
Rache kühlen
Schulschönschrift
Silva
Luftschutz und Verbleib
Der Durchlass
Weit entfernte Namen, Welten
Das winzige Kind
Schwimmen, dann tauchen
Leere Drohung
Geistliches
Austräger für Medizin und Fleischwaren
1969
Solistendusche
Der Flügel
1971, der Schlüssel zur Wohnung
Mein Ich ist ein Puzzle
Die neue Haut
Bücher
Gin Olivetti
Weder noch
Zum Text
Für Daniel
The past is a foreign country
L.P. Hartley
Mein portugiesischer Vater
Ende der Vierzigerjahre lernten sich meine Eltern in der Nervenheilanstalt Münchenbuchsee kennen. Mein Vater war Patient, meine Mutter Krankenschwester. Den Namen des leitenden Arztes, den ich lange Zeit für den Eigentümer der Klinik hielt, habe ich im Lauf meiner Kindheit, so glaube ich mich zu erinnern, fast täglich gehört. Le Docteur Plattner – meine Mutter sprach nur Französisch – war der Arzt meines Vaters und der Vorgesetzte meiner Mutter gewesen.[1]
Kurz nach dem Krieg hatten sich meine Mutter und eine ihrer fünf Schwestern als Krankenpflegerinnen in Portugal aufgehalten. In Coimbra, so erzählte sie, war sie verlobt. Doch die Verlobung wurde aufgelöst. Sie erzählte nie warum, und niemand fragte je danach. Ich wurde Schweizer.
Wäre ich in Portugal aufgewachsen, hätte ich mich, so dachte ich, nur unwesentlich von dem unterschieden, der ich jetzt war. Nur dass ich in einem warmen Klima aufgewachsen wäre. In Portugal hatte ich ältere Schwestern und eine mondäne Großmutter, die sich in weiße Spitze kleidete, einen Großvater, der stets Krawatten trug, und eitle Tanten, die eine Opernloge auf Lebenszeit gemietet hatten. Mein portugiesischer Vater stand mitten im Leben und war nicht auf die Hilfe von undurchschaubaren Ärzten angewiesen. Anders als mein wirklicher Vater wäre mein portugiesischer Vater, dessen Namen ich nie erfahren habe, nicht mit fünfzig pensioniert worden. Er wäre ein erfolgreicher Geschäftsmann aus gutem Haus gewesen, das enge Beziehungen zur Familie des Diktators António de Salazar unterhielt, ein Mann, der, anders als mein Vater, niemals aufgab. In ihren letzten Lebensjahren erwähnte ihn meine Mutter kaum noch.
Ich hätte niemals Deutsch gelernt.
Bücher hätte ich als Portugiese wohl nie geschrieben.
Ich wäre in die Fußstapfen meines portugiesischen Vaters getreten und hätte meine Gene großzügig weitergegeben.
Dass der erste Verlobte meiner Mutter zur Gewalttätigkeit neigte, erfuhr ich erst nach ihrem Tod. Deshalb verließ sie ihn und kehrte in die Schweiz zurück. Wie weit er ging, weiß ich so wenig wie ich seinen Namen kenne.
Hochzeit im engsten Kreis
Anwesend waren das Brautpaar, der Priester und die beiden Trauzeugen, sonst niemand. Keine Familienmitglieder, keine Freunde oder Freundinnen, weder Kollegen noch Kolleginnen aus dem Lehrerseminar oder der Schwesternschule. Meine Mutter war katholisch, mein Vater protestantisch. Meine Mutter stammte aus der Romandie, mein Vater aus der deutschen Schweiz. Da Religion in ihrem Leben keine wichtige Rolle spielte, kamen sie schnell überein, katholisch zu heiraten, die Kinder katholisch zu erziehen und ihnen französische Vornamen zu geben. Katholisch und französisch waren lange Zeit für mich eins.
Der Hochzeitstag wies den Weg in die lebenslängliche Abschottung. Die Trauung fand in Zofingen statt, wo sie niemanden kannten. Nach der Zeremonie gingen die jungen Eheleute mit dem Priester und den Trauzeugen essen. Als einzige Bewohner eines einsamen Planeten waren sie niemandem etwas schuldig. So sollte es auch in Zukunft bleiben. Der Tag ihrer Eheschließung ging nicht in die Familienerinnerungen ein. Auswärts essen gehen kam fortan so gut wie nicht mehr vor. Ich bin sicher, dass meine Mutter ein Leben lang wusste, was bei ihrem Hochzeitsessen nebst der Maggiflasche und der Cenovis-Streuwürze auf den Tisch kam.
Meine Eltern verspürten offenbar schon früh den Drang, sich vor den Augen ihrer Mitwelt unsichtbar zu machen. Ein Versteckspiel, das im Großen und Ganzen erfolgreich war – wenn man es als Erfolg betrachtet, von den anderen nicht wahrgenommen zu werden, obwohl man nichts zu verbergen hat.
Ihr einziges Geheimnis teilten sie mit vielen: Ihre Heirat erfolgte unfreiwillig. Die Verlobte war schwanger. Das Missgeschick hätte man verhindern können. Kondome gab es seit fast hundert Jahren, und ihre Reißfestigkeit ließ wenig zu wünschen übrig, seitdem zu ihrer Herstellung Latex verwendet wurde.
Zu welchem Zeitpunkt mein Großvater mütterlicherseits, ein wiederverheirateter Witwer, dessen erste Frau jung gestorben war, und meine Großeltern väterlicherseits von der Heirat erfuhren, weiß ich nicht. Vielleicht fand sie nicht heimlich, sondern lediglich in ihrer Abwesenheit statt. Möglicherweise waren sie unterrichtet, aber nicht eingeladen. Da man nur ungern reiste, dachte niemand daran, die Strapazen eines so weiten Wegs auf sich zu nehmen. Strecken, die man heute in weniger als einer Stunde zurücklegt, nahmen damals halbe Tage in Anspruch und waren beschwerlich. Als wolle man der Sache keine allzu große Bedeutung beimessen, verzichteten meine zukünftigen Eltern auf alles, was den Hochzeitstag für andere zum schönsten Tag des Lebens machte. Sie brachten die Sache formlos hinter sich und gingen danach gleich zur Tagesordnung über, was meiner unsentimentalen Mutter gewiss entgegenkam.
Szene auf dem Bauernhof
Meine Mutter hätte meinen Vater nicht geheiratet, wenn sich die Szene, deren unfreiwillige Zeugin sie wurde, vor ihrer Hochzeit abgespielt hätte. Als sie zufällig die Küche des Bauernhauses betrat, in dem das junge Ehepaar kurz nach der Hochzeit vorübergehend wohnte, lag mein Vater vor seiner Mutter auf dem Bauch und trommelte mit den Fäusten auf den Boden. Dass mit meinem Vater etwas nicht in Ordnung war, wusste meine Mutter natürlich, schließlich hatte sie ihn in Münchenbuchsee kennengelernt – doch dieser Paroxysmus war schockierend. Zeitlebens war ihr Verhältnis zu ihrem Mann und seiner Mutter von diesem unerwarteten, ebenso peinlichen wie peinigenden Ereignis geprägt. Die Ursache seines Rückfalls in die Kindheit ist mir nicht bekannt.
Auf geheimnisvolle Weise war mein Vater an seine Mutter Fanny gefesselt, die die Angewohnheit hatte, an der Tür zum Schlafzimmer der Frischvermählten zu lauschen und durchs Schlüsselloch zu spähen. So jedenfalls erzählte es meine Mutter, und ich habe keinen Grund, an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Die zwanghafte Neugierde ihrer Schwiegermutter bekamen später auch wir Kinder zu spüren.
Fanny Schultheiss war die zweite Ehefrau meines Großvaters Jakob Sulzer. Auch ihm, wie dem Vater meiner Mutter, war die erste Frau gestorben, sie im Kindbett, die andere an den Spätfolgen der Spanischen Grippe. Mit der ersten Frau zeugte Jakob zwei Söhne, die er seinem Sohn aus zweiter Ehe stets vorzog. Sie schlugen ganz nach seiner Art, sahen ihm ähnlich, waren stämmig und braun gebrannt und hatten große, gesunde Gebisse, mit denen sie sicher leicht Nüsse knacken konnten. Mein Großvater vererbte ihnen alles, Max, sein dritter Sohn aus zweiter Ehe, erbte ein paar wertlose Grundstücke, auf denen man Kartoffeln pflanzen konnte.
Mein Vater glich weder seiner Mutter noch seinem Vater, der seine Frau bei Tisch, vor den Knechten, vor den Mägden und vor den Söhnen regelmäßig demütigte; es bereitete ihm Vergnügen sich über sie lustig zu machen. Er lachte herzhaft. Die anderen lachten auch. Wehrlos ließ sie den Spott über sich ergehen. Sie verzog den Mund und schwieg. Außer ihrem Sohn nahm sie wohl keiner ernst.
Bauernhof
Man setzt mich auf ein Pferd. Es ist das erste und letzte Mal, dass ich so hoch auf einem Tier sitze. Die Kartoffeln kochen in einem riesigen Kessel, unter dem ein Feuer brennt. Wenn sie abgekühlt sind, werden sie an die Schweine verfüttert. Ich erkenne den Unterschied zwischen den Kartoffeln, die die Schweine essen und denen, die wir essen, nicht. Ich erinnere mich an die Pferde, eines hieß Max wie mein Vater, aber an die Schweine erinnere ich mich nicht, sie hatten bestimmt keine Namen. Hingegen erinnere ich mich an die Schweine eines Onkels, der eine Schweinefarm in Frankreich betrieb und später bei einem Autounfall umkam. Das war im Wallis. Er war Schweizer, nicht Franzose.
Zurück zu meinem Großvater: Ich erinnere mich auch nicht an die Kühe, obwohl mein Großvater Milchbauer war. Paul Sachers Vater[2], der in der Nähe wohnte, kam – korrekt gekleidet im dunklen Anzug – täglich mit dem Milchkännchen vorbei und holte Milch. Er war sehr höflich, erzählte meine Mutter.
Ich erinnere mich vage an Hühner und Kaninchen, aber nicht an die Arbeiten, die auf dem Hof und auf den umliegenden Feldern verrichtet wurden. Wir stiegen auf Leitern und machten uns mit Kirschen, die wir pflücken mussten, die Hände rot und klebrig. Ich mochte keine Kirschkonfitüre, keine eingemachten Kirschen, sehr gerne aber Kirschen frisch vom Baum.
Schwarze Tapeten
Ich habe in den letzten vierzig Jahren unzählige Wohnungen und Hotelzimmer gesehen, doch nie ist mir ein schwarzer Spannteppich begegnet. Auch an schwarz-weiße Tapeten kann ich mich nicht erinnern. Bei uns zu Hause gab es beides.
Der ganze Stolz meines Vaters war sein Haus, das aufgrund seiner avancierten Vorstellungen und nach zahlreichen Gesprächen mit den Architekten in Riehen geplant und gebaut worden war. Drei Jahre nach meiner Geburt zogen wir vom Lachenweg in die Schlossgasse; von einer Wohnung in ein Haus. Es stand in derselben Straße wie das Geburtshaus meines Vaters, der Bauernhof.
An die Jahre davor, an das Mietshaus am Lachenweg und an die anderen Mieter, deren Namen mich durch Kindheit und Jugend begleiteten, habe ich keinerlei Erinnerung. Oft sprach meine Mutter später noch von Frau Rebholz, die als Person jedoch unsichtbar blieb. Nach dem Umzug pflegten die beiden Frauen keinen regelmäßigen Umgang mehr miteinander. Nunmehr wohnte man auf verschiedenen Kontinenten und begegnete sich höchstens zufällig beim Einkaufen. Von Telefonaten weiß ich nichts.
Das Haus meines Vaters war nicht das Haus meiner Mutter. Sie hasste es uneingeschränkt und ließ keine Gelegenheit aus, ihre Abneigung kundzutun. Niemals habe ich sie freundlich darüber sprechen hören. Das Haus war ein Feind, der sich gegen sie verschworen hatte. Täglich konfrontierte er sie mit neuen Herausforderungen. Mein Vater verteidigte es, solange er lebte; meine Mutter hat ihm die Freude daran ebenso lang zu verderben gesucht. Das fing beim Flachdach an und endete bei den verschraubten Doppelfenstern, die sich nur unter großem Aufwand putzen ließen. Meine Mutter hatte sich ein Walmdach gewünscht, wie sie es von zu Hause gewöhnt war, aber das kam gar nicht infrage. Zu Hause war Domdidier, ein Dorf in der Romandie, in dem vergnügtere und gesprächigere Leute als in Riehen oder Basel lebten, wo man sich zurückhaltend und wortkarg gab (von Onkel Karl einmal abgesehen, einem echten Burckhardt, der zur Gattung der Käuze gehörte).
Ein Walmdach aber entsprach der Auffassung modernen Bauens von Rasser & Vadi ganz und gar nicht. Die beiden Architekten, die ohne Vornamen als zwillingshaftes, abstoßendes Gebilde in den von meiner Mutter verwalteten Teil der Familiengeschichte eingingen, genossen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren über Basel hinaus einen gewissen Ruf, weil sie im zoologischen Garten die Häuser für die Raubtiere und Nashörner sowie das damals größte Freibad der Schweiz gebaut hatten; dass Max Frisch in der Jury für das St.-Jakob-Bad gesessen hatte, war für meine Mutter ein Grund mehr, ihn zu verachten.[3] Rasser hieß Max wie mein Vater; einen gewöhnlicheren Vornamen konnte man sich kaum vorstellen. Vadis Vorname hingegen hatte einen erotischen Klang, den er in meinen Ohren bis heute nicht verloren hat: Tibère. Die Literatur kennt diesen Namen nur in der Geschichte. Der Alltag musste auf Vadi warten, bis er ihm einen gallisierten Tiberius schenkte.
Welche Rolle Vadis Vorname bei der Abneigung meiner Mutter gegen ihn spielte, weiß ich nicht. Sie behauptete immer, ich hätte mich in ihren Röcken versteckt, wenn er kam. Kam er allein? Ich glaube mich an einen attraktiven Mann zu erinnern, der tagsüber erschien, wenn mein Vater abwesend war. Täuscht die Erinnerung? Unterscheidet ein Kind, das sich vor ihnen fürchtet, zwischen gut aussehenden und hässlichen Menschen?
Dass das Flachdach jahrzehntelang Schwierigkeiten machte, war im wahrsten Sinn des Wortes Wasser auf die Mühle der nicht enden wollenden Klagen und Beanstandungen meiner Mutter, denn dieses Dach war alles Mögliche, nur nicht dicht oder jedenfalls nicht dauerhaft. Als ob nicht schon seit Jahrzehnten weltweit – und nicht nur in Weltteilen, in denen es kaum jemals regnete – Flachdächer gebaut worden wären, waren im Falle meines Elternhauses immer neue und kostspielige Reparaturen nötig, bis es endlich tat, was es tun sollte: ein Dach über unserem Kopf zu sein, das uns vor den Unbilden der Natur schützte.
Und dann der Wohnzimmerteppich. Er war hart und widerständig wie Rosshaar, was wir Kinder, die wir beim Spielen ständig mit unseren bloßen Händen, Knien und Füßen damit auf Tuchfühlung waren, zu spüren bekamen. Was meine Mutter störte, war nicht seine Textur, sondern die Farbe: tiefes Schwarz. Dem geübten Auge der Hausfrau entging kein Faden, kein Papierfitzelchen, kein Staubkorn, kein noch so winziges Blütenblatt und schon gar nicht der kleinste Schuhdreckkrümel – nur tote Stubenfliegen mit ausgerissenen Flügeln hatten eine Chance, unentdeckt zu bleiben. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Teppich eines Tages, viele Jahre nach dem Bezug des Hauses, auf nicht nachlassendes Drängen und Nörgeln meiner Mutter hin, durch einen rustikalen, jeder modernen Ästhetik Hohn sprechenden roten Klinkerboden ersetzt wurde. Die Zeit der Experimente war endgültig vorbei. Nun ging es darum, die besten Reinigungs- und Pflegemittel zu finden, die dem neuen Boden jenen Glanz verliehen, den er nie mehr verlieren sollte.
Nicht viel länger überlebte die gemusterte Tapete in den beiden Kinderzimmern im zweiten Stock; da man mit meinem jüngeren Bruder nicht gerechnet hatte, gab es lediglich zwei Zimmer für den Nachwuchs. Die schwarzen Formen auf weißem Grund zu beschreiben, fehlt es mir leider an Worten; besser wäre, ich würde das widersprüchliche Muster zeichnen; ich glaube, ich könnte es, obwohl meine bildnerischen Fähigkeiten beschränkt sind.
Ich sehe das Muster deutlich vor mir: nierenförmig, verschlungen, unregelmäßig, gewiss eine Herausforderung für die Tapezierer, die auf die korrekten Anschlüsse zu achten hatten. Doch die Tapeten verschwanden eines Tages wie ihr großer Bruder, der schwarze Teppich. War ich da schon ausgezogen? Ich erinnere mich nicht. In meiner Erinnerung sind sie so präsent, als hätte man sie nie durch planes Weiß ersetzt. Genauso wie die massiven Schiebetüren, die ich liebte, auch wenn sie ständig quietschend in den Schienen klemmten.
Nachdem das Schwarz aus unserem täglichen Leben verbannt war, konnten Orange und Rot, die Lieblingsfarben meiner Mutter, im Hause Einzug halten: als Lampenstoffbespannung, als Lampensockelfarbe und Kissenstoff; der schreiende Grundton der Deckentapete im Schlafzimmer meiner Eltern aber war gelb: psychedelische Sonnen, die über den Köpfen der Schlafenden rotierten. Auch dann noch, als mein geistig verwirrter greiser Vater meiner Mutter gestand, dass es nur eines gebe, was er bereue, in seinem Leben verpasst zu haben: dass er nie mit einer Frau geschlafen habe.
Orange stach Schwarz aus und überlebte, auch meinen Vater, dessen Haus im Lauf der Jahre und Jahrzehnte so gründlich verändert worden war, dass es schließlich – zumindest innen – kaum noch Ähnlichkeit mit jenem Haus hatte, das einst in der Architekturzeitschrift Werk[4] als Paradebeispiel moderner Baukunst an prominenter Stelle vorgestellt wurde. Überlebt hat das Flachdach. Als es endlich wasserdicht war, vergaß man es. Es war ja unsichtbar.
Sofa I
Wir besaßen kein Sofa, keinen Fernseher, keine Hollywoodschaukel, kein Schwimmbecken, auch keinen Gemüsegarten und kein Klavier, lauter Dinge, die ich mir wünschte. Es gab triftige finanzielle Gründe, auf eine Hollywoodschaukel, einen Pool oder ein Klavier zu verzichten. Warum aber kein Sofa?
Das Haus war groß genug dafür. Das Haus war nach den ästhetischen Maßgaben jener Jahre gebaut worden. Das Haus, in dem, anders als bei meinen Schulfreunden, die seltsamen Möbel bedeutender Designer standen, hätte ein Sofa sehr gut vertragen.
Statt eines Sofas gab es eine unerbittlich harte Liege, eine Couch, wie wir sie nannten. Man ruhte darauf nicht bequem, sondern saß steif und aufrecht. Die Zeiten behaglichen Entspannens waren nicht nur in meinem Elternhaus noch längst nicht angebrochen. Jeder war gehalten, mit durchgedrücktem Rücken bolzengerade an seinem Platz zu sitzen. Wer abrutschte oder gar die Füße auf den Couchtisch stellte, wie die Amerikaner das taten (so hörte man), wurde umgehend zurechtgewiesen. Worte wie kuschelig oder gemütlich waren Fremdworte, nicht nur, weil wir mit unserer Mutter Französisch sprachen. In ihrer Sprache gab es keine Entsprechungen für diese hedonistischen Vokabeln. Hier war alles, was sich aus der unübersichtlichen Masse der Konvention hervorhob: fameux.
Einen Fernseher zu besitzen, war lange Zeit unserer Großmutter vorbehalten, was ihr, wenn auch nicht die Zuneigung, so doch die regelmäßige Gegenwart ihrer Enkel sicherte. Wir besuchten nicht sie, sondern den dunklen Kasten mit dem grünlichen Bildschirm, auf dem sich uns die Welt eröffnete: ein Philips. Schlau wie sie sich wähnte, nutzte sie die Gelegenheit, um uns auszuhorchen, während wir vom Geschehen auf dem Schirm abgelenkt waren. Sie schien – wie wir glaubten – nicht einmal zu ahnen, dass wir stets auf der Hut vor ihren bohrenden Fragen waren, die nur auf eines zielten: Sie wollte wissen, wie es bei uns zu Hause wirklich zuging. Doch wir waren gewieft und geübt. Uns entlockte man so leicht nichts, und so musste sie sich mit den trockenen und wenig ergiebigen Brocken begnügen, die wir ihr hinwarfen, während wir gebannt auf den Fernseher starrten, den unsere Tanten Sophie und Klara (Klärli), die in China geboren waren und einige Jahre in den USA gelebt hatten, weltgewandt Tiwi nannten. Während sie in Häusern gedient hatten, vor denen blinkende Weihnachtsmänner in Schlitten saßen, die von Rentieren gezogen wurden, wartete man bei uns noch auf den Nikolaus.
Ich war etwa vierzehn, als meine Eltern sich endlich entschlossen, einen Fernseher zu mieten. Bevor sie ihn kauften, wollten sie die Wirkung auf unser Befinden auf die Probe stellen. Warum der Fernseher – ein Philips – den Test bestand, weiß ich nicht, denn wir wurden auf der Stelle süchtig. Wir wollten immer fernsehen.
Als meine Eltern, was selten genug vorkam, am ersten Abend unseres neuen Lebens ausgingen, schlossen sie die Wohnzimmertür ab, was uns aber nicht daran hinderte, heimlich fernzusehen. Mein älterer Bruder und ich verschafften uns Zugang durch den passe, wie wir die Durchreiche nannten.
Als Nächstes kauften meine Eltern dann endlich doch ein Sofa. Es war gemütlich, aus grauem Leder, aber noch etwas hart. Es musste eingesessen werden. Nirgendwo schlief ich schneller ein, besonders aber, wenn der Fernseher lief.
Charles’ Schnecken
Man konnte sich noch so sehr über seine abstehenden Ohren lustig machen, sie nahmen ihm nichts von seiner Majestät. Und weil er ein Prinz war, aß er, was auf den Tisch kam. Ein Vorbild für alle, schluckte er ohne zu klagen – sogar Schnecken. Das jedenfalls behauptete meine Mutter, wenn wir uns am Tisch wie die Schweine aufführten. Während die englische Königin, wie ich mit Genugtuung las, nur Salatherzen aß – Genugtuung deshalb, weil das meiner sparsamen Mutter gewiss nicht behagte –, beschwerte sich Charles nicht einmal dann, wenn der Salat, den man ihm vorsetzte, in der Palastküche nicht ordentlich geputzt worden war und man dabei eine Schnecke übersehen hatte. Prinzlich erzogen, wie er war, wäre es ihm, anders als uns, niemals eingefallen, sich bei seiner Mutter, der Königin, zu beschweren oder gar – begleitet von vielen »Iiis« und »Uääss« – laut am Tisch aufzubegehren. Wenn er auch nicht besonders hübsch war, Manieren hatte er, er tat keinen Mucks, wenn er mit seiner goldenen Gabel auf eine Schnecke stieß. Entweder aß er sie stillschweigend oder schob sie, als sei nichts gewesen, wortlos an den Rand des Tellers.
Später fragte ich mich, inwiefern es an den Schnecken in Charles’ Salat lag, dass sich der Prince of Wales in vorgerücktem Alter mit solcher Leidenschaft der Biogärtnerei und dem Kompostieren widmete. Er besitzt, wie man hört, einige Fertigkeit darin, die Erde mit dem kupfernen Sauzahn aufzulockern, nicht mit dem Spaten, was den sicheren Tod für die nach oben beförderten Insekten bedeuten würde. Gewiss begegnet er dann auch der einen oder anderen Schnecke und verflucht womöglich insgeheim seine gekrönte Mutter mit all ihren farbigen Handtaschen und bunten Hüten dafür, dass er als Kind nie protestieren durfte. Ich an seiner Stelle hätte den Koch gefeuert, der die Schnecke im Salat übersah. Ich, als zukünftiger König von England, hätte den Teller mit Getöse auf den Boden geworfen. Kein Wunder, sage ich mir heute, dass der arme Charles noch immer Prinz ist und wohl niemals König werden wird. Zu viel Rücksichtnahme musste dazu führen. Diana aß keine Schnecken, davon bin ich überzeugt. Die Tatsache, dass sie ihren Gemahl aber dabei beobachtet haben könnte, wirft ein neues Licht auf ihre Bulimie.
Beromünster
Eines Tages werde ich vielleicht ein Buch schreiben, dessen Titel heute schon feststeht, obwohl noch keine Zeile davon geschrieben wurde. Das Buch wird Beromünster heißen.
Aufgrund des Titels wird kaum noch jemand wissen, worum es geht. Beromünster? Ein Aufflackern der Erinnerung bei älteren Schweizern, Verständnislosigkeit bei den anderen. Früher wäre das anders gewesen.
Im Althochdeutschen heißt »Bero« Braunbär, bei den alten Germanen war das die Bezeichnung für den Sippenältesten; für den, der alles bestimmte. Von beiden Begriffen ist Beromünster weit entfernt, obwohl sich der Name dieses Orts, der im Kanton Luzern liegt, vermutlich aus einer dieser Bedeutungen – vielleicht aus beiden – herleitet. Doch wer vor fünfzig, sechzig Jahren Beromünster erwähnte, sprach nicht von einem Ort mit etymologisch unsicheren Ursprüngen, sondern von einer Institution, deren Bedeutung so groß und bedeutsam war wie ein Sendeturm. Das war zu einer Zeit, als das Radio seine Macht und seinen Einfluss noch uneingeschränkt geltend machen konnte.
Eines Tages werde ich vielleicht ausführlicher auf die außerordentliche Bedeutung des Landessenders Beromünster zwischen 1933 und 1945 zurückkommen, dessen Antenne übrigens nicht in Beromünster, sondern in Gunzwil stand.[5] Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, die mit jedem Tag, den der Zweite Weltkrieg dauerte, größer wurde, da von hier aus Nachrichten über den tatsächlichen Kriegsverlauf in alle Welt hinausgingen, und die immer öfter den Meldungen widersprachen, die der deutsche Reichsrundfunk sendete.
Dass ein »Landessender« nicht den Namen des Landes oder der Stadt trug, aus der er sendete, war damals, als die Stationen durchweg Hilversum, Schwerin oder Budapest, nicht etwa Radio 24 oder big FM