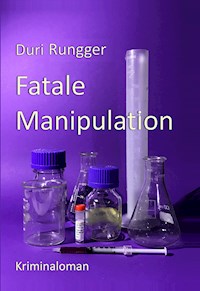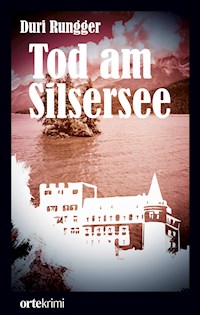6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Vorwiegend vergnügliche Anekdoten aus einem bunten Leben in Graubünden, Zürich, Neapel, Genf und Aarau. Reisen in viele Länder, vor allem Ägypten und Schwarzafrika. Wissenschaftliche Forschung in Europa und Amerika, Betrug im Umfeld und Verwicklung in Geheimdienstaffäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Duri Rungger
Pralinen und saure Gurken
Schwerelose memoiren
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kinderjahre
Doppelleben
Mittelschule
Kulturleben
Ferien
Militärdienst
Uni Zürich
Studentenreisen
Ägypten
Mexiko
Bella Napoli
Tauchen
Doktorat
Genf
Forschung
Fälschungen
Safari
Nigeria und Gabun
Zaire
Kongo Brazzaville
USA Mexico
Malaria
Geheimdienst
Pensionierung
Begleitwort
Autor
Impressum neobooks
Kinderjahre
Nina Theus und Hans Rungger nach der Verlobung
«Ein Bube? Wie schade!» Mit dieser Bemerkung nahm mein Papa die Nachricht meiner Geburt auf, mit der ihn Tante Lena aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich war Punkt Mitternacht in Chur zur Welt gekommen. Es war damals nicht üblich, dass die Väter der Geburt beiwohnten und das Pflegepersonal im Krankenhaus aus der Ruhe brachten. Ich habe nie zu spüren bekommen, dass Papa lieber ein Mädchen gehabt hätte.
Meine frühsten Erinnerungen stammen aus der Zeit, als wir noch in Domat Ems wohnten und ich somit kaum zwei Jahre zählte. Ich sass als fetter Brocken auf einer Decke im Hinterhof des Hauses. Mama hängte die Wäsche zum Trocknen auf. Plötzlich stand nahe vor mir eine Ziege und schaute mir ins Gesicht. Ich sehe noch heute die hellen Augen mit den waagrechten Pupillen, die mich musterten.
Etwa zur gleichen Zeit wurde im stockkatholischen Dorf Fronleichnam gefeiert. Die Strassen, durch welche die Prozession zog, waren mit Heu bestreut. Die Cumpania da Mats paradierte in ihren alten französischen Uniformen und schoss vor und manchmal auch in der Kirche Salven in die Luft. Als Reformierter war Papa zu Hause geblieben und hütete den Sonntagsbraten und mich. Ich lag bäuchlings auf dem Fensterbrett der Küche, Papa über mich gebeugt, und wir bewunderten den Umzug mit Musik, Fahnen, Weihrauch und Weihwasser. Plötzlich stieg schwarzer Rauch über uns ins Freie. Der Braten war verkohlt.
Corsin und ich
Kurz darauf übernahm Papa eine Stelle als Forstingenieur beim Kanton, und wir zogen nach Chur an den Fridauweg. Wir spielten im Nachbargarten Verstecken und Fussball, oder sahen dem Betrieb im Rangierbahnhof zu. Ausser häufigen Halsschmerzen war ich gesund, nur die wilden Blattern und der Mumps blieben mir nicht erspart. An einem Nikolausabend musste Mama zu einer Probe des Domchors, Papa war beim Männerchor und mein älterer Bruder wohl bei den Wölfen, jedenfalls war ich allein zu Hause und lag im Bett. Da öffnete sich die Tür, und ein Weihnachtsmann brachte mir Lebkuchen, Nüsse und Schokolade und plauderte mit verdächtig hoher Stimme mit mir. Als die Eltern heimkamen, erzählte ich ihnen aufgeregt, ich hätte Besuch von einem Damen-Nikolaus erhalten.
Ich kam mitten im Zweiten Weltkrieg zur Welt, bekam aber nur wenig davon mit. Wir Buben beobachteten die wenigen Flugzeuge, die Chur überflogen und versuchten herauszufinden, ob es eine deutsche, amerikanische oder Schweizer Maschine war. Corsin erklärte mir, woran man sie erkennen konnte. Einmal sahen wir einen amerikanischen Bomber, der von einem Schweizer Abfangjäger verfolgt wurde, und hörten die Schüsse und den Aufprall, als der Eindringling über dem Dreibündenstein abgeschossen wurde. Wir hofften, dass die fremden Piloten die auf Dächern aufgemalten Schweizerkreuze bemerken und respektieren würden. Ich fragte Papa besorgt, weshalb auf unserem Dach keines aufgemalt war. Er beruhigte mich, es genüge, wenn auf einigen Häusern dieser Hinweis stehe. In Schaffhausen hat es nichts genützt. Bei Fliegeralarm mussten wir in den Keller, bis Entwarnung gegeben wurde. Das war langweilig. Im Gegensatz zu Mama hatte ich keine Angst, wohl weil ich mir nicht vorstellen konnte, was ein Bombardement bedeutete. Zufällig fand ich heraus, dass ich das Heulen der Sirenen täuschend echt nachahmen konnte, wenn ich den Hebel unserer WC-Spülung sachte auf und ab bewegte. Mama fiel prompt darauf herein und schrie: «Duri, wir müssen in den Keller!»
Zum Einschlafen löschte Papa manchmal das Licht und sagte, er würde es in 15 Minuten wieder anzünden, wenn der Zug aus dem Gotthard Tunnel ausfahre. So lange dauerte damals die Fahrt von Göschenen nach Airolo. Ich habe das Ende des Tunnels wohl nur ein oder zweimal wach erlebt. Einmal hat mich Papa aus dem Bett geholt, auf den Estrich getragen und zur Dachluke hochgehoben. «Schau da den Christbaum!» Der Himmel weit im Norden war mit hellen, an Fallschirmen hängenden Lichtern übersät. Wir hörten dumpfe Explosionen. Papa erklärte mir, dass die Alliierten Friedrichshafen bombardierten. Ich verstand nicht, was dies bedeutete, fragte mich aber, was Christbäume mit Bomben zu tun hätten. Ich verstand auch nicht, weshalb man trotz der Lebensmittelmarken den Einkauf bezahlen musste.
Einmal stolperte ich vor dem Haus und schlug mit dem Kopf auf dem Kiesweg auf. Ich ging zu Mama, um den Schaden begutachten zu lassen. Sie war gerade am Telefon, und ich stand wartend vor sie hin. Während ihres Gesprächs musterte sie mich, entdeckte einen grauen Fleck an meiner Schläfe und strich mit dem Finger leicht darüber. Der Fleck war ein Kieselstein, der in meiner Schläfe steckte und als er weggewischt wurde, schoss Blut heraus. Mama beendete das Telefon hastig und rief den Onkel Doktor an, der beruhigend bemerkte, es reiche, die Wunde zu desinfizieren und trocknen zu lassen. Das erste Loch in meinem Kopf hat keinen Schaden hinterlassen.
Nach dem Krieg verbrachten viele amerikanische Soldaten Urlaub in den Bündner Bergen. In dieser Zeit beteiligte sich Papa an der Organisation von Ferien für Kinder aus Kriegsgebieten, empfing gelegentlich Züge und nahm mich jeweils zum Bahnhof mit. Wenn gleichzeitig ein Zug mit Amis eintraf, rannte ich zu ihnen und produzierte mit durchschlagendem Erfolg den englischen Satz, den mir Papa beigebracht hatte: «Please, a little chewing gum.»
Trotz des Kriegs verlebte ich eine glückliche Kindheit. Mama war wie viele Romontschs emotional, liebevoll, spontan und manchmal auch ängstlich, was uns betraf. Papa hingegen war ein in Bern aufgewachsener Valser, bedächtig und gutmütig. Wenn Mama uns etwas verbieten wollte, von dem sie annahm, es sei zu gefährlich, sagte er, das müssten wir auch lernen.
Als ich sechs war, zogen wir in die Lauda, ein Wohnhaus am Waldrand hoch über der Stadt. Unsere Fenster im vierten Stock lagen auf gleicher Höhe wie die Kugel des Turms der Martinskirche. Die Aussicht über die Altstadt und in die umliegenden Berge war eindrücklich, vom nahen Pizokel zur Signina Gruppe, in die fernen Berge des Oberlands, auf der anderen Talseite die Brigelser Hörner und wieder nahe der Stadt, der mächtige Calanda. Das Haus lag am Waldrand, und ich verbrachte die meiste Zeit im Wald und kannte bald jeden Schleichweg. Bei der 'Nassen Platte' gab es fleischfressende Pflanzen, auf einem felsigen Vorsprung blühte Türkenbund und bei der Seminarwiese wilder Flieder, doch am liebsten waren mir die Leberblümchen.
Chur ca. 1948, Luftaufnahme, Verlag Gredinger, Chur
Ich habe einen guten Schutzengel. Einmal stand ich unentschlossen vor dem Haus und überlegte, was ich unternehmen könnte. Plötzlich hatte ich ein seltsames Gefühl und trat ohne weiteren Grund einen Schritt zur Seite. Genau zur richtigen Zeit! Ein grosser, mit einer Fichte bepflanzter Blumentopf fiel vom Balkon der Dachwohnung herunter und zerschellte genau an der Stelle, die ich verlassen hatte. Etwas weniger glimpflich verlief ein Spaziergang in Arosa. Ich wollte am Wegrand eine Blume pflücken, beugte mich vor und zog daran, doch sie sass fest im Boden. Ich verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Kopf voran auf eine Steinplatte. Mama brachte mich blutüberströmt zum nächsten Arzt, der mich zusammenflickte. Auch von diesem Unfall habe ich keinen Dachschaden davongetragen.
In der Lauda wohnten drei ältere Knaben, die bald wegzogen, und vier jüngere Mädchen und im Nachbarhaus gleich nochmals vier Mädchen. So lernte ich Hüpf- und Ballspiele, dafür mussten die Mädchen Indianer spielen. Lange hatte ich kaum Kontakt mit anderen Jungen, ausser mit meinem Bruder Corsin. Wir verbrachten ganze Tage im Wald und beobachteten Siebenschläfer, Rehe, Weinbergschnecken, Blindschleichen, Vögel, Eidechsen, Alpensalamander, Kröten, Hornissen und Ameisenlöwen. Corsin sah einmal eine Eule und konnte sogar zusehen, wie ein Sperber einen kleinen Vogel rupfte und verschlang, und ich beneidete ihn darum.
Auf einigen Bäumen bauten wir Burgen, kleine Plattformen mit Sitzen, die wir auch gegen Eindringlinge zu verteidigen suchten. Ein solches Zusammentreffen wäre beinahe fatal ausgegangen. Ich sass in der Burg 2, und als ein Knabe daherkam, sagte ich ihm, er soll verschwinden. Ganz abgesehen davon, dass er grösser war als ich, war er auch bewaffnet. Er nahm seine Schleuder und schoss mir einen Stein auf die Stirn. Mir wurde schwarz vor den Augen und ich fiel. Nach ein paar Metern muss ich wieder zu mir gekommen sein, konnte einen Ast fassen und mich vor dem Absturz retten. Der Schütze war noch mehr erschrocken als ich, entschuldigte sich ausgiebig und räumte freiwillig das Feld. Sonst ist im Wald nie etwas Schwerwiegendes vorgefallen, obwohl ich manchmal von einem Baum in den nächsten hinüberkletterte, oder mich in ein Wespennest setzte.
Manchmal verbrachten wir kurze Ferien in Disentis bei Tata, Mamas Pflegemutter. Mama war als Nina Theus in Ems geboren. Als ihre Mutter früh starb, wurde sie von einem Onkel in Disentis aufgenommen. Condrau war Mistral der Desertina, Besitzer der Stampa und Herausgeber der Gasetta Romontscha. Tata war in Frankreich aufgewachsen, wo ihre Eltern ein Pensionat für bessere Töchter in einem Schloss führten. Als sie nach Disentis heiratete, nahm sie Mobiliar mit, darunter eine Louis XV Gruppe, die Mama erbte und ihr Leben lang darinsass, obwohl sie nicht sehr bequem war. Tata war im Herzen Französin geblieben, was sich unter anderem daran zeigte, dass wir Kinder nach Belieben Senf essen durften. Meine liebste Erinnerung an Disentis ist das Geläut der Schellen und das Meckern der Ziegen, die am frühen Morgen durchs Dorf getrieben wurden. Eine Attraktion für mich war der Rappe, der die Kutsche des Hotels Disentiserhof zum Bahnhof brachte und jeweils durchbrannte, wenn ein Stück Papier auf der Strasse lag.
Gelegentlich machten vornehme Damen ihre Aufwartung bei Tata. Während des Exils in der Schweiz hatten Kaiser Karl und Kaiserin Zita die Sommer in Disentis verbracht, und ihre Besucher machten jeweils auch beim Mistral ihre Aufwartung und hielten danach über Jahrzehnte daran fest. Mama war stolz darauf, in ihrer Jugend mit den jungen Habsburgern gespielt und von der Kaiserin eine Halskette geschenkt erhalten zu haben. Umso entsetzter war sie, als ich die Besucherinnen als Frau Sowieso ansprach und die Adelstitel konsequent wegliess. Weniger keck war ich, wenn uns die alte Haushälterin Alexandra vor dem Schlafengehen Geistergeschichten erzählte. Einmal bin ich danach zu meinem Bruder ins Bett gekrochen.
Mitten in mein unbeschwertes Dasein platzte der Tag, an dem ich mich für die Schule einschreiben musste. Ich konnte bereits lesen und ein wenig rechnen und sah nicht ein, weshalb ich zur Schule gehen sollte. So versteckte ich mich im Wald. Papa kam früher heim, um mich zum bischöflichen Hof zu begleiten, wo die Einschreibung für die Hofschule stattfand. Er suchte mich lange vergebens, doch als in seiner Stimme ein zorniger Unterton mitschwang, kroch ich aus meinem Versteck und wurde schnurstracks zum Henker geführt. Wir trafen noch rechtzeitig im Büro ein und wurden von einer Ordensschwester begrüsst, die zwar freundlich tat, mich aber trotzdem zur Schule einschrieb. Silvia, eine Leidensgenossin von damals hat mir kürzlich erzählt, dass wir am ersten Schultag weinend vor der Tür standen und erst auf dringende Aufforderung hin, Hand in Hand ins Schulhaus gingen.
Mein Vorbehalt gegenüber der Schule sollte sich als berechtigt erweisen. Zumindest im ersten Schuljahr langweilte ich mich furchtbar. Zu allem Unheil wurde der Schulbeginn in Graubünden in diesem Jahr vom Frühjahr in den Herbst verschoben. Mein erstes Schuljahr dauerte deshalb ein paar Monate länger als gewöhnlich, glücklicherweise nur auf dem Papier, denn im selben Jahr fand das eidgenössische Schützenfest in Chur statt, und viele ältere Schüler wurden als Zeiger und Warner aufgeboten. Unter diesem Vorwand wurden die Sommerferien von den üblichen neun Wochen auf etwas wie drei oder vier Monate ausgedehnt. Ich glaube, ich habe nur zwei Wochen erste Klasse zu viel abgesessen.
Abends durften wir schon als Erstklässler im Nachbargarten mit Sabina, Brigitte und Käthi bis zehn Uhr Versteck spielen. Lehrer Held, der oberhalb an unserer Strasse wohnte, bemerkte zu Papa, es wäre verboten, dass Kinder so spät in der Nacht draussen seien. Papa erwiderte, dass wir in einem Privatgarten spielten und dies im Prinzip niemanden etwas angehe.
Ich war etwa acht Jahre alt, als ich das erste Mal auf den Brettern stand, die die Welt bedeuten. Das heisst, ich stand nicht, sondern lag darauf. An einem weihnächtlichen Elternabend führten die Pfadfinder unter anderem ein Krippenspiel auf. Als kleiner Knirps durfte ich bei den Proben dabei sein, und der Regisseur fand, mein blonder Lockenkopf würde sich in der Krippe hübsch ausnehmen. Ich war etwas beleidigt, nahm die Rolle des kleinen Jesus aber an, weil ich dadurch am Abend dabei sein konnte. So lag ich in der Krippe, und für die Zuschauer war nur mein Haar zu sehen. Als mein Bruder auf mich zutrat und mir ein Wiegenlied sang, bewegte ich den Kopf. Eine Frau im Publikum schrie überrascht auf: «Jesses, es ist ja lebendig.» Der Clou des Abends war eine Nummer von Yankee, der im Alleingang eine Messe zelebrierte, als Priester mit schöner Stimme, nur etwas falsch, das Kyrie sang, sich als Messediener den Hintern kratzte, als fromme Nonne ekstatisch betete und als Organist mit grossen Gesten und lautem 'Di Du Di Bromm' eine Fuge hervorzauberte und zum Schluss den priesterlichen Segen erteilte. Selbst der Bischof krümmte sich vor Lachen.
Eine aktivere Rolle spielte ich beim Puppentheater. Aus Papierschnitzeln und Fischkleister fertigten wir Köpfe an, und die Tanten nähten schöne Kleider dazu. Kasperli mit Zipfelmütze, Grossmutter mit rotem, samtenem Rock und Spitzenkragen, Hexe, Räuber, König, Prinzessin, Teufel und sogar eine Riesenschlange aus echtem, von meinem Cousin gestiftetem Python Leder bildeten das Ensemble. Corsin und ich improvisierten frei und amüsierten uns auch ohne Zuschauer. Einmal durften wir am Schulfest in einer Turnhalle voller Kinder spielen. Daneben fand auch ein Ballonwettbewerb statt. Beim herrschenden Föhn schaffte es der Gewinner bis nach Tschechien. Mein Ballon wurde von einem Langläufer im Schwarzwald gefunden. Das bedeutete den zweiten Rang. Als ich aus den Preisen etwas auswählen durfte, wählte ich anstelle eines Spielzeugs einen Cachepot für Mama aus. Ich habe es bis heute nicht fertiggebracht, ihn zu entsorgen.
Wenn unsere zwei Cousinen auf Papas Seite von Bern zu Besuch kamen, waren sie begeisterte Zuschauer beim Puppenspiel und spielten auch gern selbst. Bei einer dieser Gelegenheiten holte sie ihr Onkel Oskar, bei dem sie jeweils die Ferien verbrachten, bei uns ab. Claudia und ich gaben ihm eine improvisierte Aufführung. In einer Szene führte Claudia mit einer Hand die Prinzessin, brachte mit der anderen Hand die Hexe ins Spiel und liess die Prinzessin entsetzt ausrufen: «D'Hudere die Häx!» Der Onkel Doktor wurde rot über beide Ohren, denn die Genannte war seine Praxisgehilfin, die eifrig versuchte, ihn zu umgarnen. Wie dem auch sei, einige Monate später heiratete der Onkel die andere Assistentin, die Claudia gefiel.
Ab der vierten Klasse wurde der Unterricht interessanter und abgesehen von meiner krakeligen Schrift war ich ein guter Schüler. In der sechsten Klasse hatte ich ein Zeugnis mit lauter Sechsen, weil Lehrer Held die Note für das Schönschreiben ausgelassen hatte. Wenn ich Biografien lese von Leuten, die auch nicht älter sind als ich, wundere ich mich über Schilderungen von Lehrern mit Haselstöcken und Linealen, die Ohrfeigen austeilen und Hintern versohlen. Bei uns waren solche Missgriffe selten. Nur eine frustrierte Schwester, die ihrem Namen «Augusta», die Erhabene, nicht gerecht wurde, teilte öfter eine Tatze aus. Wie ich später von einem Betroffenen erfuhr, geschah dies in seinem Fall auf Geheiss seiner Mutter.
Die erzieherische Zurückhaltung war wohl auch darauf zurückzuführen, dass die Reaktion der Eltern heftig ausfallen konnte. Nachdem sein Sohn eine Ohrfeige eingefangen hatte, verkündete der Vater dem Lehrer vor der ganzen Klasse, das nächste Mal sei er es, der verprügelt werde. Hugo, einer meiner Mitschüler und einiges älter als wir, wusste sich selbst zu wehren. Als er eines Tages faul und lässig auf seinem Stuhl sass, forderte ihn der Lehrer auf, sich anständig hinzusetzen, doch er rührte sich nicht. Das riss ihn Maissen vom Stuhl und holte zu einer Ohrfeige aus, war aber zu langsam. Hugo verpasste ihm einen knallenden Kinnhaken und verliess das Lokal, während der Lehrer benommen dastand. Später sprach sich herum, Hugo solle von der Schule ausgeschlossen werden. Einige Eltern, auch Papa, schalteten sich ein, und die ganze Sache verlief im Sand.
Hugo war auch ein Schutzengel für mich. Manchmal gab es Scharmützel zwischen Schülern der verschiedenen Schulen. Solange wir an der Halde wohnten, ging ich nur selten in die Stadt und kannte die Animositäten zwischen den Schülern der verschiedenen Schulen nicht. So bummelte ich ahnungslos durch die Stadt, als vier Altersgenossen auf mich zukamen und drohend fragten, ob ich ein Hofschüler sei. Bevor ich antworten konnte, stoben sie auseinander und rannten fort. Ich drehte mich um, um zu sehen, ob zufällig ein Lehrer oder Polizist aufgetaucht sei, doch da stand nur Hugo lässig an eine Mauer gelehnt und sagte, dass ich immer auf ihn zählen könne.
Einmal wurde ich in der Stadt von einem älteren Knaben abgefasst, der mir eine Tracht Prügel versprach, weil ich sein Velo gestohlen und beschädigt hätte. Ich versicherte ihm, dass ich keine Ahnung hätte, wovon er redete. Darauf fragte er mich, ob ich Gregor heisse, was ich verneinte. Er war erstaunt über die Ähnlichkeit und liess mich gehen. Wie sehr ich Gregor, den ich nicht kannte, ähnlichsah, zeigte sich beim Maiensäss Umzug. Nach dem Ausflug zogen jeweils die Mädchen mit Blumenkränzen und die Buben mit grünen Ruten durch die Strassen. Plötzlich trat eine Frau zu mir, umarmte mich, und als ich zurückwich, stellte sie erstaunt fest, dass ich nicht ihr Sohn Gregor war.
Auch den bekannten Churer Originalen bin ich begegnet. Dem 'Erdbeer-Ingenieur' sagte man nach, er stehle Pflanzen aus fremden Gärten und verkaufe sie beim Nachbarn weiter. Wenn er gehänselt wurde, verfolgte er die Rangen zornentbrannt, doch wenn ich ihm im Wald traf, nahm er meinen Gruss freundlich ab. Der Organist Imhof, ein ewig in Schwarz gekleideter, hoch aufgeschossener Mann, wanderte scheinbar ziellos in der Stadt umher. Einmal sah ich, wie er beim Martinsbrunnen stehen blieb. Mit seinem langen Mantel über dem rechten Arm beugte er sich seitlich zur Brunnenröhre, um zu trinken und tauchte dabei den Mantel tief ins Wasser. Dann stelzte er eine lange Spur von Wassertropfen hinter sich lassend weiter.
Mama liess Messer oder Scheren von einem fahrenden Jenischen schleifen Einmal war kurz zuvor ein Konkurrent vorbeigekommen, und unser Mann erkundigte sich, wie dieser ausgesehen habe, und als Mama sagte, er habe ein rotes Hemd getragen, war die Sache klar: «Aha, dann war es der Zablonier, der in mein Revier eingedrungen ist. Den bringe ich um.»
Im Gegensatz zu Corsin, der gut Klavier spielte, war ich musikalisch wenig begabt, aber die Eltern fanden, es gehöre dazu, dass man ein Instrument erlerne. Da Papa früher Geige gespielt hatte und eine gute Violine eines Berner Meisters besass, fiel die Wahl schliesslich auf dieses Instrument. Ich übte wenig, und wenn ich Corsin begleiten durfte, bewunderte ich mehr seine Geduld als das musikalische Ergebnis. Dafür sang ich gern und machte beim jugendlichen Chor des Hofs mit. Eines Tages kam der Musiklehrer des Priesterseminars vorbei und lud Jürg, der Alt sang, und mich mit meiner Sopranstimme ein, die Ostermette in der Kathedrale zu singen. Wir verbrachten manche Stunde damit, die alten Choräle zu üben, und ich habe nie so viel Kuchen und Schokolade während der Fastenzeit gegessen wie im Priesterseminar. In der Ostermette füllten wir mit unseren feinen Stimmen die Kathedrale, die scheinbar über eine ausgezeichnete Akustik verfügt. Der Bischof bedankte sich bei uns, und dem Dekan des Priesterseminars gefiel unser Gesang derart, dass er uns bat, an seinem Abschiedsfest die Psalmen nochmals vorzutragen. Sonst war meine Teilnahme an religiösen Aktivitäten beschränkt. In der bischöflichen Hofschule wurden auch Ministranten für den Gottesdienst gesucht, doch mein reformierter Vater war für mich eine hinreichende Entschuldigung, mich nicht zu melden.
Mein bester Freund war Max. Anfänglich spielten wir mit seiner elektrischen Eisenbahn, später lieber Pingpong, oder machten Streiche, zündeten ein Feuer im Fussrechen des Hauses an oder stopften Zündholzköpfe in hohle Schlüssel, steckten einen Nagel hinein und brachten die Ladung zum Explodieren. Wir waren auch bei den Wölfen und später bei den Pfadfindern zusammen. Mit Max oder vielmehr unter Anleitung seiner Mutter absolvierte ich meine ersten Skiübungen in Flims.
Mit Max auf dem Maiensäss
Nach den Besuchen bei Max holte ich Papa von der Arbeit ab. Einmal bewunderte ich in der Eingangshalle des Grauen Hauses ein Modell geplanter Lawinenverbauungen an der Parsenn. Da kam Regierungsrat Bärtsch dazu und erklärte mir das Projekt. Er war bekannt dafür, dass er Knoblauch kaute und die Pfeife nicht einmal bei einer Militärparade aus dem Mund nahm. Zu Hause fragte mich Mama, weshalb ich so seltsam rieche.
Die meiste Zeit verbrachte ich immer noch im Wald und fing an, Tiere zu sammeln. Zuerst hielt ich Weinbergschnecken und als grosse Errungenschaft kam eine Blindschleiche dazu. Da ich nicht wusste, ob sie die angebotene Nahrung annahm, setzte ich sie nach ein paar Tagen wieder frei. Eine Geburtshelferkröte, die Eier am Hinterleib herumtrug, liess ich unbehelligt. An einem schwülen Tag fing ich eine Schlingnatter, die mich biss, doch ich wusste, dass bei uns Schlangen mit glatten Schuppen nicht giftig sind, und regte mich nicht auf. Während der Mittelschule ging ich an freien Nachmittagen oft auf Schlangenjagd, und brachte die Tiere meinem späteren Biologielehrer Steinmann, der sie in der Schule vorzeigte. Danach setzte ich die Tiere wieder frei. Zu meinem Vortrag über einheimische Schlangen im Terrarien Klub brachte ich eine Schlingnatter und eine Ringelnatter mit. Während ich die Ringelnatter vorzeigte, wand sie sich um meine Finger und häutete sich.
Eines Morgens lag mehr als ein Meter Neuschnee in Chur, und die Schule fiel aus. Sobald der Schneepflug das Gröbste weggeräumt hatte, gingen wir Schlitteln. Die Kantonsstrassen zur Lenzerheide und nach Arosa wurden noch nicht schwarz gereinigt, und nur bei Eisglätte wurde ein wenig Kies gestreut, der uns aber nicht störte. Vor allem abends wanderten Scharen von Mädchen und Buben nach Maladers oder Malix und genossen danach die mehrere Kilometer lange Abfahrt in die Stadt. Ich konnte auch von unserem Haus bis zum Eingang des Schulhauses schlitteln. Nach dem Mittagessen ging ich oft zum Brandacker, oder wenigstens zum Häxahüsli hinauf, um die Fahrt zu verlängern. Eines Tages, als ich eben umkehrte und mich auf den Schlitten setzte, kam Bischof Caminada auf seinem Spaziergang vorbei und fragte, ob er mitfahren dürfe. Ich zögerte. Mein Untersatz war ein alter Berner Schlitten, den schon Papa als Kind benutzt hatte. So sagte ich dem Geistlichen, er würde besser nicht auf dieses morsche Gefährt sitzen und liess ihn stehen. Unterwegs holte ich von zu Hause meine Schulsachen, und als ich den alten Herrn wieder überholte, brach der Schlitten entzwei, und ich sass vor ihm auf der Strasse. Caminada nickte mir lächelnd zu: «Danke, dass du mich nicht mitgenommen hast».
Bäuchlings Vorspann fahren, Böbbla, wie wir sagten, wobei einer vorfährt und mit den Füssen einen zweiten Schlitten nachzieht, waren verboten und vielleicht gerade deshalb beliebt. Mein Schulkamerad Marco fuhr bäuchlings die Hofstrasse hinunter, sah sich kurz nach mir um und rammte in vollem Tempo die Knie eines Stadtpolizisten. Der schwere Mann plumpste auf Marcos Rücken, und das Gefährt landete in der Mauer. Der Polizist rappelte sich hoch, knurrte den Buben an, ob er keine Augen im Kopf habe, und liess es damit bewenden.
Corsin und ich bauten einen Bob mit Schlittschuhen als Kufen, Steuerknüppel, und eher untauglichen Bremsen. Das Gefährt war breit, und wir konnten nebeneinandersitzen. Glücklicherweise hat kein Polizist unser Konstrukt zu Gesicht bekommen. Wir bewältigten damit einige Male die 5 km lange Fahrt von Maladers bis zu unserem Haus, wechselten dann aber zu den gewöhnlichen Schlitten zurück. Ein Bursche in unserem Haus besass einen echten Skeleton, mit dem er unter einen Lastwagen geriet, doch mit seinem flachen Untersatz kam er unbeschadet darunter durch. Ich sehe noch jetzt, wie der Chauffeur aus der Kabine sprang und ratlos war, als er weder Schlitten noch Unfallopfer vorfand.
Obwohl noch wenige Autos unterwegs waren und wir uns mit lauten Oho Rufen warnten, wenn eines auftauchte, kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Das hielt aber die wenigsten davon ab, Schlitteln zu gehen. Ich hatte zweimal Glück. In einer Kurve prallte ich in das Vorderrad eines Postautos, wurde zurückgeworfen, fasste meinen Schlitten und rannte weg, bevor der Chauffeur schimpfen konnte. Ein anderes Mal fuhr ich die Planaterra hinunter, als ich durch das übliche Johlen gewarnt wurde, dass ein Auto entgegenkam. Ich fuhr zum rechten Rand der Strasse, wo die Unterlage vereist war, verlor in der Kurve vor dem Chemiegebäude die Kontrolle und prallte in hohem Tempo mit dem Kopf in den achteckigen Steinsockel des Eingangs. Mit einer leichten Hirnerschütterung, die mir einen schulfreien Tag verschaffte, und einem englischen Verband von meinem Onkel verlief die Sache glimpflich.
Primarklasse auf der Lenzerheide
So angenehm Skifahren und Schlitteln waren, dienten sie jedoch vor allem dazu, den Winter zu überstehen. Ich bevorzuge den Sommer. Für mich war es einer der schönsten Tage des Jahres, wenn im Januar oder Februar der erste Föhn aufkam und warm durch die gespreizten Finger lief
Doppelleben
In meiner Jugend führte ich ein Doppelleben. Ich verbrachte mehrere Wochen und manchmal Monate bei Onkel Georg und Tante Ida in Ems. Tante Lena, meine Patin, führte den Haushalt und liebte Katzen. Die ersten Tiere, an die ich mich erinnere, waren zwei mächtige Kater, Felix und Hiddigeigei. Als eine weisse Angorakatze in unserem Haus in Chur Junge bekam, durfte ich eines mitnehmen und brachte es nach Ems. Der Erfolg war durchschlagend. Das Tier wurde von vielen bewundert. Ich weiss nicht, ob mein Onkel ein Männchen anderswo besorgt hat, oder ob ich später ein zweites Jungtier mitbrachte. Jedenfalls pflanzte sich die Rasse eifrig fort, und nach ein paar Jahren streunten im halben Dorf solch noble Katzen herum.
Doktorhaus in Domat Ems mit Sogn Pieder und Sogn Antoni
Das Doktorhaus stand am Abhang der Tuma Casté, auf der früher die Herren von Ems gewohnt hatten. Vom Schloss war nichts übrig geblieben ausser spärlichen Mauerresten, die in der Kiesgrube im nördlichen Teil des Hügels zum Vorschein gekommen waren. Hinter dem Haus befand sich die Kapelle Sogn Pieder und auf dem Hügel Sogn Antoni. Am trockenen Südhang neben der Kapelle blühten im Frühjahr die 'Flurs da Cocles', dunkelblaue Berganemonen, die früher zum Färben der Ostereier verwendet wurden.
Onkel Georg war Bezirksarzt in Ems und betreute auch die polnischen Internierten. Im Lager in Tamins durfte ich auf einem Maultier ein paar Schritte reiten. Die Polen zeigten mir, wie sie eine aus Papier geschnittene Blume auf ein Laubblatt legten und mit einer Bürste darauf klopften, bis im ungeschützten Teil nur das feine Venennetz übrigblieb. Darin hing unversehrt eine Blume.
Mit Corsin im Lager der polnischen Internierten
In Ems verbrachte ich die meiste Zeit mit Alois vom Nachbarhaus. Wir bauten eine Hütte auf der Tuma Casté, beobachteten Frösche in der Lehmgrube der Ziegelei und weilten oft in den Feldern und Wiesen oberhalb des Dorfs, auf den verschiedenen Hügeln und am Rhein. Unser Begleiter war Barri, ein schwarzer Sennenhund mit weissem Fleck auf der Brust. Er sorgte dafür, dass unsere Hütte nicht von anderen Knaben besetzt wurde. Ich war tagelang mit Barri zusammen und lernte, mit Hunden umzugehen. Danach verstand ich mich gut mit ihnen, und sie hatten auch nichts gegen mich. Tante Ida und Mama besuchten eine Cousine, Ordensschwester am Spital in Ilanz. Sie befand sich im Obstgarten, und als wir den Weg dorthin hinaufstiegen, kam ein Wolfshund zähnefletschend, mit angelegten Ohren auf uns zu. Da ich voranging, erreichte er mich als Ersten, blieb stehen, legte den Kopf an meine Brust und liess sich kraulen. Die Nonne kam mit wehenden Schleiern angerannt und schrie, ich solle den Hund nicht anfassen, er habe am Morgen die Schwester, die ihn täglich fütterte, gebissen und schwer verletzt.
Ein besonderes Ereignis für Alois und mich war, mit dem Leiterwagen Abfälle auf die Deponie im Vial zu bringen und in der Schuttablage nach Schätzen zu suchen. Tante Lena unterhielt einen Gemüsegarten in Barnaus, und wir halfen ihr oft bei der Arbeit. Als ich dort einmal ein Rüebli aus dem Boden zog, ermahnte mich ein vorbeikommender Bauer, ich dürfe nicht stehlen. Ich rechtfertigte mich mit der etwas gewagten Aussage: «Wenn man etwas nimmt, von dem man weiss, wem es gehört, ist es nicht gestohlen.» Vor so viel griechischer Weisheit gab sich der Bauer geschlagen.
Die Fasnacht in Ems war geprägt von den 'Bagorda paura', furchteinflössenden Maskengestalten, deren Larven von Natè, einem lokalen Künstler geschnitzt wurden. Heute kann man einige seiner Werke im Rietberg Museum bewundern. Die 'Angstmacher' trugen mit Stroh gestopfte Übergewänder, tollten in den Strassen herum, schlugen mit Schweinsblasen auf Leute ein, bevorzugt junge Frauen, oder beschmierten ihr Gesicht mit schwarzem Fett. Als Kleiner fürchtete ich mich vor diesen finsteren Gestalten.Ich fühlte mich fehl am Platz, als ich in einem noblen Kostüm, das die Tanten genäht hatten, als russischer Prinz im Dorf herumstand.
Der russische Prinz
Die Dorfjungen sah ich meistens nur von hinten, wenn sie vor Barri flohen. Etwas gemächlicher trafen wir uns in der Fastenzeit, wenn die Glocken schwiegen. Dann kamen sie mit Rätschen zur Kapelle Sogn Pieder, um mit schnarrendem Geräusch Anfang und Ende der Messe anzukünden. Hinter der Kapelle rauchten Alois und ich manchmal 'Nielen', getrocknete Stiele der Waldrebe. Mein Cousin Stefan, lebte in der afrikanischen Goldküste und bei seinen Besuchen in der Schweiz wohnte er jeweils bei Onkel und Tanten. Von ihm bekam ich manchmal eine Players Navy Cut Zigarette und selten einmal liess er mich von seinem Whiskey kosten. Damit nicht genug, mein Onkel schenkte mir, als ich etwa acht war, ein ganzes Päckchen Zigaretten, das Alois und ich hinter der Kapelle in einem Nachmittag aufrauchten. Der Onkel Doktor amüsierte sich köstlich, als ich ihm dies beichtete. Immerhin fing ich erst sieben Jahre später an, regelmässig zu rauchen.
Oft blieb ich zu Hause und las Bücher, am liebsten von Karl Mai dabei erfuhr ich viel über fremde Länder. Auch wenn der Autor nie selbst an den Schauplätzen weilte, hatte er sorgfältig recherchiert. Später wunderten sich manche Freunde in Ägypten, dass ich so viel über Land, Leute und islamische Sitten wusste. Nur selten hatten sie eine Korrektur anzubringen. An einem Nachmittag naschte ich beim Lesen in vier Stunden eine ganze Kurpackung Nestrovit. Auch dies hat mir nicht geschadet.
Mama und Tante Ida mit modischen Hüten
An Festtagen fuhren wir oft nach Ems zur Prozession und der Parade der Cumpania da mats. Corsin und ich gingen gerne zur Vesper, in der alte, von den Gegenreformatoren eingeführte Lieder gesungen wurden. Trotz der vielen zugezogenen Arbeiter der Emser Werke war Ems ein stockkatholisches Dorf geblieben. Manchmal kamen Frauen auf einen Schwatz zu den Tanten. Einmal durchleuchtete eine der Besucherinnen eine der Familien im Dorf und kam zum Schluss, dass man von denen nichts anderes erwarten dürfe, die seien erst bei der Reformation zugezogen und keine richtige Emser. In Graubünden wurde in den Gemeinden abgestimmt, welche Konfession gelten sollte, und die Minderheit fügte sich oder zog in ein Nachbardorf.
Georg Federspiel an der Fronleichnamsprozession
Onkel Georg war seit Jahrzehnten als Arzt in Ems tätig, doch während der Grippeepidemie 1918 - 1920 hatte er seine Praxis in Vella. Als fast alle Ärzte der Surselva krankheitshalber ausfielen, machte er mit seinem Pferd mehrtägige Besuchstouren durchs Oberland, von Ilanz bis Sedrun. Danach war er im ganzen Tal bekannt. Auf dem Heimweg von einer Tagung der Lia Romontscha, lag in einem Obstgarten ein Wagen, der von der Strasse abgekommen war. Als Onkel den ersten Verunfallten umlagerte, erwachte dieser aus seiner Ohnmacht und sagte, jetzt habe ihm der Herr Doktor das Leben zum zweiten Mal gerettet. Er war während der spanischen Grippe vom ihm behandelt worden.
Onkel Georg schilderte mir oft ungewöhnliche Ereignisse aus seinem Berufsleben, vom Mann, der versucht hatte, die zu späterem Gebrauch zurückgelassenen Blutegel zu essen, sie aber nicht hinunterbrachte, obwohl seine Frau sie in Butter gebraten hatte, vom Vater, der bedauerte, dass das verstorbene Baby so viel Mus vertilgt hatte, von den Schwestern, die zwei Tage lang versuchten, ihren verstorbenen Bruder mit Suppe zu füttern, und von der Bäuerin, die sich mit Wehen in den Zug setzte, um nach Chur ins Frauenspital zu fahren. Bei ihrer Ankunft stellten die Ärzte fest, dass sie bereits niedergekommen war. Sie hatte auf der Toilette der RhB eine Fallgeburt erlitten, ohne es zu bemerken. Das Baby wurde gesund und munter nahe von Reichenau zwischen den Gleisen gefunden. Als Bezirksarzt musste Onkel Georg auch zu Unfällen ausrücken und zeigte mir Fotos von der Unfallstelle mitsamt Verletzten und Toten. Zehn Jahre zuvor war er an den Bergungsarbeiten nach dem Felssturz in Fidaz beteiligt gewesen. Auch diese Fotos holte er hervor und zeigte sie mir. Ich habe kein Trauma davongetragen.
Schon als ich noch Kind war, erklärte er mir, wie er Krankheiten behandelte. Wenn der Patient einverstanden war, durfte ich manchmal zusehen, wie er eine Spritze setzte oder eine Wunde verarztete. So lernte ich manches und konnte es auch anwenden. Nach dem Mittagessen machte er seine tägliche Tour nach Reichenau, Bonaduz und Trins, empfing Patienten in Nebenzimmern von Gaststuben und machte Hausbesuche. Als er eines Tages unterwegs war und ich zu Hause las, kam die Tante angerannt und sagte, es sei ein Notfall eingetroffen, ob ich sehen könnte, was zu machen sei – ich war damals elf Jahre alt. Ein Arbeiter der nahen Kalkbrennerei hatte sich einen tiefen Schnitt zwischen Daumen und Handfläche zugefügt. Die Wunde blutete stark, doch er konnte die Finger bewegen und fühlte jede Berührung, also nichts Schlimmes. Ich reinigte die Wunde, klebte die Wundränder mit Heftpflaster Streifen zusammen und legte einen Verband an, wie es mir gezeigt worden war. Dann riet ich dem Mann, sich auszuruhen und um fünf wiederzukommen. Zu meiner Erleichterung hatte Onkel Georg nichts an der Wundversorgung auszusetzen. Im Dorf nannte man mich danach oft «il medi pitchen», den kleinen Doktor. In den Skilagern der Pfadfinder war ich Samariter, und ausser bei einem Beinbruch, mussten wir nie einen Arzt beiziehen. Alle waren überzeugt, dass ich später Arzt würde. Wahrscheinlich war der Weg zu deutlich vorgezeichnet, und ich habe deshalb einen anderen gewählt.
Als ich sechs war, nahm mich Tante Ida mit in die Ferien. Der Onkel brachte uns mit dem Auto nach Lugano und wählte die Route über den Julier und Maloja. Am Zoll schenkte er den italienischen Zöllnern eine Stange Zigaretten, was vielleicht ein Grund dafür war, dass Tante Idas umfangreiches Gepäck samt Hutschachtel nicht kontrolliert wurde. Zeit für eine genaue Untersuchung hätten die Zöllner genügend gehabt, denn 1947 war der grenzüberschreitende Verkehr noch dünn. Die Fahrt entlang des Comer Sees werde ich nie vergessen. Die holperige Strasse, die von Rauch geschwärzten, ärmlichen Dörfer, die zerlumpten Kinder, die dem Auto nachrannten und «Svizzeri, Svizzeri» schrien, liessen mich erahnen, was Krieg bedeutete, obwohl er schon seit zwei Jahren vorüber war.
Das Hotel Victoria in Lugano Paradiso gehörte dem Bündner Hotelier Badrutt und wurde vor allem von Engländern besucht. Die Reiseagentur Cook unterhielt dort einen lokalen Sitz. Der Vertreter stand den ganzen Tag an der Loge. Bei der Ankunft neuer Gäste erlaubte er sich zuweilen den Spass, auf eine der Damen zu zeigen und «Kiss!» zu rufen, worauf der grosse Berner Sennenhund folgsam hochsprang und der Dame seine Zunge quer übers Gesicht zog, was sichtbare Spuren im Make-up hinterliess. Wie es sich gehörte, versuchte ich die fremden Gäste in ihrer Sprache zu grüssen, doch mit «Good morning, good evening, good by!» war mein Sprachschatz erschöpft. «Please a little chewing gum» wäre fehl am Platz gewesen. Wenn Tante Ida vermeiden wollte, dass andere Leute uns zuhörten, sprach sie Romanisch mit mir, und einige Engländer erkundigten sich, ob wir Russen seien.
Die grössten Attraktionen in Lugano waren für mich das Spielwarengeschäft Franz Carl Weber und die Schiffsfahrten, ob grosse Seerundfahrt oder kleine Tour nach Caprino -Cavallino-Gandria. Letztere war fast interessanter, weil das Schiff oft anlegte und ich zusehen konnte, wie die Matrosen die Seile vertäuten und lösten. Die Besuche in bekannten Villen mit prächtigen Gärten und Gemäldeausstellungen sättigten mein Bedürfnis an sakraler Malerei bis heute weitgehend ab.
Wenn mein Cousin Stefan aus Afrika für Ferien nach Ems kam, brachte er jeweils eine reiche Auswahl an Mustern tropischer Hölzer und einige Rollen Schlangenleder mit. Damals dachte noch niemand daran, diesen Raubbau zu kritisieren. Er hatte auch Filme in Afrika gedreht, die wir auch in seiner Abwesenheit gelegentlich anschauten. Manchmal wurde besorgt diskutiert, ob es für einen Vierzehnjährigen gut sei, so viele nackte Leute zu sehen, doch da ich der Einzige war, der den Projektor bedienen konnte, war die Diskussion gegenstandslos.
Im Sommer nach dem Papas Tod kam Stefan mit in die Ferien nach Lugano. Ich war stolz darauf, in einem Auto mit Rechtssteuerung und West African Coast Schildern herumzufahren. Abends spielten wir Minigolf und zum Abschluss der Ferien fuhren wir für einige Tage nach Venedig. Entlang der Autobahn standen grosse Michelin Männchen aus Pappe, und wenn ich heute durch Italien fahre, fehlen sie mir. Beim Baden im Lido von Venedig hörte ein Fremder, dass ich der Tante etwas zurief, und fragte mich, ob ich Schweizer sei. Ohne witzig sein zu wollen, antworte ich spontan: «Nein, ich bin Bündner.»
Lugano blieb über Jahre das Ziel unserer Ferienreisen, doch einmal verbrachten wir zwei Wochen in Montreux. Wir fuhren über die Furka ins Wallis. Damals reichte der Rhone Gletscher bis hinunter zur Talsohle. Kürzlich bin ich dort vorbeigekommen, und das Eis war vom Tal aus nicht mehr zu sehen. Während der Fahrt durchs Wallis fragte ich ständig, wann wir endlich zum Genfer See kämen. Ein Mitreisender belehrte mich, dass ich Pech hätte, am Montag werde das Wasser jeweils abgelassen. Ich glaubte ihm, doch als die riesige silberne Fläche des Sees vor mir lag, strafte ich den Lügner mit einem verächtlichen Blick und verstand nicht, weshalb er so blöd lachte. Von Montreux fuhren wir mit dem Kursschiff nach Genf, um einen meiner dreiundzwanzig Cousins und Cousinen zu besuchen. Während der langen Fahrt assen wir im Schiffsrestaurant. Als der Steward zum Dessert eine Schale Herzkirschen servierte, stellte er silberne Wasserschalen dazu und empfahl eindringlich, die Früchte gut zu waschen, sie kämen aus Frankreich.
Stofale Theus, ein Bruder von Mama besass ein Hotel in Davos, und ich durfte auch dort einige Male Ferien verbringen. Meine Cousine Anita und ich verstanden uns blendend. Als Sechsjährige wolle sie nur mich heiraten. Später hat sie einen Besseren gefunden. Im Winter fuhren wir Ski. Einmal wanderten mein Bruder und ich mit den Fellen von Langwies über den Strela Pass nach Davos. Die Tour machte uns besonderen Eindruck, weil kurz zuvor zwei Churer Schüler dort in einem Schneesturm ums Leben gekommen waren. Am Ende der Osterferien fuhren wir jeweils vom Weissfluhjoch auf der immer dünner und matschiger werdenden Parsenn Piste nach Küblis, und auf der Bahnfahrt nach Chur sahen wir die Kirschbäume im Rheintal blühen. Es war, als ob wir uns den Frühling erobert hätten.
Meine Jugend war unbeschwert und glücklich. Im Gespräch mit Kurt, dem Autor eines Buchs über «Das Loch im Ich», sagte ich kürzlich, mein Loch sei höchstens erbsengross gewesen und längst zugewachsen.
Mittelschule
Mein Eintritt in die Mittelschule verspätete sich. Kurz vor dem Schulbeginn sass ich bei brütender Hitze im Schwimmbad, suchte Abkühlung im Wasser und bekam prompt Schüttelfrost. Auf dem Heimweg zur Lauda wurde mir schwindlig, und ich musste mich immer wieder auf der Mauerbrüstung abstützen. Zu Hause stellte ich fest, dass ich über 40 Grad Fieber hatte. Onkel Georg weilte in den Ferien, und sein junger Stellvertreter war besorgt, ausgerechnet eines seiner Familienmitglieder betreuen zu müssen, und brachte mich ins Spital zur Untersuchung. Ich hatte Hepatitis A aufgelesen. Die folgenden drei Wochen lag ich mit gelben Augen, gelblichem Teint und gelegentlichem Fieber im Bett. Wenigstens konnte ich lesen, aber die salzlose, fettfreie Diät war schrecklich. Ich ernährte mich fast ausschliesslich von Bananen, die damals noch ein Luxus waren, und rührte die Frucht danach über 50 Jahre nicht mehr an. Als mein Onkel aus den Ferien zurückkam, stellte er fest, dass sein Stellvertreter dreimal täglich drei Pillen des Medikaments verordnet hatte, anstatt der vorgeschriebenen dreimal eine. Auch dies habe ich überlebt.