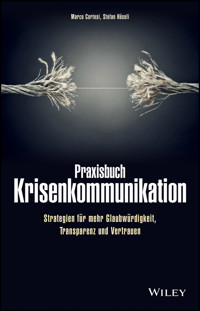
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Kommunikationslandschaft hat sich massiv verändert. Social Media und Tempo sind neue Faktoren. Auf der anderen Seite sind neue Arten von Krisen (wie beispielsweise Cyber- und Hacker-Attacken) entstanden.
Gerade in Krisensituationen ist es entscheidend, richtig zu reagieren. Es gibt Beispiele, da gewinnt trotz "Panne" das Image - dank guter Kommunikation. Das Gegenteil ist leider jedoch immer häufiger zu beobachten.
Tempo und Erwartungen der Öffentlichkeit nehmen zu, die sozialen Medien setzen offizielle Kommunikationskanäle unter Druck, Menschen sind dünnhäutiger geworden und zeigen weniger Loyalität gegenüber Unternehmen und anderen Institutionen.
In diesem Buch entführen Marco Cortesi und Stefan Häseli die Leser und Leserinnen in die komplexe Welt der Krisenkommunikation. Es ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die verstehen wollen, wie man in herausfordernden Zeiten effektiv kommuniziert. Theoretische Grundlagen werden mit praktischen Anwendungsbeispielen und Fallbeispielen verbunden. Marco Cortesi und Stefan Häseli beleuchten, wie man Botschaften klar und vertrauensvoll gestaltet und welche Rolle Ehrlichkeit und Transparenz spielen.
Von der ersten Reaktion auf eine Krise bis hin zum langfristigen Reputationsmanagement: Dieses Buch bietet praktische Tipps und Strategien, um in kritischen Momenten souverän zu agieren. Die Fallbeispiele reichen von kleinen Unternehmenskrisen über Konzernkrisen bis hin zu großen, öffentlichen Skandalen. Die Autoren zeigen, wie erfolgreiche Kommunikation Krisensituationen entschärfen oder sogar in Chancen verwandeln kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alle Bücher vonWILEY-VCHwerden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim,Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Hinweis:
Wir haben uns bemüht, in diesem Buch eine inklusive Sprache zu wählen, die alle Geschlechter berücksichtigt. Sollte an einigen Stellen darauf verzichtet worden sein, dann nur im Sinne der leichteren Lesbarkeit. Entsprechende Begriffe und Formulierungen gelten dann im Sinne der Gleichbehandlung natürlich für alle Geschlechter.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51208-9eBook ISBN: 978-3-527-84996-3
Illustrationen: Johannes LottUmschlaggestaltung: Susan BauerUmschlagfoto: broken point, tiero –stock.adobe.com
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort – die Crux mit der Kommunikation
Geleitwort – Krisenkommunikation als Erfolgsfaktor
Vorwort der Autoren
Zur Einleitung ein Fallbeispiel
Die Kommunikation in der Krise
1 Die Krise kommt, der Notfall ist da
2 Ist das jetzt eine Krise oder ein Notfall?
Krisen, Notfälle und Katastrophen
Der Begriff der Krise aus unterschiedlichen Perspektiven
Ablauf einer Krise und die Kategorisierung in einzelne Stufen
Anmerkungen
3 Gut, nun sind wir bestens vorbereitet, oder?
Generelle Prävention und Vorbereitung
Checkliste für die proaktive Vorbereitung in der Vorkrisenzeit
Vorbereitungs-Checkliste für den konkreten Fall
Beispielhafter Aufbau eines Krisenmanagements
Praxisbeispiel: Katastrophenbewältigung der Stadt Zürich
Notiz
4 Pressetermin und Kamera ein
Interventionsstrategien
Kommunikations- und Bewältigungsstrategie
Die Macht der Medien
Ein Praxisbeispiel: Die Ahrtal-Flutkatastrophe
Anmerkungen
5 Personen kamen zu Schaden und Todesfälle werden befürchtet
Das zweischneidige Schwert der Empathie
Körpersprache
Der Tylenol-Fall
6 Vorbei ist nicht vorbei
7 Nutzung von Social Media in der Krisenkommunikation
8 Die Aussagekraft von Bildmaterial als Stütze in der Krisenkommunikation
Psychologische Aspekte der Bildkommunikation
Die ethischen Anforderungen in der Bilderkommunikation
Notiz
9 Qualität vor Tempo
Genauigkeit der Informationen
Überstürzte Kommunikation
Qualitätssicherung vor Geschwindigkeitsrausch
Nutzung von Holding Statements
10 Ausstattung und Ressourcen
Personelle Anforderungen
Räumliche Anforderungen
Technische Anforderungen
11 Strategie und Taktik
Krisenkommunikationsstrategie
Taktiken in der Krisenkommunikation
So besser nicht: Explodierende Batterien
Es geht auch anders: Klemmende Gaspedale
12 Krisentraining – vorbereitet für die Herausforderungen der Zukunft
Neue Normalität: dauerhafte Krisenbewältigung
Resilienz und Antifragilität: Widerstandskraft stärken
Praktische Umsetzung: Krisen realitätsnah trainieren
Notiz
13 Monitoring und Evaluation
Monitoring: Werkzeuge und Methoden
Evaluation: Messung der Effektivität
Datensammlung und -analyse
Notiz
14 Management und Führungskommunikation
Krisenführung
Sensibilisierung des Managements
Anforderungen an die interne Kommunikation
Strategien für effektive Führungskommunikation
Extrakt
Notiz
15 Organisatorische Vorbereitung durch Strukturlegung für den Krisenfall
Krisenmanagement-Team
Identifikation und Analyse von Risiken
16 Interdisziplinäre Perspektiven – Einblicke aus Psychologie, Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaft
Psychologische Aspekte der Krisenkommunikation
Betriebswirtschaftliche Aspekte der Krisenkommunikation
Kommunikationswissenschaftliche Aspekte
17 Nach der Krise ist vor der Krise – die Aufarbeitung
Die Bedeutung der Krisennachbearbeitung
Die wesentlichsten Schritte zur effektiven Krisenaufarbeitung
Reorganisation und Neuausrichtung
Transparente Darstellung der Ergebnisse
Langfristige Überwachung und Anpassung
Extrakt
18 Warum Krisenkommunikation Chefsache sein muss
Die Verantwortung des CEOs
Wie die Krisenkommunikation auch wirklich zur Chefsache wird
Zusammenfassung
19 Abschluss und Ausblick
Die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) auf die zukünftige Krisenkommunikation
Schlussfolgerung
Anhang: Reale, praktische Fallbeispiele
Fallstudie: Krisenmanagement und Kommunikation während des Tsunamis 2004 – Die Erfahrungen von Hotelplan
Fallstudie: Cyberangriff auf ein Schweizer Unternehmen – ein Krisenmanagementbericht
Fallstudie: Kommunikationsherausforderungen und Lernprozesse der Stadtpolizei Zürich
Über die Autoren
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Chapter 3
Abbildung 3.1: Generelle Gefährdungs- und Risikoanalyse der Stadt Z...
Abbildung 3.2: Informationskaskade
Abbildung 3.3: Farbzuteilung der Dienste in der Informationskaskade
Abbildung 3.4: Informationsrhythmus, beispielhaftes kurzes Intervall
Abbildung 3.5: Informationsrhythmus, beispielhaftes längeres Intervall
Abbildung 3.6: Beispielhafte Ereignisstufen bei der Stadt Zürich
Abbildung 3.7: Beispielhafte Schadenraumorganisation
Abbildung 3.8: Beispielhafte weiträumige Absperrung
Abbildung 3.9: Schadenraumorganisation, Anzahl Fahrzeuge
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort – die Crux mit der Kommunikation
Geleitwort – Krisenkommunikation als Erfolgsfaktor
Vorwort der Autoren
Zur Einleitung ein Fallbeispiel
Fangen Sie an zu lesen
Anhang: Reale, praktische Fallbeispiele
Über die Autoren
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
315
316
317
318
Geleitwort – die Crux mit der Kommunikation
Läuft es für eine Partei bei Wahlen nicht gut, dann heißt es am Wahltag: »Wir haben schlecht kommuniziert.« Geht eine Abstimmung verloren, dann lautet die Analyse postwendend: »Die Kommunikation war ungenügend.« Verliert eine Firma an der Börse an Boden, auch da: »Die Kommunikation der Business-Strategie ist bei den Anlegern nicht verstanden worden.« Wir sehen es überall und andauernd: Funktioniert etwas nicht, dann ist die Kommunikation schuld.
Von daher ist es sehr dankenswert, wenn Stefan Häseli und Marco Cortesi mit diesem Buch versuchen, die glaubwürdige Kommunikation anhand vieler Praxisbeispiele und Interviews zu verbessern. Denn da liegt tatsächlich vieles im Argen.
Als Wirtschaftsjournalist, der nun über 40 Jahre die Unternehmenskommunikation vieler Unternehmen begleitet, kommt man nicht umhin, festzuhalten: Es gibt Unmengen an Verbesserungsmöglichkeiten, was gute Kommunikation anbelangt. Viele Firmen, die sich in ihrer eigenen Wahrnehmung als Weltkonzerne sehen und zu den global Besten gehören wollen, zeigen große Schwächen in der Kommunikation. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Mega-Konzerne, die sich die besten Kommunikationsprofis leisten könnten, keine Ahnung von Medien oder der DNA von Journalistinnen und Journalisten haben. Was dann oft in eigentlichen Kommunikations-Desastern endet. Man erinnere sich beispielsweise an die kommunikativen Begleittöne beim Untergang der Credit Suisse. Ein Trauerspiel. Und nicht zu vergessen: In einer Welt der kontinuierlichen (24-Stunden-)Information, vor allem auf den sozialen Medien, ist keine Kommunikation natürlich immer auch eine Kommunikation. Es gibt viele Gründe, warum die Kommunikation gerade in der Wirtschaft nicht optimal läuft, manchmal sogar grottenschlecht ist. Einige wenige möchte ich hier kurz antippen.
Die Kommunikationsstellen vieler Behören und Unternehmen haben immer noch nicht begriffen, dass Kommunikation heute besonders stark über das bewegte Bild – sprich Videos – läuft. Noch immer investieren Firmen viel Geld in unendlich dicke Geschäftsberichte (wer liest Geschäftsberichte?), ellenlange Communiqués (wer liest Communiqués?) und Textwüsten (wer hat heute noch die Zeit, zehnseitige Kommunikations-Ergüsse zu lesen?). Selbst wenn sie es mit dem Medium Fernsehen zu tun haben, sind sie unfähig, sich kurz und zum Punkt zu äußern oder eine echte Geschichte zu erzählen. Die sozialen Medien haben hier noch einmal eine tiefgreifende Veränderung und Beschleunigung gebracht. Die Kommunikationsstellen sollten sich viel stärker überlegen, wer die Zielpersonen ihrer Kommunikation sind. Noch immer werden von Firmen beispielsweise bei Bilanzpressekonferenzen vor allem Zahlen und nochmals Zahlen heruntergebetet, dabei wollen Journalisten eine spannende Geschichte hören.
Kommunikation auf Unternehmensebene wird schwieriger, weil immer neue Unternehmensbereiche involviert sind. Früher war Kommunikation im Wesentlichen die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, heute redet besonders bei börsennotierten Unternehmen ganz entscheidend die Legal- sowie die Compliance-Abteilung mit – ganze Heerscharen von Juristen sind beteiligt. Das Resultat ist eine langweilige und juristisch gesteuerte Information, die wenig glaubwürdig ist und nicht authentisch wirkt. Starke Chefs setzen sich über Bedenken von Juristen hinweg. Hier gibt es auch tiefgreifende Unterschiede zwischen einem echten Unternehmer und einem angestellten Top-Manager. Unternehmer und Unternehmerinnen lassen sich nichts vorschreiben, weil ihnen die Firma gehört. Das macht ihre Kommunikation so glaubwürdig, authentisch und gradlinig (man kann das übrigens sehr gut an den Einschaltquoten ablesen). Das schätzt das Publikum, auch wenn die Informationen negativ sind. Angestellte Top-Manager dagegen gehen möglichst wenige Risiken ein, lassen sich von Juristen vorschreiben, was sie sagen dürfen und was nicht. Am Schluss verwässern Kommunikationschefs das Thema noch zusätzlich. Das Resultat ist eine blasse und häufig völlig unglaubwürdige Kommunikation.
Viele Unternehmenschefs glauben, sie seien als geniale Kommunikatoren geboren. Dabei gibt es nur ganz wenige CEOs, die eine natürliche Begabung in diesem Bereich aufweisen. Klar, es gibt immer Unterschiede, Chefs, die kommunikative Aufgaben lieber wahrnehmen als andere. Kommunikation ist aber für einen CEO eine unabdingbare Fachkompetenz, die man erlernen kann und auch üben muss. Geniale Kommunikatoren fallen eben gerade nicht vom Himmel, auch hier macht Übung den Meister. Ich wundere mich immer wieder über Firmenchefs (und deren Kommunikationsprofis), die Interviews geben, ohne dass auch nur ein einziger Satz, eine einzige Idee beim Zuschauer oder Zuhörer hängen bleibt (meistens strotzen solche Sätze dann auch noch vor Anglizismen, die höchstens ein Fachpublikum versteht). Dabei könnte man mit etwas Vorbereitung und der überlegten Formulierung eines einzigen erinnerungswürdigen Satzes viel bewirken. Hier sind die Kommunikationsprofis stark gefordert, versagen aber in vielen Fällen.
Glaubwürdige Kommunikation heißt immer authentisch bleiben. Es darf nicht passieren, dass das, was beim Empfänger ankommt, das ist, was wir Journalisten gerne ein »PR-Geschwurbel« nennen. Kommunikationsstellen neigen dazu, selbst dann noch Dinge schönzureden, wenn es gar nichts mehr schönzureden gibt, weil schon alle begriffen haben, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Oft produzieren Kommunikationsabteilungen ein Übermaß an »PR-Spin«, der dann nur noch kontraproduktiv und unglaubwürdig wirkt. Ein authentischer Chef/eine authentische Chefin sollte niemals Dinge kommunizieren, zu denen er oder sie persönlich nicht stehen kann oder die er oder sie selbst nie so sagen würde.
Ich bin überzeugt davon, dass gerade dieses Buch hilft, einige der immer wieder begangenen kommunikativen Fehler zu vermeiden, denn viele der Praxisfälle zeigen: Kommunikation ist eine Daueraufgabe in einer medialen Welt, die immer stärker von Fake News und künstlich erzeugten Informationen beherrscht wird.
Reto Lipp
Reto Lipp ist Ökonom und seit 2007 Wirtschaftsmoderator beim Schweizer Fernsehen SRF. Lange Zeit hat er das Wirtschaftsmagazin »Eco« präsentiert, seit 2021 moderiert er auf SRF1 den wöchentlichen »Eco Talk«. Er ist auch bei »SRF Börse« präsent und analysiert das Wirtschaftsgeschehen in der »Tagesschau« oder bei »10vor10«.
Geleitwort – Krisenkommunikation als Erfolgsfaktor
Gibt es heute mehr Krisen als früher? Ereignen sich jetzt mehr Unglücke, und melden mehr Unternehmen Insolvenz an? Häufen sich die Pannen in den Abläufen des öffentlichen Lebens? Objektive Antworten darauf mögen Statistiken liefern. Subjektiv lautet die Antwort: Ja! Es scheint kein Tag zu vergehen, an dem nicht negative Meldungen durch die Medien gehen und in den Öffentlichkeiten diskutiert werden. Über die sozialen Medien kann jeder zum Sensationsreporter, Kameramann vor Ort und Kommentator werden. Sogenannte Experten kennen sowohl die Ursachen als auch die Folgen jeder Ausnahmesituation – und äußern sich dazu. Je schneller eine Nachricht in die Welt gesetzt ist, desto besser. Dass dabei auch Fake News, versehentlich oder absichtlich, oder gezielte Desinformationen dabei sind, macht alles noch komplexer.
War die Krisenkommunikation vor Jahren noch eine eher wenig beachtete Disziplin der Public Relations, scheint sie in Zeiten der Multikrisen zum Alltag von Kommunikatoren in Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu gehören. Diese müssen Schieflagen erklären, komplizierte Sachverhalte darstellen und versuchen, kritische Berichterstattung zu vermeiden. Ihr Job – auch der von Beratern in Public-Relations-Agenturen übrigens – ist herausfordernder geworden.
Was ist zu tun?
Auch wenn Krisensituationen ganz plötzlich entstehen: Unvorbereitet sollten sie keinen Kommunikationsprofi treffen. Für jedes denkbare Szenario lassen sich im Vorfeld Kommunikationsstrategien vorbereiten und entsprechenden Maßnahmen planen. Je genauer die Abläufe während einer Krise definiert sind, desto schneller und besser können die Verantwortlichen Botschaften abstimmen und an die Stakeholder kommunizieren. Textbausteine, Bildmaterial, Presseverteiler sollten fertig in der Schublade liegen. Obwohl dies einleuchten mag, verzichten viele Unternehmen und Institutionen auf diese Art der präventiven Krisenkommunikation, in der Hoffnung, sie bleiben von einer Krise verschont. Das Risiko mag von Branche zu Branche unterschiedlich groß sein; Cyberattacken, um nur ein Beispiel zu nennen, können jede Organisation treffen, egal wie klein und vermeintlich unbedeutend sie sein mag.
Entsteht nun aber eine akute Krisensituation, muss die betroffene Institution zwangsläufig kommunizieren, um die Kommunikationshoheit zu behalten und um keine Gerüchte aufkommen zu lassen. Für diese operative Krisenkommunikation gelten dieselben Prinzipien wie für jede Art der Öffentlichkeitsarbeit: Sie muss wahrhaftig und glaubwürdig sein, transparent und konsistent. Allem voran aber: Sie muss schnell sein. Ein erstes Statement sollte abgesetzt sein, bevor Mutmaßungen über Messengerdienste geteilt und Fotos in Umlauf gebracht werden. Geschwindigkeit ist gewährleistet, wenn eine Krisensituation gut vorbereitet ist.
Erfolgreiche Krisenkommunikation besteht also aus Vorbereitung und Kommunikation, die sich im Wesentlichen nur durch höheres Tempo und größeren Druck von außen von den »normalen« Public-Relations-Aktivitäten unterscheiden. Wofür braucht es dann überhaupt so ein Buch wie das vorliegende?
Keine Krise gleicht der anderen. Keine Krise entwickelt sich genau so, wie sie im Krisenhandbuch beschrieben und geplant ist. Bei fast jeder Krisenkommunikation kommt es auch zu Fehlern. Ihr theoretisches Fachwissen können Kommunikatoren nur durch Praxiserfahrung ergänzen. Eigene Erfahrungen können sie allerdings nur sammeln, wenn sie sich in einer Krisensituation befinden. Umso wichtiger ist es, von den Beispielen anderer Praktiker zu lernen. Deren Krisenfälle kann der Leser auf seine eigene Organisation übertragen und von den Lessons Learned profitieren.
Dieses Buch beinhaltet beides: eine systematische theoretische Einführung in die Krisenkommunikation und jede Menge Beispiele aus der Praxis der Autoren. Beide warten mit Erfahrungswissen aus jahrzehntelanger Arbeit im Kommunikationsbereich auf. Sie wissen, wie man unter Druck Statements generiert und Interviews gibt, und kennen die Fallstricke, die zuweilen Medienvertreter für eine gute Headline legen.
Aus diesem Buch können die Kommunikationsverantwortlichen in Unternehmen genauso lernen wie deren Geschäftsführer und CEOs, Öffentlichkeitsarbeiter in Verwaltung und Politik genauso wie Consultants in Public-Relations-Agenturen. Nach der Lektüre sollte allen klar sein: eine Krise kann jeden treffen, aber man kann sie kommunikativ in den Griff bekommen. Und: Krisenkommunikation ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor für das Management von Krisensituationen.
Mein Dank gilt den Autoren, die mit diesem Buch einen ganz wichtigen Beitrag für bessere Kommunikation in Sondersituationen liefern.
Veit Mathauer
Veit Mathauer ist Gründer und Geschäftsführer der Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public Relations, Stuttgart
Vorwort der Autoren
Seit Dutzenden von Jahren beschäftigen wir uns mit der faszinierenden Thematik der Kommunikation in der Praxis und beratend für Unternehmen und Organisationen. Dabei steht stets eine Frage immer im Fokus: Wie kann Kommunikation besser werden?
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen: Gerade in Krisensituationen ist es entscheidend, richtig zu reagieren. Es gibt Beispiele, da gewinnt trotz »Panne« das Image – dank guter Kommunikation. Das Gegenteil ist leider immer häufiger zu beobachten.
Die Welt ist nicht stehen geblieben: Tempo und Erwartungen der Öffentlichkeit nehmen zu, die sozialen Medien setzen offizielle Kommunikationskanäle unter Druck, Menschen sind dünnhäutiger geworden und zeigen weniger Loyalität gegenüber einem Unternehmen, einer Partei, einer Organisation.
Während eines gemeinsamen Vortrags entstand die Idee, die realen Erfahrungen und das in der Zwischenzeit große, auch theoretische Rüstzeug in eine praktische und gut umsetzbare Buchform zu setzen. Dieses Sachbuch lebt genau von diesem Crossover-Ansatz von uns beiden mit den unterschiedlichen Blickrichtungen und Erfahrungen.
Glaubwürdigkeit ist gerade in der Krise die Währung für Vertrauen – und Vertrauen ist das eigentliche Kapital des Sinngrundes eines Unternehmens oder einer Organisation. Vielleicht kann man das zusammengefasst in fünf Kurzstichworte setzen:
Vertrauen schaffen!
Glaubwürdig sein!
Hör-, spür- und sichtbar sein!
Alles, was Sie sagen, muss wahr sein!
Kernbotschaften platzieren!
Das Buch ist im Teamwork entstanden, bei dem an und in sich schon viel kommuniziert werden muss. Gerade auch in einem solchen Projekt gibt es Höhen und Tiefen. Diese im Team immer wieder zu klären, war ein wenig »Kleinkrisenkommunikation im Mikrokosmos«. Zur Beruhigung aller: Jede Diskussion gab der Gesamtqualität einen Booster. So soll es sein.
Wir bedanken uns hier bei vielen, die uns in irgendwelcher Art unterstützt haben. Insbesondere aber bei:
Hans-Peter Nehmer
(Chief Communications Officer CCO und Mitglied der Direktion Allianz Versicherungen, Präsident Schweizer Harbour Club), der uns als Interviewpartner zur Verfügung stand und auch ein praktisches Fallbeispiel aus der tragischen Tsunamikatastrophe zur Verfügung gestellt hat.
Patrik Forster
(Leiter Verkauf und Marketing, Mitglied der Geschäftsleitung der Meier Tobler AG). Er zeigte uns als Betroffener im Fallbeispiel im zweiten Teil, wie die Kommunikation in Phasen eines größeren Cyber-Angriffs eine entscheidende Rolle in der Bewältigung spielte.
Ulf Dittmann
, der mit akribischer Recherchier- und fleißiger Schreibarbeit viel an textlicher Substanz beigetragen hat.
Dr. Simone Richter
und
Tanja Weber
, die mit ihren Textüberarbeitungen und Recherchen das Kernteam immer wieder unterstützt haben.
Johannes Lott
mit der wundervollen Gabe, die Kapitel dank seiner zeichnerischen Künste zu illustrieren.
Wir wünschen Ihnen viel Einsichten dank Ansichten und pflegen Sie weiterhin Ihre Kommunikation.
Meilen und Gossau, im Oktober 2024
Marco Cortesi, Stefan Häseli
Zur Einleitung ein Fallbeispiel
Das nun folgende Fallbeispiel wird uns durch das gesamte Buch begleiten. Wir werden in den nachfolgenden Kapiteln immer wieder darauf zurückkommen und das in den einzelnen Kapiteln vermittelte Wissen mit Referenz auf diesen Fall einordnen und erläutern.
»Der Cyberangriff: Schattenspiele im Netzwerk«
Der Auftakt
Der Tag beginnt wie immer bei TechDynamics, einem führenden Technologieunternehmen. Mitarbeitende strömen in das hochmoderne Glasgebäude, bereit für eine neue Arbeitswoche. Doch bereits in den frühen Morgenstunden melden sich erste Mitarbeitende bei der IT-Abteilung und berichten, dass das System langsam sei und einige Applikationen sich nicht starten lassen. Die IT-Support-Mitarbeitenden erhalten bald darauf Screenshots von Mitgliedern der Geschäftsleitung, die auf ihren Bildschirmen anstatt des schicken Firmengebäudes in feinstem Sommerwetter nun plötzlich kryptische Buchstaben entdecken.
Der Schock
Langsam wird klar: Dies ist kein gewöhnlicher Systemfehler. Eine nicht zu löschende Meldung in fehlerhaftem Englisch erscheint auf den Bildschirmen: »Darkness is coming, dear company TechDynamics, no datas are safe.« Schnell breitet sich Panik aus. Dr. Martin Schneider, der CEO und ein renommierter Informatiker, versammelt sofort sein Krisenteam. »Das ist ein gezielter Angriff. Wir müssen Ruhe bewahren und strategisch vorgehen«, sagt er, während er die Nachrichten auf seinem Smartphone liest. Kunden beginnen sich zu melden und berichten, dass ihre Daten verschwunden seien, Lieferanten haben doppelte Rechnungen erhalten.
Der Gegenschlag
Die IT-Abteilung arbeitet fieberhaft daran, den Ursprung des Angriffs zu lokalisieren. Das Netzwerk ist so gründlich kompromittiert, dass jede Sekunde zählt. Die Angreifer haben eine raffinierte Ransomware namens »Black Shadow« verwendet, die bisher unbekannte Schwachstellen ausnutzt.
Die Verhandlungen
Während die technischen Ermittlungen laufen, erhält Dr. Martin Schneider als CEO eine anonyme E-Mail von den Angreifern. »Dies ist Ihre letzte Chance. Wir beobachten jeden Ihrer Schritte. Jeder Versuch, uns zu finden, wird mit der endgültigen Löschung Ihrer Daten beantwortet.« Die Situation wird immer heikler. Die Aktienkurse von TechDynamics beginnen zu schwächeln. In einem geheimen Treffen mit den Führungskräften wird diskutiert, ob sie die Lösegeldforderung erfüllen sollten.
Der CEO entscheidet sich, mit den Angreifern in Kontakt zu treten, um mehr Zeit zu gewinnen. Die Verhandlungen sind zermürbend und gefährlich. Er muss seine Worte mit Bedacht wählen, um die Hacker nicht zu provozieren. »Wir sind bereit zu verhandeln, aber wir brauchen einen Beweis, dass Sie die Daten wirklich entschlüsseln können«, schreibt er. Die Antwort kommt schnell: »Sie haben 24 Stunden, um zu zahlen. Danach wird alles gelöscht.«
Der Wettlauf gegen die Zeit
Während die Verhandlungen laufen, arbeiten Laura und Michael, zwei IT-Spezialisten bei TechDynamics, unter Hochdruck an einer Lösung. Jede Sekunde zählt. »Wir müssen die Ransomware analysieren und eine Schwachstelle finden«, sagt Michael entschlossen. In einer dramatischen Wendung gelingt es ihnen, einen kleinen Fehler im Code der Ransomware zu entdecken, der ihnen einen Weg zur Entschlüsselung der Daten bietet.
Der Durchbruch
Nach schlaflosen Nächten und endlosen Stunden des Codens finden Laura und Michael endlich einen Hinweis. Eine winzige Anomalie in den Logdateien führt sie zu einem Server in Osteuropa. Es stellt sich heraus, dass einer der ehemaligen Mitarbeitenden von TechDynamics, ein brillanter, aber rachsüchtiger Programmierer namens Ivan Petrov, hinter dem Angriff steckt. Ivan ist vor einem Jahr entlassen worden und hat seitdem seine Fähigkeiten genutzt, um sich zu rächen.
Die finale Konfrontation
Die Behörden haben inzwischen Ivan Petrov lokalisiert und planen einen Zugriff. Es ist ein riskantes Unterfangen, da jede falsche Bewegung zur endgültigen Zerstörung der Daten führen kann. In einer koordinierten Aktion stürmen sie Ivans Versteck und nehmen ihn fest. Gleichzeitig gelingt es Laura und Michael, die Ransomware zu entschlüsseln und die Daten zu retten. Der Jubel im Büro von TechDynamics ist grenzenlos.
Der Showdown
Mit den gesammelten Beweisen wenden sich Laura und Michael an die Behörden. Während eine koordinierte Aktion zwischen Interpol und den lokalen Polizeibehörden zur Festnahme von Ivan und seinem Team führt, gelingt es dem IT-Team von TechDynamics parallel dazu, eine Hintertür in der Ransomware zu finden und die Daten zu entschlüsseln. Der Schaden ist groß, aber das Unternehmen kann gerettet werden.
Der Wiederaufbau
Nachdem die unmittelbare Gefahr gebannt ist, beginnt für TechDynamics die mühsame Arbeit des Wiederaufbaus. Neue Sicherheitsprotokolle werden implementiert und die gesamte IT-Infrastruktur wird erneuert. Dr. Martin Schneider hält eine bewegende Rede an die Mitarbeitenden: »Dieser Angriff hat uns gezeigt, wie verwundbar wir sind, aber auch, wie stark wir gemeinsam sein können. Wir haben nicht nur unsere Daten zurückgewonnen, sondern auch unsere Entschlossenheit.«
Die Aufarbeitung
Die Wiederherstellung der Daten ist nur der Anfang. Das Unternehmen muss den Vertrauensverlust bei Kunden und Partnern bewältigen. Intensive PR-Kampagnen und Transparenz bei der Aufklärung des Vorfalls helfen, das Vertrauen langsam wieder aufzubauen. »Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und werden stärker zurückkommen«, verspricht Dr. Schneider.
Ein neuer Anfang
Der Angriff hat TechDynamics verändert. Neue, strengere Sicherheitsmaßnahmen werden eingeführt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen werden zur Norm. Laura und Michael entwickeln ein umfassendes Schulungsprogramm für Mitarbeitende, um die Wachsamkeit gegenüber Cyberbedrohungen zu erhöhen. Der Angriff hat gezeigt, dass ein Unternehmen nur so stark ist wie seine schwächsten Glieder, und TechDynamics ist entschlossen, nie wieder so verwundbar zu sein.
Die Geschichte von TechDynamics wird zu einem Lehrbuchbeispiel für Cyberabwehr und Krisenmanagement. Der Angriff hat nicht nur das Unternehmen verändert, sondern auch die gesamte Branche. Cyberangriffe sind eine reale und ständige Bedrohung, aber TechDynamics hat gezeigt, dass mit Entschlossenheit und Teamarbeit jede Krise überwunden werden kann.
Lehren aus dem Schatten
Der Cyberangriff auf TechDynamics ist ein Weckruf für die gesamte IT-Branche. Unternehmen weltweit beginnen, ihre Sicherheitssysteme zu überdenken und zu verbessern. Laura und Michael werden als Helden gefeiert. Ivan Petrov wird zu einer langen Haftstrafe verurteilt, aber der Schatten seines Angriffs wird noch lange über TechDynamics hängen.
Die Welt hat sich verändert. Die Bedrohungen aus dem Cyberspace sind real und allgegenwärtig. Doch aus der Krise entsteht eine neue Wachsamkeit und ein unerschütterlicher Wille, solchen Angriffen entschlossen entgegenzutreten.
Die Kommunikation in der Krise
Der Kommunikation in dieser Krise gehört eine Schlüsselaufgabe. Hier entscheidet sich, neben den technischen Reparaturarbeiten, ob, wie und wie schnell das Vertrauen von Lieferanten, Kunden, Mitarbeitenden, Öffentlichkeit, Aktionären wieder hergestellt, aufgebaut und nachhaltig gehalten werden kann. Unterm Strich ist gelungene Kommunikation eine Existenzfrage für das gesamte Unternehmen.
Krisenkommunikation ist eine vielschichtige Angelegenheit, sie darf nie unterschätzt werden und wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Die Kommunikation im Krisenfall dieser fiktiven Geschichte wird in jedem Kapitel beleuchtet und begleitet Sie, lieber Leser, durch die Fachkapitel.
1Die Krise kommt, der Notfall ist da
Professionelle Krisenkommunikation spielt eine zentrale Rolle im Management eines Unternehmens, insbesondere in herausfordernden Zeiten. Sie dient primär dem Schutz der Reputation, indem sie sicherstellt, dass Informationen schnell, transparent und effektiv an die Öffentlichkeit gelangen.
Dies ist entscheidend, da die Wahrnehmung eines Unternehmens in Krisenzeiten schnell negativ beeinträchtigt werden kann.
Durch eine gezielte Kommunikation lassen sich potenzielle Schäden minimieren und das Vertrauen von Kunden, Investoren und anderen wichtigen Stakeholdern bewahren oder sogar wiederherstellen.
Ein wichtiger Aspekt professioneller Krisenkommunikation ist die Vermeidung von Fehlinformationen. Gerade in Krisensituationen können Gerüchte und falsche Informationen schnell entstehen und sich verbreiten.
Eine durchdachte Kommunikationsstrategie hilft daher Unternehmen, korrekte Informationen zu verbreiten und damit Klarheit zu schaffen sowie zur Beruhigung beizutragen.
Darüber hinaus hat die Art und Weise, wie ein Unternehmen kommuniziert, oftmals auch rechtliche Implikationen. Professionelle Krisenkommunikation kann helfen, rechtliche Risiken zu minimieren, indem sie sicherstellt, dass alle kommunizierten Inhalte den rechtlichen Anforderungen genügen.
Dies schützt das Unternehmen vor möglichen rechtlichen Konsequenzen, die aus unsachgemäßer Kommunikation resultieren könnten.
Ein weiterer Punkt ist die Sicherstellung der operativen Kontinuität. Effektive Krisenkommunikation informiert Mitarbeiter, Kunden und Partner klar und deutlich über die Situation und potenzielle Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe. Dies trägt dazu bei, Verwirrung und Unsicherheit zu reduzieren, die sonst zu weiteren Betriebsunterbrechungen führen könnten.
Langfristige Wettbewerbsvorteile können ebenfalls durch professionelle Krisenkommunikation erzielt werden. Unternehmen, die Krisen gut managen und effektiv kommunizieren, stärken das Vertrauen in ihre Marke und fördern eine Loyalität, die weit über die Krisensituation hinausgeht. Dies kann ihnen einen signifikanten Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen, die in Krisenzeiten weniger effektiv kommunizieren.
Schließlich spielt die Krisenkommunikation eine wichtige Rolle bei der Mitarbeiterbindung und -moral. Klare und transparente Kommunikation während einer Krise kann dazu beitragen, dass sich Mitarbeiter gut informiert und unterstützt fühlen, was wiederum ihre Bereitschaft erhöht, durch schwierige Zeiten zu navigieren und einen Beitrag zum allgemeinen Krisenmanagement zu leisten.
Zusammenfassend ist professionelle Krisenkommunikation ein unverzichtbares Instrument im Risikomanagement und der strategischen Planung eines jeden Unternehmens. Sie ermöglicht es, auf Herausforderungen schnell und effektiv zu reagieren, den Schaden zu begrenzen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Bewältigung der Krise zu legen.
Merke:
Erst die Handlung macht die Kommunikation glaubwürdig!
2Ist das jetzt eine Krise oder ein Notfall?
»Jedes noch so große Problem hätte gelöst werden können, als es klein war!«
Laotze (chinesischer Philosoph)
Krisen, Notfälle und Katastrophen
Notfälle können Krisen auslösen und Krisen können in einer Katastrophe gipfeln, die dann zahllose Notfälle beinhaltet. Beides sind Situationen, die ein umsichtiges und möglichst auch schnelles Agieren erfordern. Sie unterscheiden sich aber gravierend im Hinblick auf die Dauer und den Umfang einer Lösungsumsetzung.
Wenn wir den Begriff Krise beschreiben, ist die Definition immer eng damit verbunden, welche Auswirkungen eine Situation haben würde und ob diese das Potenzial hat, negativ auf Einzelne, auf Organisationen oder Unternehmen oder gar auf die gesellschaftliche Struktur eines Landes einzuwirken.
Leider aber auch, ob die Situation das Potenzial hat, über die eigenen Landesgrenzen hinaus noch zu eskalieren, und in einem Kriegsfall zwischen zwei oder mehreren Staaten mündet.
Die Blickrichtung über die eigenen Landesgrenzen hinaus könnte unter Umständen auch erkennen lassen, ob es in den politischen Abläufen anderer Staaten ein solch großes Konfliktpotenzial gibt, das schlussendlich das eigene Land in eine Eskalationssituation zwingt.
Krisen haben als Unterscheidungsmerkmal zu Notfällen immer eine gewisse Langfristigkeit, denn sie können Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Es gibt sogar den Ausdruck »Dauerkrise«, wie dieser zum Beispiel auf die stets schwelende Konfliktsituation zwischen Taiwan und der Volksrepublik China anzuwenden ist – auch wenn dies eine aus westlicher Sicht recht einseitige Stimulanz hat.
Aber diese beispielhafte Dauerkrise beinhaltet wiederum etwas, was man auch als Krisenkomplexität verschlagworten kann. Denn hierbei handelt es sich um vielschichtige und miteinander verwobene Themen, die auch außerhalb der reinen Besitzansprüche eines Landes angesiedelt sind.
Denn die Ursache dieser speziellen Dauerkrise liegt in der Geschichte der chinesischen Revolution und dem sich daraus ergebenden Bürgerkrieg zwischen der roten Armee (Mao Zedong) und der Kuomintag-Partei (Tschiang Kai Shek).
Ebenfalls als Synonym einer Krise kann man die anzuwendende Lösungsstrategie betrachten, denn diese beinhaltet meist eine umfassende Vorgehensweise und ist tunlichst drauf angelegt, eine langfristige Lösung zu bieten, die keine Wiederholung erfährt.
Auch bezogen auf ihre Auswirkungen lassen sich Krisen recht klar definieren. Denn egal ob es sich um eine politische, eine soziale und/oder um eine wirtschaftliche Krise handelt, die eventuellen Auswirkungen können tiefgreifend und entweder negativ oder auch positiv zu nachhaltigen Veränderungen führen.
Ein Notfall hingegen ist eine unmittelbar aufschlagende Situation, deren Lösung und Entschärfung nur durch eine sofortige Maßnahme erfolgen kann.
Nach unmittelbarer Beruhigung durch eine entsprechende Aktion in der jeweiligen Situation sind meist keine weiteren Maßnahmen mehr notwendig.
Somit wird bei einem Notfall, der ja immer die (Aus-)Wirkung einer Ursache ist, die Wirkung behoben, ohne die Ursache zukünftig ganz ausschließen zu können (Beispiel: Verkehrsunfälle).
Resümierend lässt sich also festhalten, dass Notfälle immer akut sind, während Krisen meist in ihrer Auswirkung eine langfristige Komponente haben.
Um auf Notfälle zeitnah reagieren zu können, in der Regel also sofort und kurzfristig, sind gänzlich andere Maßnahmen erforderlich als in einem Krisenfall, der zumeist eine längerfristige Komponente hat.
Weil die Vorgehensweisen unterschiedlich sind, ist es wesentlich, die Unterscheidung glasklar vornehmen zu können, um mit der richtigen Strategie auf die Situation antworten zu können.
Der Begriff der Krise aus unterschiedlichen Perspektiven
Da unser Thema die Krisenkommunikation ist, müssen wir so eindeutig wie möglich definieren, was in den unterschiedlichsten Bereichen als Krise bewertet wird.
Das Wort Krise kommt aus der griechischen Sprache (»Krisis«) und hat dort die Bedeutung: »die Entscheidung, das Urteil«.
Zugang in die deutsche Sprache fand das Wort ab dem 16. Jahrhundert – zunächst nur im medizinischen Bereich, in dem es den Höhepunkt respektive den Wendepunkt, dann jedoch zu einem besseren Verlauf, einer Krankheit beschrieb.
Ab dem 18. Jahrhundert etablierte sich dieser Begriff dann allmählich im allgemeinen Sprachgebrauch und wurde dort ein wenig zweckentfremdet, um eine »schwierige Situation« zu beschreiben.
War diese Zuschreibung damalig noch fast eindeutig, ist er inzwischen für viele Beschreibungen gebräuchlich, so dass wir hier einige mögliche Interpretationen aufzeigen müssen.
Konsens dürfte sein: Krisen können als Störungen aufgefasst werden. Sie sind eine Unterbrechung eines vormals geordneten, regelmäßigen Zustands1 und stellen ein Ereignis dar, welches im Folgenden die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Aus dem sozialen Blickwinkel sind Krisen die (Aus-)Wirkungen nicht gelöster Konflikte. Aus dieser Sicht entstehen Krisen durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Standpunkte.
In der Betriebswirtschaft bezieht sich der Begriff der Krise im Allgemeinen auf ein betriebswirtschaftliches Versagen eines Unternehmens, welches in der Folge dazu führen kann, das Unternehmen nachhaltig zu schwächen und/oder substanziell zu gefährden.
Auch der Begriff der Imagekrise wird in diesem Bereich verortet, da die Auswirkungen einer Imagekrise ebenso zu substanziellen Problemen führen können.
In dem betriebswirtschaftlichen Teilbereich Marketing und Publik Relations, zu dem dann auch der Bereich Unternehmenskommunikation gehört, wird der Begriff Krise etwas anders betrachtet, zumal hier ja auch die Krisenkommunikation als Feuerlöscher des Brandherdes einer Krise betrachtet wird, die verhindern soll, dass es zu einem Flächenbrand kommt.
Als Krisenauslöser werden betrachtet: menschliches Versagen, Verunreinigung von Lebensmitteln, Produktionsfehler, gravierende Schädigung der Umwelt, Störfälle, Erpressungen, Produktionsfehler, Aktionen feindlicher Interessengruppen, Datenverlust, Dateninfiltrationen, IT-Ausfälle, Korruptionsvorwürfe, Verstöße gegen den Datenschutz, Unterlaufen der internen Compliance-Bestimmungen mit externer Relevanz.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht wird der Begriff Krise hauptsächlich in Verbindung mit einer Konjunkturabschwächung im Sinne einer Depression verwendet.
Werden Krisen nicht gelöst und entwickeln sie sich dynamisch, kann eine Krise in einer »Katastrophe« münden. Auch dieses Wort hat seinen griechischen Ursprung und bedeutet: »das Umwenden, Zerstören, Unterjochen.«
Für viele Menschen ist zunächst noch (etwas nebulös) die Künstliche Intelligenz (KI) etwas, was in seinen Auswirkungen das Potenzial für eine zukünftige Krise haben könnte.
Für diejenigen, die sich qua Beruf schon damit auseinandergesetzt haben, birgt die Nutzung der KI zunächst einmal einen zeitlichen und in Verbindung damit einen Recherche-Vorteil.
Dass die Möglichkeiten, die eine KI bieten kann, momentan noch nicht zu überblicken sind, der Gesetzgeber aber schon bei Fuß steht, um das Schlimmste zu verhindern, deutet für die Zukunft auf einen interessanten Wettlauf hin.





























