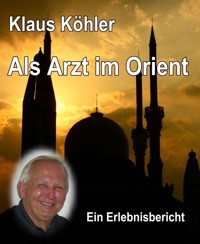Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch spricht drei Gruppen an: • Berufstätige im Umfeld Buchhaltung und Controlling, die Ambitionen haben, sich praktische Grundkenntnisse der Finanzierung aneignen wollen. • Studenten, die Finanzierung im Bachelor oder Masterstudiengang als Pflichtfachbelegen müssen, also keine Berufsausrichtung auf Finanzierung haben. Des Weiteren soll aber auch • Berufstätigen, die schon Vorkenntnisse aus Finanzierung oder Accounting mitbringen, • Studenten, die Finanzwirtschaft im Studium als Orientierungsphase ansehen und daher den Wunsch nach vertiefter Kenntnis haben, um sich ein Bild über eine mögliche Zukunft in der Finanzwelt zu bekommen. Fachliche Voraussetzung für dieses Buch: Sie sollten Accountingkenntnisse mitbringen, die Ihnen ermöglichen, eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu lesen. Das Buch ist kein Kompendium der Finanzwirtschaft, sondern eine gesunde Mischung aus praktischen Übungen und unternehmensrelevanten Finanzierungsfragen. Der Autor verzichtet bewusst auf ein umfassendes Modell der Finanzwirtschaft, das haben andere vor ihm schon viel besser gemacht. Orientierung im Buch: Da das Buch keine Einführung und umfassende Grundlagendarstellung ist, dient ein umfangsreicher Glossar – im Text unter ₲ zu erkennen--, und das Wortregister als Orientierung. Abkürzungen werden bei der erstmaligen Verwendung erläutert und sind dann im Abkürzungsverzeichnis zu finden. Vertiefung oder auch nicht Der Autor verzichtet bewusst auf Herleitung von Formeln und Modellen; er verzichtet auch weitgehend auf wirtschaftsmathematische Klimmzüge, so dass wir uns hier im Wesentlichen auf die vier Grundrechenarten beschränken werden. Alternativ zu der Zeitvertreib mit komplizierten mathematischen Modell gibt der Autor immer wieder Hinweise auf Berechnungen mit EXCEL bzw. bietet an, von Screenshots auf Anfrage die Tabelle zur Verfügung zu stellen. Institutionslehre, Steueraspekte und Rechtsgrundlagen entfallen. Da der Autor ausgewiesener Finanzwirtschaftler ist, steht er auf dem Standpunkt, dass die Lösungen zu den täglichen Entscheidungen der Liquiditätsplanung und die Parameter der Finanzplanung nur in seltenen Fällen im Steuer- oder Gesellschaftsrecht zu finden sind. Diese Entscheidung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Themen des Buches
Gebrauch des Buches
Persönliche Voraussetzung der Leser (wichtig!)
FINANZIERUNG
ANLEIHE -- das Wichtigste aus Sicht der Finanzabteilung
RATIOS – Die wichtigsten verstehen und berechnen
INVESTITIONSRECHNUNG
.
SICHERUNGSGESCHÄFTE (PUT, Straddle, CAPS, COLLAR, SWAPS)
ÜBUNGSTEIL zu diversen Themen der Finanzierung
ÜBUNGSTEIL zur Investitionsrechnung
GLOASSAR
Urheberklausel:
Die Veröffentlichungen auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Vervielfältigung, Bearbeitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der Zustimmung des Verfassers.
Sämtliche Texte, Bilder und andere Informationen unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - dem Copyright des Verfassers. Jede Speicherung, Vervielfältigung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Verfasser erlaubt.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Sollten Sie Inhalte meines Buches übernehmen wollen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Gebrauch des Buches
Persönliche Voraussetzung der Leser (wichtig!)
Basisannahmen für im Buch aufgezeigten Fallbeispiele /Study cases
FINANZIERUNG
Grundbegriffe Ihr kleines Basiswörterbuch
Finanzierung
Liquidität
Rentabilität
Risiko
Aktivierung
Finanzmarketing
Net working capital (Bilanzsicht) (deutsch: Nettoumlaufvermögen)
Grundgedanken, Basismotive und Standardüberlegungen zu Finanzierung
Das magische Dreieck der Finanzwirtschaft
EXKURS für alle Entrepreneur zum Thema Insolvenz
Cash Cycle (Kapitalbedarfsrechnung)
Finanzplanung – Überlegungen und Organisation
Extremfall der Cash Cycle Finanzierung: Export
Außenhandelsfinanzierung, hier Akkreditiv
Funktion eines Akkreditivs!
Finanzierungseffekte aus Akkreditiv
Die Bilanz als Abbild des Cash Cycle und als „Fristen-Waage“
Kapitalbegriffe:
Die Goldene Finanzregel (Fristenkongruenz)
Working Capital
Working Capital als Maßstab der Liquidität
Working Capital als Finanzierungsbedarf
Working Capital Management
INNENFINANZIERUNG
Selbstfinanzierung
Finanzierung aus Abschreibungen
Sale &lease/ rent back
Innenfinanzierungsvolumen
Wie baut man eine Kapitalflussrechnung auf?
Warum ist eine Kapitalflussrechnung so aufgebaut?
Kapitalflussrechnung der „Alles nicht so schlimm AG“
„moderne Kapitalflussrechnungen“
AUßENFINANZIERUNG
Der Leverage Effekt
Forderungsmanagement
Arten des Kreditrisikos
Factoring
Welche drei Funktionen kann der Faktor übernehmen?
„Betriebswirtschaftliche“ Aspekt des Factorings
Kurzfristige Handelskredite, zinslose Verbindlichkeiten
Lieferantenkredite
BREAK Themenwechsel von Innen-zur Außenfinanzierung
Finanzplanung
Kapitalerhöhungen, Außenfinanzierung durch EK-Geber
Finanzierungseffekt
Verwässerungseffekt:
Bedeutung des Bezugsrechts
Gratisaktien was ist denn daran gratis?
Ausschluss des Bezugsrechts
ABS- Finanzierung
Asset Backed Security ist eine besondere Form der Verbriefung:
Funktionsweise der ABS
Rolle der ABS in der aktuellen Finanzkrise
Chancen und Risiken der ABS
Mezzanine Kapitalstrukturen
ANLEIHE -- das Wichtigste aus Sicht der Finanzabteilung
Grundbegriffe, Definition, Refresher
Laufende Verzinsung
Rendite
Warum schwanken die Anleihen-Kurse?
Welche Faktoren beeinflussen die Rendite?
Rendite-Berechnung:
Welche Kennzahlen sind bei Anleihen gebräuchlich?
Stammdaten:
Merkmale von Anleihen
Kennzahlen:
Anleihen als Anlageform als Alternative zu Monatsgeldern
EXKURS: Vertiefung zum Thema Anleiheformen.
Messung des Anleihenrisikos: Was beschreibt die Duration?
Zinsstrukturkurve – Modellberechnung und Verwendung
Zinsstrukturkurve, spot rate, marktgerechte Bewertung
WANDELANLEIHE
Vorteile für den Emittenten:
Nachteile für den Emittenten:
Vorteile für den Anleger:
Nachteile für den Anleger:
Pflichtwandelanleihe
Contingent Convertible Bond (CoCo-Bond)
Wandelangebote mit konkreten Emissionsbedingungen
EXKURS: Bewertung von Anleihen -- Das Ingersoll-Modell
Optionsanleihen
Ein einfacher Fall, KK-AG begibt eine Optionsanleihe
Rating
Ziel/ Zweck eines Ratings:
Prozess
Pfleiderers Hybrid-Anleihe Gutes spekulatives Rating
EB … EB … EB … und immer wieder EB!
EB … EB … EB … und immer wieder EB! – Vertiefung--
RATIOS – Die wichtigsten verstehen und berechnen
FALLBEISPIEL für einen Covenants Kreditvertrag
a) Verschuldungsgrad
b) Zinsdeckungsgrad (ISC, interest service cover ratio)
c) Fix charge cover (FCC)
d) Eigenkapital-Quote
INVESTITIONSRECHNUNG
Investition
Einführung in die Investitionsrechnung
Zusammenhang von Kapitalwert, Annuität, und internem Zinsfuß
EXKURS: Finanzierung von Immobilien über Annuitätendarlehen
Wahl zwischen Anlagealternativen, Anleihen, 20.000€
Höchstgebot
Unternehmer Be Gin sucht einen Financier
.
SICHERUNGSGESCHÄFTE (PUT, Straddle, CAPS, COLLAR, SWAPS)
Termingeschäfte
Zinssicherungsgeschäfte – Vertiefung 2. Grades
Zusammenhang zwischen Spot Rates Forward Rates und Zerobondrenditen
Forward Rate Agreement (FRA) – Kalkulation
Gezieltes Zinsmanagement
Collar
Zins-Collar
SPEZIALTHEMA: Bilanzeffekte von Hedgegeschäften
Zinsswap fest in variabel (Fair Value-Hedge)
_
211
Sicherung einer Zinsobergrenze durch Abschluss eines Cap
Einzel- + Konzernabschluss: Konzerninterne Fremdwährungsdarlehen mit Devisenkurssicherung
Devisenkurssicherung einer Auslandsbeteiligung nach HGB und IFRS
ÜBUNGSTEIL zu diversen Themen der Finanzierung
Innenfinanzierungsvolumen/ Kapitalflussrechnung /Cash-Flow
Leverage
Duration
Duration im Vergleich von drei Anleihen
Wertverlust bei Anstieg des Renditeniveaus – Kursrechnung per EXCEL
Berechnung der Rendite eines „Kurzläufers“ als Alternative zum Tagesgeld
Kapitalerhöhung und Bezugsrechtswert und Bilanzeffekte
Kauf einer Wandelanleihe der „Übs-AG“
Zins SWAP-Geschäft
Rohstoffpreis-Absicherung, CAP &COLLAR
ÜBUNGSTEIL zur Investitionsrechnung
Wahl zwischen Anlagealternativen, 30.000€, KMZ 4%
Unternehmer Be Gin sucht einen Financier
Höchstgebot
Fitness Raum für den 1. FC Düsseldorf
Rauchen macht reich, oder auch nicht …
Unterhalt
Allgemeine Lösung
Zeitsoldat bereitet sein Leben nach der Armee in 8 Jahren vor
Anlagen: Faktortabellen
Rentenbarwertfaktoren:
Annuitätenfaktoren
Endwertfaktoren
GLOASSAR
ABS Asset Backed Security
Aktivierung
Bezugsrecht
Cash Cycle (Kapitalbedarfsrechnung)
DSO Days Sales Outstanding
Duration:
Dynamische Verschuldungsgrad:
Factoring
Finanzierung
Finanzierung aus Abschreibungen
Finanzmarketing
Fix charge cover (FCC)
Free Cash-Flow
Fristenkongruenz, Die Goldene Finanzregel
Innenfinanzierung
Investition
Kreditrisiko
Leverage
Liquidität
Net Working Capital
Pensionsrückstellungen
Rentabilität
Risiko
Sale &lease/ Rent back
Selbstfinanzierung
Verschuldungsgrad
Zinsänderungsrisiko
Zinskurvenrisiko
Zinsdeckungsgrad (ISC, interest service cover ratio)
Gebrauch des Buches
Das vorliegende Buch spricht drei Gruppen an:
Berufstätige im Umfeld Buchhaltung und Controlling, die Ambitionen haben, sich praktische Grundkenntnisse der Finanzierung aneignen wollen.
Studenten, die Finanzierung im Bachelor oder Masterstudiengang als Pflichtfachbelegen müssen, also keine Berufsausrichtung auf Finanzierung haben.
Des Weiteren soll aber auch
Berufstätigen, die schon Vorkenntnisse aus Finanzierung oder Accounting mitbringen,
Studenten, die Finanzwirtschaft im Studium als Orientierungsphase ansehen und daher den Wunsch nach vertiefter Kenntnis haben, um sich ein Bild über eine mögliche Zukunft in der Finanzwelt zu bekommen.
Fachliche Voraussetzung für dieses Buch:
Sie sollten Accountingkenntnisse mitbringen, die Ihnen ermöglichen, eine Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung zu lesen.
Das Buch ist kein Kompendium der Finanzwirtschaft, sondern eine gesunde Mischung aus praktischen Übungen und unternehmensrelevanten Finanzierungsfragen.
Der Autor verzichtet bewusst auf ein umfassendes Modell der Finanzwirtschaft, das haben andere vor ihm schon viel besser gemacht.
Orientierung im Buch:
Da das Buch keine Einführung und umfassende Grundlagendarstellung ist, dient ein umfangsreicher Glossar – im Text unter zu erkennen--, und das Wortregister als Orientierung.
Abkürzungen werden bei der erstmaligen Verwendung erläutert und sind dann im AKüVer (Abkürzungsverzeichnis) zu finden.
Anglizismen
Die Finanzsprache in den Unternehmen wird zunehmend englisch (für manche Begriffe haben sich gar nicht erst deutsche Begriffe entwickelt z.B. Leverage-Effekt); daher sollten Sie sich an die Fachtermini gewöhnen und sie zu verwenden wissen.
Vertiefung oder auch nicht
Der Autor verzichtet bewusst auf Herleitung von Formeln und Modellen; er verzichtet auch weitgehend auf wirtschaftsmathematische Klimmzüge, so dass wir uns hier im Wesentlichen auf die vier Grundrechenarten beschränken werden. Alternativ zu der Zeitvertreib mit komplizierten mathematischen Modell gibt der Autor immer wieder Hinweise auf Berechnungen mit EXCEL bzw. bietet an, von Screenshots auf Anfrage die Tabelle zur Verfügung zu stellen.
Institutionslehre, Steueraspekte und Rechtsgrundlagen entfallen
Da der Autor ausgewiesener Finanzwirtschaftler ist, steht er auf dem Standpunkt, dass die Lösungen zu den täglichen Entscheidungen der Liquiditätsplanung und die Parameter der Finanzplanung nur in seltenen Fällen im Steuer- oder Gesellschaftsrecht zu finden sind. Diese Entscheidungen werden vorher in anderen Gremien getroffen; daher finden diese Kriterien nur bei der grundsätzlichen Betrachtung von Risiken und den daraus resultierende Zinseffekten Niederschlag in der Darstellung.
Ziel des Buches:
Sowohl Berufstätige als auch Berufseinsteiger in Form von Studenten der BA und MA-Studiengänge sollen hier sehr gezielt an die praktischen Themen der Finanzwirtschaft herangeführt werden. Das Buch soll dem Leser die Chance zu geben,
sich gezielt auf neue Aufgaben vorzubereiten,
die ökonomischen Ideen und Ziele der verschiedenen Instrumente und Berechnungen zu erkennen,
ein gerütteltes Maß an Wissen vermittelt bekommen,
sich über Vertiefungen ein gesundes Halbwissen anzueignen, das ihm auch helfen kann, irgendwann interdisziplinäre Aufgaben im Unternehmen wahrzunehmen.
Es werden vor allem zahlungsrelevante Finanzierungsaktivitäten und –instrumente aufgezeigt mit ihren jeweiligen
Motiven der Beteiligten,
den Risiken und Chancen und
Vor- und Nachteilen.
Persönliche Voraussetzung der Leser (wichtig!)
Das vorliegende Buch gibt für Sie als Leser nur dann Sinn, wenn Sie bereit sind,
sich auf eine neue Sprache einzulassen,
einen gesunden Ehrgeiz mitbringen, die eine oder andere Rechnung selbst zu versuchen oder zumindest nachzuvollziehen,
sich auf ein Bau-Kastensystem einzulassen.
Denn –anders als Buchhaltung, die Ihnen „zur Belohnung“ (dass Sie Sie alles verstanden haben!), eine „Bilanz schenkt“, hat Finanzwirtschaft nur einen gemeinsamen Nenner in ihren Themen: CASH. Die vielen Puzzleteile ergeben auch am Ende kein Aha-Erlebnis der Art: „Jetzt habe ich alles verstanden!“
Die Finanz-Menschen lehnen sich bei ihrem eigenen Selbstverständnis in ihrem Wording an die Ingenieure an: man spricht bei der Gestaltung der Unternehmensfinanzierung auch von Finance Engineering.
Sie bekommen also mit dem vorliegenden Buch einen modernen Werkzeugkasten an die Hand, der Ihnen --je nach Lage und Mittel—dazu verhilft, mit ihren Partner im Finanzgeschäft (Banken, Gesellschafter, Lieferanten, Kunden) eine gute Lösung für ihr Unternehmen zu finden.
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1 EZB-Zinsen
Abbildung 2 Libor Sätze Dezember 2013
Abbildung 3 Übersicht der Finanzierungsarten,
Abbildung 4 Working capital als Ausdruck des Produktprozesses
Abbildung 5 Berechnungsformel des Days working capitals (DWC)
Abbildung 6 graphische Darstellung der Ergebnisse (DWC)
Abbildung 7 Budgetphase 1
Abbildung 8 Budgetphasen
Abbildung 9 Verzahnung der Unternehmensteilpläne zu einem Finanzplan
Abbildung 10 Grundschema eines Akkreditivs
Abbildung 11 Rudimentäre Struktur Bilanz
Abbildung 12 Kapitalbegriffe in der Bilanz
Abbildung 14 Vergleich Sale &Lease-back mit Mezzanine Lenders
Abbildung 15 Die 4 Quellen der Innenfinanzierung
Abbildung 16 Bilanz der start-up AG
Abbildung 17 Kapitalflussrechnung der start-up-AG
Abbildung 18 Cash Flow aus Investitionstätigkeit
Abbildung 19 Ermittlung des Free-Cash-Flows
Abbildung 20 Bilanz der „Alles nicht so schlimm AG“
Abbildung 21 Kapitalflussrechnung der „Alles nicht so schlimm AG“
Abbildung 22 Moderne CFS, Private Equity Struktur
Abbildung 23 Modernen CFS, Kapitalflussrechnung Covenants-getriebene KFR:
Abbildung 24 Entwicklung der Leverage Formel
Abbildung 25 Kreditrisikotransfer von Forderungspools
Abbildung 27 Marktanteile von Kreditversicherern in Dtld. 2010
Abbildung 28 Weltmarktanteile der Kreditversicherer in 2010
Abbildung 29 Leistungen der Kreditversicherung für Export-Unternehmen
Abbildung 30 Lieferanten machen das Licht bei Weltbild aus
Abbildung 31 Ausschluss von Forderungen im Factoring
Abbildung 32 Darstellung der Skontofrist
Abbildung 33 Kapitalbedarf nach kumulativer und elektiver Methode
Abbildung 34 Grafische Darstellung ABS
Abbildung 35 Stille Beteiligung als Mezzanine, Merkmale
Abbildung 36 Effektivzinsberechnung nach ISMA, in EXCEL
Abbildung 37 EXCEL Rendite Berechnung
Abbildung 38 EXCEL Formel RENDITE, EFFEKTIV &RENDITEFÄLL, Vergleich
Abbildung 39 Berechnung eines Anleihe-Kaufkurses bei gegebener Rendite (EXCEL- FORMEL-KURS(...)im Vergleich zur manuellen Berechnung
Abbildung 40 Anleihe, EXCEL „UNREGER.KURS“, Stückzinsen, Rendite
Abbildung 41 "Kurzläufer" als "alternatives" Monatsgeld
Abbildung 42 Anlegerrendite versus Fremdkapitalkosten
Abbildung 43 Beispiel für Anlegerrendite vs. FK-Zinsaufwand, stitch-in-time Ltd
Abbildung 44 Kurzläufer, Renditen, Notierung Jan. 2014
Abbildung 45 Durationsberechnung mit EXCEL
Abbildung 46 Durationsberechnung manuell
Abbildung 48 Geldmarktsätze der Deutschen Bundesbank EURIBOR und EONIA
Abbildung 49 Idee der Forward Rate anhand von Zahlungsströmen
Abbildung 50 Berechnung von Forward Rates mit EXCEL
Abbildung 51 Zinssicherung für die Zukunft für Anleger
Abbildung 52 Mindest-Kurs Wandelanleihe ohne Wandelrecht über 10 Jahre
Abbildung 53 Entwicklung des Wandel-Anleihe-Kurs bei steigendem Aktienkurs
Abbildung 54 Theoretischer der Bezugsrechte bei Emission einer Optionsanleihe
Abbildung 55 Risikozuschläge für Fremdkapital nach Bonität
Abbildung 56 Referenzanleihen und Risikozuschläge bei Emission
Abbildung 57 Struktur GuV, Gesamtkostenverfahren
Abbildung 58 Covenants, häufigsten Kennzahlen (ratios)
Abbildung 59 Vorgabe &Berechnung eines EXCESS Cash Flows
Abbildung 60 Eigenmittel und Nettoverschuldung laut Covenant Vertrag
Abbildung 61 Berechnung eines Verschuldungsgrad mit covenant Verletzung
Abbildung 62 Vertragsklauseln -> Fix Charge Cover, EK-quote, Investitionsgrenze
Abbildung 63 Berechnung eines Fixed Charge Cover
Abbildung 64 Vertragsklausel zur Berechnung der Eigenmittel
Abbildung 65 Eigenmittelberechnung lt. Covenant-Klausel
Abbildung 66 Verlauf eines Rentenauszahlungsplans über 15 Jahre
Abbildung 67 Darstellung eines Ansparplans über 41 Jahre
Abbildung 68 Berechnung des internen Zins mit EXCEL-IKV(..)
Abbildung 69 Entnahme der internen Verzinsung führt zum KW=0
Abbildung 70 Verlauf eines Annuitätendarlehen über 42 Jahre,
Abbildung 71 Annuitätendarlehen 2 % Tilgung, 4% Zinsen, 29 Jahre Kontostaffel, Monatsrate 1.500€
Abbildung 72 Annuität Darlehen, 2% Tilgung, rd.7% Zins, Kontostaffel 23 Jahre
Abbildung 73 Kontostaffel einer Annuitäten-Anleihe über 8 Jahre mit 7%
Abbildung 74 Mindestrendite Zahlung an Investor
Abbildung 75 Motive für Abschluss eines FRA
Abbildung 76 variable Finanzierung und passender FRA
Abbildung 77 Berechnung einer Ausgleichszahlung bei einem FRAU
Abbildung 78 Szenario zum Zins-Collar
Abbildung 79 Übung zur Kapitalflussrechnung
Abbildung 80 Lösung zur Übung Cash-Flow Rechnung / Statement
Abbildung 81 Lösung Anlegerrendite versus Fremdkapitalkosten, 10-J-Anleihe
Abbildung 82 Berechnung des Wertverlustes bei Renditeänderungen
Abbildung 83 Rendite-Berechnung eines Kurzläufers
Abbildung 84 Ertragslage beim Abschluss eines Collars versus put-Option
Abbildung 85 Gewinnsituation bei einem Collar-Hedge
Abbildung 86 Rentenbarwertfaktoren, über 41 Jahre, bis 10%
Abbildung 87 Annuitätenfaktoren, über 44 Jahre, bis 10%
Abbildung 88 Endwertfaktoren über 44 Jahre bis 8%
Abbildung 89 Kapitalflussrechnung Nach SR 10
Literaturverzeichnis:
Die folgende Literatur soll weniger der Nachweis wissenschaftlicher Quellen dienen, sondern dem Leser des vorliegenden Buchs gezielt das Angebot machen, einen sinnvollen theoretischen Überbau zu ergänzen. Die beiden Bücher konzentrieren sich auf die moderne Finanzierungslehre.
Becker, H. P., Investition und Finanzierung, 2. Aufl., Gabler 2008
Grunow, Figgener, Handbuch Moderne Unternehmensfinanzierung, Springer 2006
Hartmann-Wendels (2008). Asset Backed Securities und die internationale Finanzkrise.
In: Das Wirtschaftsstudium S. 690 – 694.
Die wichtigsten Abkürzungen:
Basisannahmen für im Buch aufgezeigten Fallbeispiele /Study cases
Man sollte bei den beschriebenen Szenarien des vorliegenden Buchs im „Hinterkopf“ die aktuelle Zinssituation haben. Auch wenn für Unternehmen der Leitzins keine echte Indikation für den eigenen Kreditzins ist, da sie selten die Bonität der Banken aufweisen, wird aber deutlich, dass wir eine historische Tiefzinsphase erreicht haben.
EUR LIBOR Zinssatz - Europäischer Euro LIBOR
Der Europäische Euro LIBOR (bbalibor) Zinssatz ist der durchschnittliche Interbankenzinssatz, zu dem eine große Anzahl von Banken auf dem Londoner Geldmarkt bereit ist, einander unbesicherte Kredite in Euros zu gewähren. Den Europäischer Euro (EUR) LIBOR Zinssatz gibt es für 7 Laufzeiten: von Overnight (auf Tagesbasis) bis 12 Monate. In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über alle EUR LIBOR Zinssätze. Diese Zinssätze werden von uns täglich aktualisiert. Wenn Sie einen Link anklicken, erhalten Sie von der jeweiligen Laufzeit ausführliche aktuelle und historische Informationen.
Der Euro LIBOR Zinssatz gilt als Basiszins für allerlei andere Produkte wie Sparkonten, Hypotheken und Kredite.Im vorliegenden Buch ist der LIBOR der Basiszinssatz für SWAP-Geschäfte
Außer des Europäischen Euro LIBOR kennen wir noch LIBOR Zinssätze in vier anderen Währungen, hier nur in EURO:
EUR03-03-1428-02-1427-02-1426-02-1425-02-14
LIBOR Euro - overnight 0,09714 % 0,16857 % 0,09500 % 0,09500 % 0,09071 %
LIBOR Euro - 1 Monat 0,19714 % 0,19714 % 0,19714 % 0,19714 % 0,19714 %
LIBOR Euro - 2 Monate 0,22857 % 0,22714 % 0,22500 % 0,22571 % 0,22571 %
LIBOR Euro - 3 Monate 0,26000 % 0,26143 % 0,26000 % 0,26143 % 0,26143 %
LIBOR Euro - 6 Monate 0,34643 % 0,34429 % 0,33929 % 0,34286 % 0,33714 %
LIBOR Euro - 12 Monate 0,51457 % 0,51386 % 0,51000 % 0,51386 % 0,51243 %
FINANZIERUNG
Grundbegriffe Ihr kleines Basiswörterbuch
Die folgende Definition wird vom Autor im vorliegenden Buch verwendet und begleitet Sie wie ein Axiom1:
Finanzierung
unmittelbare Erhöhung
der liquiden Mittel
im Unternehmen
führen. Dazu gehört auch, Auszahlungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Sie erkennen hier deutlich, dass Finanzierung im engeren Sinne nichts mit Investition zu tun hat; dass eine Investition Auslöser für Finanzierungsaktivitäten sein kann, heißt eben nicht, dass dieser Zusammenhang immer gegeben sein muss. Im Unternehmen erkennen Sie diesen fehlenden, unmittelbaren Zusammenhang daran, dass die Entscheidungen für beide Aktivitäten (Mittelherkunft und –verwendung) in unterschiedlichen Gremien bzw. Abteilungen gefällt werden.
Liquidität
Hier: Finanzwirtschaftliche Betrachtung; leider gibt es drei Begriffsinhalte, die zwar alle nahe beieinanderliegen, aber in unterschiedlichen Zusammenhänge genutzt werden:
Bestand an Geld- und Vermögenswerten, die bei Bedarf in Geld gewandelt werden können. Zu den flüssigen Mitteln gehören:
Kassenbestände,
Bank- und Postgiroguthaben,
Wechsel (soweit sie diskontfähig sind),
Schecks und
(börsengängige) Wertpapiere
Rentabilität
Allgemein: Relation jeder Art von Ergebnisgröße zu einer Bezugsgröße
Bezugsgrößen für Relationen können sein:
Eigen-, Fremd-oder Gesamtkapital,
Umsatz
Die verschiedenen Brüche werden oft als „ratio“ oder auch „margin“ bezeichnet; dabei sind die wesentlich wie folgt:
Risiko
Finanzrisiken sind solche, die aus Veränderungen von Prozessen, Strukturen und Regeln auf Finanzmärkten (also Märkten für Zahlungsströme) resultieren und sich z. B. in vertragswidrigem Zahlungsverhalten von Schuldnern, unerwarteten Wertpapier- oder Wechselkursänderungen oder knapper Liquidität niederschlagen.
Im Bereich des finanziellen Risikomanagements lassen sich hierunter wie gesehen folgende Risikoarten fassen:
Liquiditätsrisiko heißt die Gefahr von Zielverfehlungen infolge einer unzureichenden Ausstattung mit Zahlungsmitteln.
Kreditrisiko bezeichnet die Gefahr von gläubigerseitigen Zielverfehlungen dadurch, dass ein Schuldner nicht mehr in der Lage ist, seinen Kapitaldienstverpflichtungen nachzukommen oder dass sich seine dahingehende Kreditwürdigkeit graduell verschlechtert hat; soweit es sich bei ihm um einen souveränen Staat handelt, liegt ein Länderrisiko vor.
Marktpreisrisiken bestehen in Zielverfehlungen infolge von ungeplanten Mehrausgaben für den Erhalt bzw. aus dem Absatz bestimmter Leistungsbündel durch gestiegene Beschaffungs- bzw. gesunkene Absatzpreise.
Operationelle Risiken schließlich resultieren aus fehlerhaften Systemen, Prozessen oder auch menschlichen Handlungen innerhalb einer Unternehmung.
Da das vorliegende Buch keine Vorlage für das Riskmanagement des Gesamt- Unternehmens werden soll, beschränken wir uns daher hier auf die zuvor genannten Risiken.
Aktivierung
In der Finanzwirtschaft ist dieser Begriff unmittelbar mit „Ergebnisgestaltung“ (genau: Ergebnisverbesserung) in Ihrem Bewusstsein zu verankern. Ohne Sie hier mit den Untiefen der Buchhaltung zu verwirren, verankern Sie die Möglichkeit, dass man bestimmte – zunächst als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung gebuchte – Aufwendungen wieder eliminieren kann, in dem man Sie in die Bilanz auf der Aktivseite ausweist und über die Nutzungsdauer in Form von jährlichen Abschreibungen wieder in die Gewinn- und Verlustrechnung einbezieht.
Ziel ist es, einmalig –nämlich in dem Jahr der Aktivierung-- das Ergebnis zu verbessern mit dem Preis, in den kommenden Jahren höhere Abschreibungen zu haben.
Vertiefung für „Fortgeschrittene“:
Manchmal liegt das Ziel auch darin, sowohl im Jahr der Aktivierung als auch durch den Ausweis als zukünftige Abschreibung das EBITDA für alle Jahre zu verbessern.
Finanzmarketing
Berichte / Reports der Finanzabteilung haben keinen Selbstzweck; genau wie das Produkt-Marketing oder Employer-Branding haben die Berichte ein Ziel und sollen bei den Empfängern Verhalten und Einstellungsveränderungen bewirken.
Selbst die jährlichen, gesetzlich vorgeschrieben Jahresabschlüsse sollen im Rahmen ihrer Publikation beim Leser bestimmte Assoziationen und auslösen, Erwartungen bestätigen und auch Absichten und Ziele beeinflussen.
Informationsempfänger des finanzwirtschaftlichen Reports
Aktuelle Geldgeber (Gläubiger, Investoren),
Potentielle Geldgeber (Gläubiger, Investoren),
Betriebsrat,
Arbeitnehmer,
Staat (Finanzamt, Aufsichtsbehörden),
Wettbewerber,
Kunden,
Lieferanten.
Besonders kniffelig wird es, wenn die Ziele des Unternehmens bezüglich der einzelnen Empfängergruppen divergent sind. Klassische Zielkonflikte könnten sein:
- Ausweis niedriger Gewinne gegenüber dem Finanzamt (zwecks Zahlung niedriger Ertragssteuern
4
)
versus
- Ausweis hoher Gewinn gegenüber Banken und Eigenkapitalgebern (zwecks Nachweis guter Bonität)
oder
- Ausweis niedriger Gewinne gegenüber dem Betriebsrat (zwecks Argumentation bei Tarifverhandlungen)
versus
- Ausweis hoher Gewinn gegenüber Mitarbeitern (zwecks Selbstdarstellung als sicherer Arbeitgeber)
Net working capital (Bilanzsicht) (deutsch: Nettoumlaufvermögen)
Nach der indirekten Definition des § 247 HGB ist es die Summe der Werte derjenigen Vermögensgegenstände eines Unternehmens,
die
nicht
dazu bestimmt sind,
dauerhaft
im Unternehmen zu verbleiben, also Vermögensgegenstände,
die im Rahmen der Produktion verarbeitet werden,
die die Betriebsprozesse der Beschaffung, der Fertigung und des Absatzes durchlaufen sollen.
Aus beschafften Werkstoffen werden durch die Produktion fertige Erzeugnisse, die verkauften Erzeugnisse werden zu Forderungen gegenüber dem Kunden und nach Zahlung zu Geldvermögen in der Kasse oder auf dem Bankkonto.
Das Nettoumlaufvermögen (engl. net working capital) erlaubt es, den Nettofinanzbedarf zur Finanzierung kurzfristiger Aktiva zu ermitteln; es ist auch definiert als das Kapital, das für ein Unternehmen Umsatz generiert, ohne Kapitalkosten im engeren Sinne zu verursachen, da die Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Kurzfristige Rückstellungen (z.B. Tantiemen)
- Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (z.B. Lohnsteuerverbindlichkeit),
Zahllast aus UST-Verbindlichkeiten.
zinslos sind.
MEMO:
Ein negatives net working capital bedeutet, dass
… Lieferanten Umsätze vorfinanzieren,
… langfristiges Anlagevermögen kurzfristig finanziert wird. Bitte schauen Sie die Vertiefung im Kapitel Working Capital
Grundgedanken, Basismotive und Standardüberlegungen zu Finanzierung
Versetzen Sie sich in folgende einfache Situation:
Zwei Kollegen fragen Sie, nach einem kleinen Darlehen; Sie hätten das Geld zur Verfügung und würden vor folgender „Gemengelage“ stehen:
Kollege A ist seit vielen Jahren mit Ihnen im Unternehmen und hat regelmäßig Einkommen; er gibt Ihnen noch ein paar Informationen zu seinem wirtschaftlichen Hintergrund und auch einen Plan, wie er mit seinem verfügbaren Einkommen Ihnen das Geld zurückzahlen will.
Kollege B wird die Probezeit vorzeitig beenden und wird sich zunächst auf sein einziges Vermögensteil – eine kleine Finca auf Mallorca—zurückziehen. Er bietet Ihnen diese Finca mit einem Vielfachen Wert des Darlehens formlos als Sicherheit an und wird sich in Ruhe überlegen, wie er Ihnen das Geld zurückzahlt.
Welche Überlegungen stellen Sie?
… um es vorweg zu nehmen: Sie bewegen sich mit dieser Frage auf den Spuren eines klassischen Principal-agent-Verhältnisses, d.h. Sie stellen jetzt genau dieselben Überlegungen an, wie jedes Unternehmen, das eine Kreditbeziehung eingeht.
1. Frage: Welches Risiko gehe ich ein? Mein Kollege / Darlehensnehmer zahlt…
…nicht pünktlich
…keine Zinsen,
…überhaupt nicht zurück,
…in falscher Währung etc.
Welche Informationen kann ich zur Kreditwürdigkeit meins Kollegen bekommen, die mir bei meiner Entscheidungsfindung helfen?
Kann oder muss ich diese Informationen während des Kreditverhältnisses immer wieder abfragen? Welche „Druckmittel“ kann ich aufbauen?
Bin ich auf die pünktliche Zahlung angewiesen, weil ich die monatlichen Raten in mein eigenes Ausgabe-Budget einrechne? (Thema: Liquidität)
2. Frage: Wie ist meine Rendite? (Thema: Investitionsrechnung!)
Entspricht sie dem
Risiko
, das ich eingehe?
Sind die Alternativen (Anlage in Bundespapiere) besser?
3. Welche Möglichkeiten habe ich, mein Darlehensansprüche durchzusetzen?
Was muss ich tun, um meine Sicherheitsansprüche gegen den Darlehensnehmer oder andere Gläubiger durchsetzen zu können?
Wie muss ich die
Sicherheiten
bewerten?
…ein paar weitergehende Überlegungen:
Wenn Kollege A mich in seine Überlegungen zu seinem verfügbaren Einkommen einbezieht, sollte ich schon fragen, ob das von ihm geschätzte Einkommen „geschöpft“ (frei nach Dr. T. Sarazzin) oder robust nachhaltig ist. Denn nur ein nachhaltiges freies Einkommen (FREE-CASH-FLOW!) garantiert ein reibungsloses Kreditverhältnis.
Zum Thema Sicherheit: Jeder Kreditgeber zieht einen FREE-CASH-FLOW einer Sicherheit vor, denn schließlich ist es ja nicht Sinn eines Kreditverhältnisses, die Sicherheit zu verwerten, sondern durch regelmäßige Zahlungen Tilgungen und Rendite zu erwirtschaften. Und Sicherheiten „wasserdicht“ zu bestellen, d.h. juristisch eine Verwertung durchsetzbar zu machen, ist in vielen Fällen mit einem enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden, den es so lange wie möglich zu vermeiden gilt.
Das magische Dreieck der Finanzwirtschaft
(als Gegenentwurf zur Quadratur des Kreises in der Mathematik, nicht so komplex aber genauso unlösbar!)
Jedes Unternehmen ist gezwungen, eine stetige, „rollende“ Liquiditätsplanung durchzuführen, d.h. jederzeit einen Überblick zu haben, „wieviel Zahlungsmittel habe ich zur Verfügung, um meine eigenen, fälligen Schulden zahlen zu können“. Das ist keine Spielweise der Finanzcontroller, sondern existenziell für jedes Unternehmen, da eine Insolvenz mangels Zahlungsfähigkeit sofort zum Untergang des Unternehmens führt (medizinisch gesprochen: der Exitus des Unternehmenspatienten).
Ziel des finanziellen Gleichgewichts:
Rentabilitätsmaximierungso viel wie möglich!
Liquiditätspostulat (kurz- und langfristiges)so viel wie nötig!
Sicherheitspostulat (immer!)Notwendige Nebenbedingung!
… und das alles unter dem Damoklesschwert der Insolvenz!
Den Zustand der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners beschreibt die Insolvenzordnung in § 17 Abs. 2 InsO wie folgt: "Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen."
EXKURS für alle Entrepreneure zum Thema Insolvenz
und zukünftigen Organvertreter von Kapitalgesellschaften (Geschäftsführer und Vorstande von Aktiengesellschaft und GmbHen.
Um nochmals die Eindringlichkeit der Auswirkungen von Zahlungsunfähigkeit zu zeigen, hier ein paar praktische Hinweise für das Verhalten im „Notfall“:
Die Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens ist so lange gegeben, wie es im Stande ist, seinen Verpflichtungen gegenüber anderen zumindest in Höhe von 90% aller fällig werdenden Forderungen nachzukommen; wird also die Deckungslücke größer als 10%, so muss es zur Vermeidung der Gefährdung oder Infizierung anderer Unternehmen aus dem Wettbewerb ausscheiden – diesen Zeitpunkt bestimmt die Insolvenzordnung mit den sogenannten Insolvenzauslösern der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung. Werden diese Regeln von einem Unternehmen oder einem Selbständigen etc. nicht beachtet, so wird dies gesetzlich sanktioniert, bis hin zur Strafverfolgung wegen Insolvenzverschleppung.
Unter Anwendung der vom BGH festgestellten Schwellenwerte von 10 % bzw. drei Wochen (Urteil vom 24.5.2005, IX ZR 123/04) ergibt sich folgende Formel zur Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit:
Sofort fällige + innerhalb 3 Wochen fällig werdende Zahlungspflichten
Sobald eine betriebswirtschaftliche Krise erkennbar wird, also lange vor dem Eintritt der Insolvenz, legen die gesetzlichen Bestimmungen den Leitungsorganen verschärfte Aufsichts- und Kontrollpflichten auf, die sich bis zum Eintritt der Insolvenz immer mehr verstärken. Werden diese Signale der Krise missachtet, machen sich die Entscheidungsträger oft schon aus diesem Grund persönliche haftbar. Die Haftungsrisiken beginnen also nicht erst mit der Insolvenz, sondern schon lange vorher!!!
Eine gesetzliche Insolvenzantragspflicht gibt es nur für Kapitalgesellschaften bzw. Personengesellschaft ohne natürliche Person als Vollhafter (GmbH &Co. KG), bei denen also keine Person mit ihrem Vermögen haftet, sondern nur das in der Gesellschaft gebundene Kapital. Wenn Sie Gesellschafter/Geschäftsführer einen Kapitalgesellschaft (GmbH, AG etc.) oder Personengesellschaft ohne natürliche Person als Vollhafter (z. B. GmbH &Co. KG oder Limited) sind, dann müssen Sie nach § 15a InsO spätestens 3 Wochen nach Eintreten der Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden (nicht erst dann, wenn Sie das Eintreten bemerkt haben, sondern dann, wenn Sie unter normalen Umständen davon Wissen erlangt haben müssten), da Sie ansonsten in die Insolvenzverschleppung geraten werden und mit empfindlichen Strafen (bei Fahrlässigkeit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, im schlimmsten Fall Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe) rechnen müssten.
Bei dem Insolvenzgrund der Überschuldung muss allerdings beachtet werden, dass es in 2008 zu einer Änderung in der Insolvenzordnung kam, sodass nun gilt, dass sofern die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist, kein Insolvenzantrag wegen Überschuldung gestellt werden muss, auch wenn diese rein rechnerisch vorliegt. Dazu muss aber eine vollständige Dokumentation vorliegen, die konkret die Fortführungsprognose als gerechtfertigt und gesichert deutlich werden lässt. Im Zweifel muss dies der Geschäftsführer beweisen!
Merken Sie allerdings schon vor Ablauf der 3-Wochenfrist, dass Ihr Unternehmen kaum eine Aussicht hat saniert zu werden bzw. die Zahlungsfähigkeit nicht wieder herzustellen ist, dann müssen Sie SOFORT einen Insolvenzantrag stellten!
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften aufgepasst!
Sind Sie Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstand einer AG (Aktiengesellschaft), so sollten Sie bedenken, dass Sie ggf. für alle Zahlungen haftbar gemacht werden können, die nach dem Eintritt eines materiellen Insolvenzgrundes geleistet oder veranlasst worden sind (vgl. z. B. § 64 GmbHG, GmbH-Gesetz). Auf ein Verschulden kommt es nicht an. Ein Versäumen kann bei Managern auch schnell zur persönlichen Pleite führen, denn auch Sie haften persönlich und unbegrenzt, denn nur die Haftung der Kapitalgesellschaft ist beschränkt, nicht die des Managements!
Auch eine D &O-Versicherung5 wird in diesem Fall nicht schützend helfen. Berücksichtigt man dabei, dass derzeit ein Insolvenzantrag bei Kapitalgesellschaften im Durchschnitt erst ein Jahr nach Eintritt der Insolvenz gestellt wird, so hat der Geschäftsführer prinzipiell alle Zahlungen die im letzten Jahr von ihm veranlasst worden sind an die Gesellschaft zurück zu zahlen, und der Insolvenzverwalter hat dies nach § 93 InsO (Insolvenzordnung) einzufordern. Allein diese Regelung und das verspätete Antragsverhalten führt Jahr für Jahr zur Existenzvernichtung bei vielen Geschäftsführern und Vorständen.
Neu geschaffen wurde mit der Insolvenzrechtsreform 1999 die Möglichkeit, schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit (wenn es absehbar ist, dass Sie bald Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können) eine Insolvenz zu beantragen. Damit soll dem Sanierungsgedanken, der bei einer rechtzeitigen Antragstellung größere Aussichten auf Erfolg hat, Rechnung getragen werden. Stellt sich ein Unternehmen nach diesen Maßgaben unter den Schutz der Insolvenzordnung, so erfährt es eine Vielzahl von Vergünstigungen, um die Krise zu überwinden. Aber Sanierung wird ein anderes Buch …
Ende Exkurs
Cash Cycle (Kapitalbedarfsrechnung)
Cash Cycle gibt die Vorfinanzierungsspanne an (Wie lange muss der gesamte Umsatz der Unternehmung vorfinanziert werden?). In manchen Lehrbüchern wird dieses Thema unter working capital6 management subsumiert.
Der Cash Cycle ist bestimmt durch:
Ø Kreditorenfrist -> Zahlungsfrist/-ziel, die/das der Lieferant dem Unternehmen einräumt, um seine erhaltenen Waren und Leistungen zu bezahlen,
Ø Eingangslagerzeit -> Materialkosten (nach Ablauf der Kreditorenfrist), u.U. auch Transportkosten -> denken Sie an Obstlieferungen aus Afrika, die während ihrer Überfahrt erst den gewünschten Reifegrad für den Endverbraucher erreichen.
Ø Produktionszeit -> Löhne,
Ø Endlagerzeit -> Verwaltungskosten, Mietkosten, Versicherungskosten, etc.
Ø Debitorenfrist -> muss auch finanziert werden! Wie bestimme ich diese?
Eine erste Indikation, welche Fist man ansetzen könnte ist die Frist, …
die man laut AGB mit seinen Kunden vereinbart;
die dem Unternehmen durch große Abnehmer „diktiert“ werden
7
,
Kapitalkosten werden pro Tag abgerechnet und dann aufsummiert.
Ziel:> muss möglichst kurz gehalten werden!
Organisatorisch erfordert dies eine effiziente Debitoren-, Lagerhaltungs-, Produktionsund Kreditorenpolitik.
Auch wenn der Sprachgebrauch das Kreditorenmanagement die Zahlungen an die Lieferanten beinhaltet, gehören aber auch weitere Bereiche der Produktionsleistung zum „Auszahlungsplan“ dazu:
Löhne und Gehälter,
Mieten, Leasingraten, Lizenzzahlungen,
Fuhrparkkosten und Raumkosten.
Als Berechnung sieht das wie folgt aus:
Gerade der Vergleich der ersten beiden Quartale 2013 versus 2014 macht stutzig; da alle drei Bestandteile sich abgesenkt haben und daher im Saldo die DWC-Kennziffer gesunken ist, spricht vieles für eine Absenkung des gesamten Niveaus der Unternehmensaktivität im 2 Halbjahr 2013, insbesondere weil offensichtlich das Vorratsvermögen abgesenkt wurde.
In der 2. Topline der Übersicht sehen Sie eine Anmerkung zu dem Anstieg des working capitals über die letzten sechs Quartale im Vergleich zum Umsatz. Das liegt in der „Natur der Sache“: Wenn Sie den Umsatz steigern, baut sich im Vergleich der Forderungsbestand überproportional auf. Erst wenn Sie das „Plateau“ wieder verlassen (weil Ihr Umsatz sich mindert), baut sich der Forderungsbestand überproportional wieder ab (denn die Kunden zahlen ihre Rechnungen, während Sie aber mangels Umsatz keine neuen Forderungen aus L&L in die Bilanz aufnehmen).
Finanzplanung – Überlegungen und Organisation
Beim Thema Finanzplanung ist man natürlich ganz nahe beim Begriff des Budgets; ohne hier jetzt in die Gefilde des Controllings allzu tief einzusteigen, nur ein kurzer graphischer Abriss der wichtigsten Gedanken beim Budget.
Welche Aspekte und Teilpläne stehen dabei in jeder Abteilung im Vordergrund?
Während die erste Phase in allen Abteilungen stattfindet, hat danach die Finanzabteilung die hehre Aufgabe, die Vorstellungen von Aufwand und Ertrag der Fachbereich in Investitionsauszahl-, Finanz-, und Liquiditätsplänepläne einzubauen.
Sie sehen an dem Gesamtplan den ursprünglichen Sinn einer Unternehmensplanung sehr deutlich: alle Ressourcen des Unternehmens müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Komplexität besteht darin, diese Pläne nicht nur quantitativ zu bestimmen, sondern in eine Zeitachse aufeinander abzustimmen.
Denken Sie hierbei nicht nur an Gesamtjahrespläne über eine Zeitraum von drei bis fünf Jahren, auch unterjährig kann es zu starken saisonalen Effekten kommen, z.B in Nahrungsmittelindustrie (Stichwort: Erntezeitzeiten), Textileinzelhandel (Winter-versus Sommersaison).
Finanzplanung
Kapitalbedarf bei der Unternehmensgründung
Vorbetrachtung: Bei der Gründung eines Unternehmens müssen neben den einmaligen Investitionsausgaben (=Grundfinanzierung bzw. Anlagefinanzierung) für
a) Rechtskosten (Notar, Grundbucheinträge, etc.),
b) Gebäude und Maschinen
c) Personalbeschaffung (Anzeigen/Personalauswahl
müssen die laufenden Ausgaben(= Umlauffinanzierung der Löhne, Gehälter, RHB etc.) vorfinanziert werden.
Die laufenden Ausgaben müssen nur bis zu dem Zeitpunkt vorfinanziert werden, bis diese aus den Umsatzerlösen (Kunde (=Debitor) begleicht Forderung) selbst getragen werden können.
Übungen
a) Berechnung des Anlagekapitalbedarfs (bzw. der Grundfinanzierung)
Auszahlungen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
Hier sind alle einmaligen Auszahlungen und solche Auszahlungen zu erfassen die zu einer langfristigen Kapitalbindung führen. Hierzu zählen:
Bsp:
Grundstück (inkl. Notar und Grundbuchkosten)
120.000 €
Baukosten
880.000 €
AK der BGA (Schränke, Stühle, Computer)
60.000 €
Fuhrpark
45.000 €
Eisener Bestand /Sicherheitsbestand
*
)
70.000 €
Sonstige einmalige Auszahlungen
25.000 €
Kapitalbedarf für die Grundfinanzierung
1.200.000 €
*) Die Vorräte des „Eisernen Bestandes“ gehören zwar zum Umlaufvermögen; da diese Werte permanent im Unternehmen gebunden sind, werden sie zum Anlage- bzw.
Grundfinanzierungskapitalbedarf gerechnet.
b) Berechnung des Umlaufkapitalbedarfs kumulative vs. Elektive Methode Beispielsituation: Der Unternehmer rechnet mit einem tägl.
Wareneinsatz (Rohstoffkosten) von:
6.000 €
tägl. Akkordlöhnen von 9.000€ und täglichen
9.000 €
Gemeinkostenauszahlungen (Gehälter, Strom, Heizkosten) von:
3.000 €
I) kumulative Methode
Da die kumulative Methode nur eine durchschnittlichen Gesamtbindungsdauer und einen durchschnittlichen tägliche Auszahlung betrachtet ist dieses Verfahren sehr ungenau. Die Kapitalbindungsdauern der Kostenarten sind jedoch extrem unterschiedlich.
*