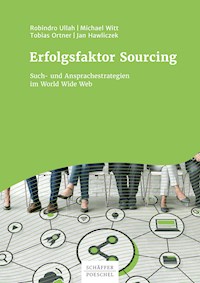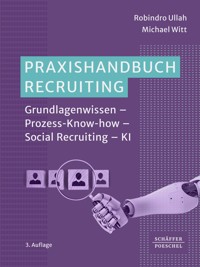
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wo finde ich fehlende Fachkräfte und wie spreche ich sie richtig an? Wie gestalte ich einen effektiven und effizienten Recruiting-Prozess? Wie kann ich die Chancen des digitalen Wandels und von KI für mein Recruiting nutzen? Das Buch bietet einen kompakten und vollständigen Überblick über das Thema Personalbeschaffung. Verknüpft mit vielen Fallbeispielen beschreibt es anhand eines idealtypischen Recruitingprozesses alle anfallenden Aufgaben. Mit dem prämierten Schulungskonzept "Recruiter Next Generation". Ideal zur Einarbeitung und als Nachschlagewerk für die Praxis. In der 3. Auflage überarbeitet und ergänzt um neue Themen. Dies sind u.a.: Anwendungsszenarien von KI im Recruiting, Social Recruiting, Einführung des Lebenswelt-Recruiting-Modells, neue Recruiting-Kanäle. Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - E-Book direkt online lesen im Browser Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort zur dritten Auflage1 Einleitung zur dritten Auflage2 Grundlagen2.1 Fachkräftemangel – War for Talents2.2 Der Arbeitsmarkt2.2.1 Teilarbeitsmärkte2.2.2 Dynamik im Arbeitsmarkt2.3 Recruiting – ein professioneller Ansatz2.3.1 Ansätze und Modelle2.3.2 Zielgruppenbestimmung2.4 Abgrenzung zu anderen Disziplinen2.4.1 Employer Branding2.4.2 HR-Marketing2.5 Digitalisierung2.6 Begriffliche Einordnung im Kontext Recruiting2.7 Digitale Recruiting-Transformation2.7.1 Technologischer Fortschritt2.7.1.1 Daten im Überfluss – Big Data, der große Helfer3 Recruiting planen und gestalten3.1 Bedarfsplanung und Bedarfsanalyse3.1.1 Bedarfsplanung3.1.1.1 Bruttopersonalbedarf3.1.1.2 Personalbestandsplanung3.1.1.3 Nettopersonalbedarf3.1.2 Bedarfsanalyse und Zielgruppenbestimmung3.2 Der Recruiting-Prozess3.2.1 Die mittelfristige Personalplanung3.2.2 Die jährliche Personalplanung3.2.3 Die Prozessschritte3.3 Positionieren der Arbeitgebermarke3.4 Die Vakanz3.4.1 Das Anforderungsprofil3.4.2 Die Stellenausschreibung3.4.2.1 Imagetext und Arbeitgebervorstellung3.4.2.2 Titel der Stelle3.4.2.3 Aufgaben3.4.2.4 Anforderungen3.4.2.5 Angebot3.4.2.6 Weitere Informationen3.4.2.7 Print-Stellenausschreibungen3.4.2.8 Online-Stellenausschreibungen3.4.2.9 Weitere Tools bei Stellenausschreibungen3.5 HR-Marketing3.5.1 Grundsätzliche Überlegungen3.5.2 Zielgruppenanalyse3.5.3 Das Konzept steht – und nun?3.6 Recruiting Tools3.6.1 Die Karrierewebsite3.6.1.1 Inhaltliche Überlegungen3.6.1.2 Layout und technische Anforderungen einer Stellenbörse3.6.1.3 Strategische Dimension3.6.1.4 Dein Quickcheck für deine Karrierewebseite3.6.2 Jobbörsen und Jobsuchmaschinen3.6.2.1 Klassifizierung von Jobbörsen3.6.2.2 Angebote von Jobbörsen und Jobsuchmaschinen3.6.2.3 Eingesetzte Methoden und Verfahren3.6.2.4 Neue Tools für den Recruiting-Markt3.6.3 Anzeigen in Printmedien3.6.4 Messen3.6.4.1 Vorbereitung3.6.4.2 Die Messe-Veranstaltung3.6.4.3 Nachbereitung3.6.5 Arbeitgeberbewertungsportale3.6.6 Social Media3.6.7 Andere Ansätze: Whatchado und Phenom3.6.8 Einsatz von Software und Tools3.6.9 Crossmedial3.7 Touchpoints im Bewerbungsprozess3.7.1 Kandidatenerleben – Candidate Experience3.7.2 Bewerberkommunikation3.8 Bewerber auswählen3.8.1 Der Matching-Prozess3.8.2 Die Vorauswahl3.8.3 Das Interview3.8.3.1 Vorbereitung des Interviews3.8.3.2 Durchführung des Interviews3.8.3.3 Fragetechniken3.8.3.4 Nachbereitung3.8.4 Assessment-Center3.8.5 Weitere Testverfahren3.9 Bewerber einstellen3.9.1 Das Onboarding3.9.2 Talentmanagement4 Social Recruiting4.1 Web 2.0/Web 3.0 und das Social Web4.2 Die Verwendung von Social Media im Recruiting4.2.1 Die Zielgruppe4.2.2 Zwei Ansätze – werben und suchen4.2.3 Content-Strategien4.2.4 Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte – ein Video auch!4.3 Die wichtigsten Social-Media-Kanäle4.3.1 Die Business-Netzwerke Xing und LinkedIn4.3.2 TikTok4.3.3 X (ehemals Twitter)4.3.4 YouTube4.3.5 Instagram/Threads/Reels4.3.6 Snapchat4.3.7 Der Blog4.3.8 Der Podcast4.3.9 Weitere ausgewählte Kanäle4.3.9.1 WhatsApp/Messenger4.3.9.2 Pinterest4.4 Sourcing4.5 Digitales Recruiting4.5.1 Smart Recruiting4.5.2 Taylor-made Recruiting4.5.3 Augmented Recruiting4.6 Die neue Kommunikation4.7 Ein Blick in die Trends, die eigentlich keine mehr sind5 Talent Intelligence5.1 TI im Employer Branding5.2 TI im HR-Marketing5.3 TI im Recruiting5.4 Die Welt der Kennzahlen5.4.1 Woher kam der Bewerber?5.4.1.1 Online-Bewerbung5.4.1.2 Offline – Alternative Bewerbungsmethoden5.4.2 Wie war der Verlauf der Bewerbung innerhalb des Unternehmens5.4.3 Wie hat der Bewerber gesucht?5.4.4 Social Media Monitoring5.4.4.1 Wir im Social Web Screening5.4.4.2 Unsere Wirkung im Social Web5.4.5 Smart Data5.4.6 Arbeitgeberrankings – wohin das Auge schaut6 Der Recruiter und die künstliche Intelligenz6.1 Ist jetzt schon wieder etwas anders? Der neue Recruiter6.2 Der Augmented Recruiter6.2.1 Die Kerngebiete, an denen wir arbeiten müssen6.2.2 Die acht Themengebiete im Detail6.2.2.1 Kommunikation6.2.2.2 Technik und Gadgets6.2.2.3 Zeit-, Selbst- und Online-Reputationsmanagement6.2.2.4 Soziale Netzwerke6.2.2.5 Innovation und Kreativität6.2.2.6 Repräsentation6.2.2.7 Navigation durch das Unternehmen6.2.2.8 Prompten7 AusblickGlossarLiteraturverzeichnisPodcast-ListeDie Autoren StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5916-7
Bestell-Nr. 20857-0003
ePub:
ISBN 978-3-7910-5917-4
Bestell-Nr. 20857-0101
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5921-1
Bestell-Nr. 20857-0152
Robindro Ullah/Michael Witt
Praxishandbuch Recruiting
3., aktualisierte Auflage, November 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © nimis69, iStock
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort zur dritten Auflage
Liebe Leserinnen und Leser,
Hand aufs Herz: Diese Auflage ist uns bislang am schwersten gefallen. Die Pandemie hat in vielerlei Hinsicht tiefe Einschnitte hinterlassen, die auf verschiedenen Ebenen deutlich spürbar sind. Nicht nur der Arbeitsmarkt hat sich grundlegend verändert, auch zahlreiche Studien und Erhebungen wurden entweder ausgesetzt oder haben ihren Fokus verlagert.
Während von der ersten zur zweiten Auflage dieses Buches noch eine gewisse Kontinuität bestand, hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Wir haben versucht, den Aufbau des Buches so ähnlich wie möglich zu belassen und dennoch aktuelle Entwicklungen und neue Anbieter einzubeziehen.
Die letzten vier Jahre haben massive Veränderungen mit sich gebracht. Die Pandemie war ein riesiger Einschnitt und der technologische Fortschritt, den wir seit anderthalb Jahren erleben, ist ein weiterer. Auf so vielen Ebenen ändern sich die Dinge rapide und wir haben versucht, diesen Veränderungen in dieser neuen Auflage gerecht zu werden. Bereits bei der ersten Auflage war die Herausforderung groß, Konzepte so zu beschreiben, dass sie im Moment des Drucks nicht bereits veraltet sind. Diese Herausforderung ist noch weiter gestiegen.
Unser Buch ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass die Kompetenzen der Zukunft nicht allein in expliziten Fachkenntnissen liegen, sondern vielmehr im Willen, Neues zu lernen, sich schnell anzupassen und neue Informationen aufzunehmen. Es geht darum, Konzepte zu verstehen und zu durchdringen, anstatt vergängliche Details zu lernen.
Mit dieser neuen Auflage versuchen wir einen Spagat, der größer ist als je zuvor. Die Entwicklungen sind so schnell, dass wir viele traditionelle Ansätze noch nicht vollständig hinter uns gelassen haben. Die Grundsätze der Personalgewinnung folgen nach wie vor den ursprünglichen Prozessen, die wir bereits vor 20 Jahren hatten. Doch am Horizont zeichnen sich bereits Veränderungen ab.
Je schneller sich die Entwicklung vollzieht, desto größer wird der Spagat, den wir vollziehen müssen – von etablierten Prozessen und Technologien hin zu den neuesten Gedankengängen und Konzepten. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem wir entscheiden müssen, welche Teile wir hinter uns lassen. Dieser Schnitt wird nicht nur Prozesse und Konzepte betreffen, sondern möglicherweise auch Mitarbeitende.
Eine Frage, die wir in diesem Buch nicht im Detail behandeln, die aber in den aktuellen Entwicklungen sehr relevant ist, lautet: Wie viel investieren wir, um die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen? Wie viel investieren wir in die Ausbildung und Weiterentwicklung von Recruitern? In naher Zukunft werden wir hybride Konzepte sehen, bei denen künstliche Intelligenz und Recruiter Hand in Hand arbeiten. Dies wird eine völlig neue Effizienz eröffnen.
Bereits bei der ersten Auflage konnten wir erahnen, dass dieser Weg eingeschlagen wird. Heute sind wir an einem Punkt, an dem wir diesen Weg tatsächlich beschreiten. Diese Entwicklungen sind nicht mehr nur Theorie, sondern greifen konkret in unseren Alltag ein.
In diesem Buch haben wir versucht, die Herausforderungen und Chancen der heutigen Zeit darzustellen. Wir hoffen, dir einen umfassenden Einblick in die Welt des Recruitings gegeben zu haben und freuen uns auf die gemeinsame Reise in die Zukunft der Personalgewinnung.
Mit besten Grüßen,
Michael Witt & Robindro Ullah
Meßkirch/Berlin 2024
1 Einleitung zur dritten Auflage
Das Jahr 2022 markierte einen bedeutenden Wendepunkt im Recruiting, als die Welt allmählich begann, sich von den tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie zu erholen. Die Krise, die die globalen Arbeitsmärkte erschüttert hatte, schien vorüber, und plötzlich erinnerten sich Unternehmen weltweit daran, dass sie dringend neue Talente rekrutieren mussten.
Die Anzahl der geschalteten Stellenanzeigen stieg sprunghaft an – um mehr als 50 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie Mitte des Jahres 2022. Dieser plötzliche Anstieg rüttelte den gesamten Arbeitsmarkt kräftig durch. Die Gehälter schossen in die Höhe, und die Nachfrage nach qualifizierten Recruitern war so groß wie nie zuvor. In der Hektik und Dringlichkeit, offene Positionen zu besetzen, wurden jedoch auch viele Fehlentscheidungen getroffen.
2022 wurde zu einem Jahr der Aufholjagd nach zwei verlorenen Jahren. Unternehmen versuchten verzweifelt, die während der Pandemie entstandenen Lücken in ihren Belegschaften zu schließen. Doch das wirklich Spannende daran war, dass diese Dynamik nicht einfach verschwand. Im darauffolgenden Jahr 2023 hatte sich die anfängliche Hektik zwar etwas gelegt, doch die Zahl der Stellenanzeigen blieb weiterhin über dem vorpandemischen Niveau.
Diese Phase des «Einpendelns« nach der Aufholjagd führte zu einem erneuten Wachstum. Die Rekrutierungsmärkte befanden sich in einer ständigen Evolution, geprägt von neuen Herausforderungen und Chancen. Dies ist die Welt, in der wir uns heute befinden: Ein Markt, der sich ständig weiterentwickelt und von einer hohen Nachfrage nach Talent und innovativen Rekrutierungsstrategien geprägt ist.
Die Erfahrungen aus diesen Jahren haben gezeigt, wie wichtig es ist, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. Unternehmen müssen nicht nur auf plötzliche Veränderungen im Markt reagieren können, sondern auch langfristige Strategien entwickeln, um im Wettbewerb um die besten Talente bestehen zu können. Die Ereignisse von 2022 und 2023 haben die Weichen für eine neue Ära im Recruiting gestellt, in der Innovation und Anpassungsfähigkeit der Schlüssel zum Erfolg sind.
Auch wenn es noch nicht alle Unternehmen und Kandidaten realisiert haben, so haben wir mittlerweile fast den Status der Augenhöhe im Arbeitsmarkt erreicht. Das Jahr 2022 hat maßgeblich dazu beigetragen. Die Pandemie und ihre Folgen haben den Arbeitsmarkt tiefgreifend verändert und eine neue Dynamik geschaffen, die uns näher an eine Balance zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebracht hat.
Ein faszinierender Aspekt dieser Entwicklung ist die sukzessive Entkoppelung dessen, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, von dem, was in der Wirtschaft geschieht. Während die Wirtschaft zuletzt einen Dämpfer erlebte, stieg die Nachfrage nach bestimmten Funktionen weiter an. Diese Diskrepanz zeigt, dass die Arbeitsmarktbedürfnisse zunehmend unabhängig von den traditionellen wirtschaftlichen Indikatoren sind.
Eine der treibenden Kräfte hinter dieser Veränderung ist der demografische Wandel. Die großen Alterskohorten der Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt, was den Druck auf Unternehmen erhöht, bestehende Positionen zu erhalten. Diese Herausforderung wird durch die Tatsache verschärft, dass einige Unternehmen es nicht schaffen, genügend Talente anzuziehen, um ihre Belegschaft zu stabilisieren, geschweige denn sie zu erweitern.
Fakt ist: Das Überleben eines Unternehmens hängt längst nicht mehr nur von seiner Innovationskraft und seinen guten Produkten ab. Die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren wie ein lebender Organismus, ist die Basis und der Hauptbestandteil eines jeden erfolgreichen Unternehmens geworden. Wie gut ein Unternehmen darin ist, Talente zu rekrutieren und zu halten, entscheidet langfristig über seinen Erfolg oder Misserfolg am Markt in einer globalen und digitalen Wirtschaft. Es ist diese Ressource, die nahezu alle Unternehmen miteinander verbindet und deren Bedeutung enorm gestiegen ist: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es auch, allen Unkenrufen zum Trotz, nach wie vor geben und sie werden nach wie vor die wichtigste unternehmerische Ressource sein. Die Digitalisierung und die Sprünge im Bereich KI werden hierbei die Berufsbilder vermischen und zu einer Verschiebung beitragen, die wir bis dato noch nicht einschätzen können. Die Gesellschaft und die Unternehmen haben bezüglich des Arbeitsmarktes schon einen Paradigmenwechsel vollzogen, der sich schlussendlich in einer Umkehrung der Mächte am Markt ausdrückt: Der ehemalige Arbeitgebermarkt ist zum Bewerbermarkt avanciert und unterliegt nicht länger den Gesetzmäßigkeiten der marktdominierenden Unternehmen. Die Marktmacht hat sich gewandelt. Unzählige Beispiele in diesem Handbuch werden dich an diesen Satz erinnern.
Den Umgang mit der Veränderung der Gesetzmäßigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, die unaufhaltsam voranschreitende Digitalisierung und die damit verbundenen Anpassungen von Prozessen und Einstellungen werden wir auf den nachfolgenden Seiten ausführlich besprechen und für dich praxistauglich aufbereiten. Das Buch setzt dort an und führt dies auch in der dritten Auflage konsequent fort, wo wir uns schon vor Jahren hätten hinbegeben sollen: an der Professionalisierung und Technisierung des Recruitings. Die Bedeutung der Personalgewinnung für das operative Geschehen in Unternehmen wiegt schwerer denn je und eine der direkten und logischen Konsequenzen ist die Durchführung einer Spezialisierung des Fachgebietes Recruiting.
Seit der zweiten Auflage haben wir zumindest in vielen Bereichen in Deutschland feste Recruiter Positionen. Den Schritt von der Aufgabe zur Funktion sehen wir in vielen Unternehmen vollzogen. Die Arbeit endet da aber nicht, da wir durchaus noch weite Strecken zu gehen haben im Bereich der Professionalisierung.
Wir wollen dir gern dabei helfen, diesen Weg zu gehen. Auch wenn wir hierbei alle Unternehmen, die Personal suchen, im Blick haben, legen wir zusätzlich an einigen Stellen im Buch einen besonderen Fokus auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), denen oftmals Kapazitäten für die Durchführung der notwendigen Grundlagenarbeit fehlen. Hier haben wir im Text des Buches immer wieder einen sogenannten KMU Deep Dive eingeflochten, der speziell auf die Belange der kleinen- und mittleren Unternehmen eingehen soll. Aber auch in Konzernen findet man häufig noch Prozesse vor, die beispielsweise nicht aus der Perspektive der Kandidaten und Bewerber durchdacht und umgesetzt wurden. Das Praxishandbuch Recruiting gibt dir die richtigen Denkanstöße, um genau diesen Prozess in Bewegung zu setzen: den Aufbau von geschäftskritischem Know-how innerhalb eures Unternehmens. Wir versuchen, den gesamten Recruiting-Prozess zu betrachten, und gehen insbesondere in diesem Ansatz davon aus, dass Funktionen wie externes Employer Branding und Personalmarketing inhaltlich dem Recruiting untergeordnet sind und es unterstützen. Dabei haben wir im Rahmen der dritten Auflage besonders auf die Digitalisierung des Recruitings und der Nachbardisziplinen geachtet und ggf. Exkurse eingearbeitet oder entsprechende Textstellen angepasst.
Auslöser des gesamten Recruiting-Prozesses soll eine Vakanz sein bzw. die Planung von Vakanzen, die es gilt, zeitnah oder in Zukunft zu besetzen. Erst dann entsteht in unserer Betrachtung die Notwendigkeit einer attraktiven Arbeitgebermarke im Außenauftritt und ihrer Präsenz am Arbeitsmarkt. Natürlich machen auch Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit einen nach innen gerichteten Employer-Branding-Prozess notwendig. Dies soll aber nicht vorrangig Gegenstand unseres Buches sein.
Unser Wissen und Können setzt sich zusammen aus vielen Jahren des operativen Recruitings, Employer Branding und HR-Marketings. Dieses zu teilen, war Anstoß unseres Buchprojektes, denn bekanntlich wächst Wissen, wenn man es teilt. In den nachfolgenden Kapiteln teilen wir daher den gesamten Recruiting-Prozess mit dir. Von der Planung bis zur Besetzung der Stelle findest du im Praxishandbuch nützliche Denkanstöße, einige Tipps, verschiedene Tools und Best Cases der deutschen Recruiting-Landschaft. Wir wollen mit unserer Arbeit einen Ansatz verfolgen, der nicht nur die sogenannten Highlights der Dax-30-Unternehmen zusammenträgt und vorstellt, denn diese sind für viele Unternehmen einfach nicht praktikabel. Hier sollst du dir Inspirationen und Werkzeuge holen, mit denen du dein Unternehmen für die zukünftigen Herausforderungen im Recruiting wappnen kannst. Der Grundgedanke, der uns antrieb, war nicht, dir ein fertiges Kochrezept zu liefern – nach dem Motto: »Folge Schritt eins bis fünf und am Ende ist dein Recruiting professionalisiert.« Während der vergangenen Jahre haben wir erlebt, dass die Lösungen von der Stange keine Lösungen sind. Wir wollen dich dabei unterstützen, Strategien und Gedanken maßgeschneidert für dein Unternehmen zu entwickeln. Unternehmen sind in Struktur und Kultur derart unterschiedlich, dass jeder mit einem Schema F zwangsläufig scheitern muss. Die wenigen Eckpfeiler, an denen man sich orientieren kann, haben wir gesetzt. Insgesamt wollen wir dich, lieber Leser/liebe Leserin, zum Denken auffordern. Gib uns ruhig Feedback und teil uns mit, wenn Themen des Buches überholt sind.
Vielleicht lässt sich dieses Buch auch mit dem Gedanken umschreiben: »Hilfe zur Selbsthilfe«. Wie haben schon unsere Mathelehrer gesagt: Nicht nur das Ergebnis ist entscheidend, sondern auch der (Rechen-)Weg. Erst wenn du weißt, wie du zu dem für dein Unternehmen richtigen Ergebnis kommst, haben wir unseren Job gut gemacht. Das richtige Ergebnis für dein Unternehmen wollen wir dir daher nicht liefern. Einer unserer früheren Chefs hat einmal gesagt, dass wir nicht mehr Konkurrenten brauchen, sondern bessere. Der gesunde Wettbewerb fördert die Kreativität und lässt uns wachsen – und genau daran sind wir beide interessiert.
In Kapitel 2 beginnen wir mit verschiedenen notwendigen Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen. Sauber definierte und klar besprochene Begrifflichkeiten bilden die Grundlage für weiterführende Prozesse. Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf die Definition von Zielgruppen und zeigen deren erheblichen Einfluss auf das gesamte Recruiting-Geschehen auf. Denn die Zielgruppen sind oftmals Auslöser unserer Prozesse und geben beim Recruiting die entscheidende Richtung vor. Viel zu oft werden Begriffe, die sich im Themengeflecht des Recruitings befinden, synonym und häufig auch falsch bzw. missverständlich verwendet. Denn im Grunde gibt es kein Falsch und auch kein Richtig. Man sollte nur konsequent einer Definition folgen, um sich mit seinem jeweiligen Gegenpart verständigen zu können. In diesem Kapitel wollen wir uns auch gleich und ausführlich aktuellen Themen der Digitalisierung sowie der KI (künstliche Intelligenz) stellen. Wir werden zum einen beleuchten, wie die neuen Technologien grundlegend für das Recruiting einzuordnen und gewinnbringend einzusetzen sind. Und zum anderen besprechen wir die ersten konkreteren digitalen Einsatzmöglichkeiten und legen Grundsteine für die weiteren Ausführungen. Denn mit der digitalisierten Form des Recruitings gehen auch wieder neue Begrifflichkeiten einher, die wir zu Beginn gemeinsam festlegen wollen. Mit der Klärung und Abgrenzung der Begriffe Employer Branding und HR-Marketing beenden wir das Kapitel 2.
Recruiting ist ein dynamischer und vielschichtiger Prozess, den es zu planen und zu gestalten gilt. Wir werden uns in Kapitel 3 ausführlich mit vielen denkbaren Facetten des Recruitings auseinandersetzen und dir dabei immer wieder Praxisbeispiele und – sofern standardisiert vorhanden – das notwendige Handwerkszeug beschreiben. Zum Einstieg in das Themenfeld definieren wir den Begriff Recruiting, um dann anhand dieser Definition in den aus unserer Sicht optimalen Recruiting-Prozess überzuleiten. Im Rahmen dessen vertiefen wir die Kernthemen der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung und stellen dir anschließend die Möglichkeiten bei der Erstellung von Stellenausschreibungen vor. Kern dieses Kapitels bilden die Recruiting-Tools, die bei einem operativ ausgerichteten Recruiting zum Einsatz kommen. Auch hier werden wir die neuen Technologien nicht außer Acht lassen und entsprechend in die Erläuterungen einbinden. Wir werden dir mehrere Anwendungsbeispiele aufzeigen, sodass du dir deine eigene Toolbox, deinen eigenen Recruiting-Werkzeugkasten, zusammenstellen kannst. Diese Toolbox wird, wie es in einem guten Recruiting-Setting sein sollte, sowohl aus herkömmlichen Tools bestehen als auch neue und vor allem digitale Methoden sowie KI-Tools berücksichtigen. Neben den Tools nimmt das Auswahlverfahren einen besonderen Stellenwert ein. Vertiefen wollen wir zudem Themengebiete, die unserer Meinung nach im Recruiting oftmals zu wenig Beachtung finden: Da sind zum einen die Berührungspunkte, die im Recruiting-Prozess zwischen Unternehmen, Kandidaten und Bewerbern entstehen, und zum anderen wollen wir auch das Themengebiet des Onboardings besprechen und vorstellen. Um den Prozess zu komplettieren, werden wir aus der Prozessperspektive des Recruitings heraus Employer Branding und auch HR-Marketing einordnen. Dabei geht es uns um die Wirkungszusammenhänge zwischen den Disziplinen.
Das Thema Social Media ist nicht mehr aus der Personalgewinnung wegzudenken. Jedoch hat sich in der Dynamik des Internets auch eine neue Art des Recruitings entwickelt, die nicht mehr nur unter dem Dach des Social-Media-Recruitings zu verorten ist. Daher haben wir das Kapitel 4 »umgetauft« und Social Recruiting genannt. Auch hier werden wir mit den grundlegenden Begrifflichkeiten, Definitionen und Prozessen beginnen und dabei einen besonderen Fokus auf das Web 2.0 und die darin enthaltene Dialogfähigkeit legen. Social Media werden wir im Rahmen des Social Recruitings nach wie vor gesondert betrachten. Dabei können Social Media auf zwei unterschiedliche Arten deine Personalgewinnung unterstützen: Sie können auf der einen Seite als Markenbildungs- und Marketinginstrument zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite können Social Media als ein direktes Recruiting-Werkzeug bei der Ansprache von Kandidaten eingesetzt werden. Wir werden dir beide Einsatzmöglichkeiten vorstellen und dabei den Einsatz von Social Media im operativen Recruiting vertiefen. Mit einem Überblick zu einzelnen ausgesuchten aktuellen Social-Media-Kanälen und den entsprechenden Hinweisen für einen möglichen Einsatz im Recruiting schließen wir dieses Kapitel. Wir haben uns bei Kapitel 4 auf eine bewusste Auswahl verständigt, bei der wir eine hohe Praxisrelevanz, aber auch eine hohe Zukunftsfähigkeit sehen. Die Detailtiefe unserer Beschreibungen geht dabei nicht bis in die Einzelfunktionsbeschreibung diverser Technologien, Tools oder Netzwerke. Unsere Intention ist eher, dass du als Leser das notwendige Know-how aufbaust, um Technologien, Tools und Netzwerke einzuordnen und sie bewerten zu können.
Um den Erfolg deiner gesamten Bemühungen einschätzen, bewerten und verbessern zu können, solltest du dir ein KennzahlensystemKennzahlensystem zulegen, das eine quantitative, aber vor allem auch eine qualitative Bewertung deiner Aktivitäten ermöglicht. Gerade hier scheint im Personalbereich allgemein noch deutlicher Aufholbedarf zu sein. Wir vertreten die Meinung, dass Maßnahmen nur als wirksam eingestuft werden können, wenn ausreichend bewertbares Zahlenmaterial vorliegt. Denn Recruiting muss wirksam und auch messbar sein. Im Rahmen von Kapitel 5 werden wir dich nicht nur wie in der zweiten Auflage in die Welt der Kennzahlen, die für unsere Belange notwendig sind, einführen und dir einige Möglichkeiten aufzeigen, sondern das Feld größer setzen und Talent Intelligence betrachten – die intelligente Nutzung von Daten zur besseren Entscheidungsfindung unter anderem im Recruiting. Es ist ein großer Blumenstrauß an Zahlen, Daten und Fakten, der teilweise auch mit Vorsicht genossen werden sollte. Auch und vielleicht besonders in diesem Bereich gibt es enorme Entwicklungen. Mit dem Einsatz neuer Technik wird die Auswertbarkeit des Recruitings weiter vorangetrieben. Es gilt hier, immer am Ball zu bleiben und die technologischen Fortschritte zumindest im Auge zu behalten.
Auf dem Weg der Professionalisierung deines Recruitings reicht es nach unserer Auffassung nicht aus, Prozesse zu optimieren und Recruiting-Tools zu implementieren. Wir denken, dass eine systemische Professionalisierung mit einer Professionalisierung deiner Mitarbeiter einhergehen muss. Das Personal, mit dem du diesen Weg beschreitest, muss bestens ausgebildet sein. Recruiting ist kein Hexenwerk und arbeitet nicht mit Magie, sondern besteht aus grundsoliden Fähigkeiten, die aufgebaut und regelmäßig nachjustiert und verfeinert werden müssen. Mit dem Kapitel 6 wollen wir dir ein paar Eckpfeiler der Fortbildung an die Hand geben. Die Eckpfeiler sollten dich und deine Mitarbeiter auf den Weg zum Recruiter Next Level bringen. Da das Umfeld von Recruiting ein sehr volatiles Konstrukt ist, sind immer wieder Anpassungen und Änderungen in der Ausübung des Recruiter-Berufes notwendig. Beim Lesen der Eckpfeiler wirst du feststellen, dass diese vor allem die Organisation auf das selbstständige Weiterlernen vorbereiten. Ein Recruiter Next Level (RNL oder auch Umberto genannt) ist kein Status, den man irgendwann erreicht. Er ist vielmehr als ein Prozess ständiger Weiterentwicklung und Marktanpassung zu verstehen.
Mit Kapitel 7 wollen wir das Buch beenden. Gemeinsam wollen wir in diesem Kapitel auf das Thema Recruiting zurückblicken, um dann nach vorne zu schauen. Der offene Blick in die Zukunft ist das, was uns heutzutage oftmals fehlt. Wenn wir uns auf diesem sehr klein gewordenen Schlachtfeld, das man hierzulande Arbeitsmarkt nennt, behaupten wollen, müssen wir als Recruiter den Dingen, die auf uns zukommen, einen Schritt voraus sein. Wenn wir als HR in der Summe strategischer Partner des Business sein wollen, dann müssen wir in den geschäftskritischen Bereichen vordenken. Recruiting ist unserer Meinung nach ein solcher geschäftskritischer Bereich. In den Personalabteilungen vieler Unternehmen glaubt man leider auch heute noch, wer Visionen hat, solle zum Arzt gehen. Trotzdem wollen wir dir unsere Visionen als einen hervorragenden Ansatzpunkt für Diskussionen zum Abschluss mitteilen. Nach diesem Blick in die Glaskugel hoffen wir, dass wir mit dir einen umfangreichen Einblick in ein modernes und auf die Zukunft gerichtetes Recruiting teilen konnten.
Das Recruiting unterliegt dauernder Veränderung. Genau diese Botschaft wollen wir dir mitgeben. Dabei wirst du im Verlauf des Buches vermutlich mit etlichen neuen Begriffen konfrontiert werden. Es sind neue Fachbegriffe, die sich in das veränderte Recruiting eingeschlichen haben. Gerade die bereits angesprochene Technisierung und das Web 2.0 brachten und bringen nach wie vor eine neue Terminologie mit sich. Um dich beim Lesen nicht zu verlieren, haben wir ein Glossar angelegt, das du am Ende des Buches findest. Dort haben wir sicherheitshalber mehr Begriffe als vielleicht notwendig hinterlegt, doch ist uns sehr viel daran gelegen, dass die Leserinnen und Leser uns verstehen.
Wir beide vertreten die Auffassung, dass Gender-Management ein wichtiges und ernst zu nehmendes Thema ist. Dies gilt in besonderer Weise für das Thema Recruiting. Jedoch haben wir uns zugunsten der besseren Lesbarkeit für die überwiegende Verwendung der männlichen Form in unseren Formulierungen entschieden. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Zuletzt haben wir uns bei dieser Auflage für eine Audio-Begleitung entschlossen.
Unter https://shows.acast.com/praxishandbuch-recruiting-der-podcast-zum-buch oder über den nebenstehenden QR-Code erhältst du Zugang zu Audio-Dateien, die wir je Kapitel aufgenommen haben, um die Inhalte nochmals zu diskutieren. Durch die Schnelllebigkeit ist dies auch unsere Chance, dir Neuerungen und Veränderungen zukommen zu lassen.
Bevor wir dich nun in die weiten Sphären des Recruitings entlassen, wollen wir nicht versäumen, all unseren beruflichen und familiären Begleitern, Unterstützern und Freunden zu danken, die uns über den gesamten Weg der Entstehung dieses Buches zur Seite standen. Vielen Dank!
Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen unserer dritten Auflage und wünschen dir viel Erfolg auf deinem persönlichen Recruiting-Weg!
2 Grundlagen
Kapitel 2 legt für dich die Grundlagen für eine durch und durch strukturierte Herangehensweise an das Thema Recruiting in den nachfolgenden Kapiteln. Bevor du also mit dem Recruiting-Prozess selbst beginnen kannst, ist ein gemeinsames Verständnis der Grundlagen entscheidend. Welche Themen verstehst du wie und welche Schlüsse ziehst du daraus? Wenn wir uns nicht auf einer Ebene befinden, wird dir das Buch im besten Fall unverständlich vorkommen. Einige der Vereinbarungen, die wir in Kapitel 2 als Grundlage für unser gemeinsames Recruiting-Verständnis treffen, kannst du ggf. für dich und dein Unternehmen auch anders entschieden haben. Um uns und unsere Gedankengänge dennoch verstehen zu können, solltest du dich mit unseren Vereinbarungen bzw. Definitionen zumindest auseinandergesetzt haben.
Wenn wir alles zusammenfassen und unsere Motivation betrachten, die dazu geführt hat, dieses Buch zu schreiben, dann kann man in wenigen Worten festhalten, dass es uns um die Professionalisierung der Rekrutierung geht – einen längst überfälligen Akt. Professionelles Recruiting und dazugehörige professionelle Recruiting-Strategien gehen bis auf Caesar zurück, der bereits damals seinen Soldaten angeblich 30 Prozent ihres Jahressoldes versprach für die Vermittlung eines neuen Soldaten – ein klassisches »Mitarbeiter werben Mitarbeiter«-Programm, welches auch heute noch eine der effektivsten Methoden zur Mitarbeitergewinnung darstellt. Erstaunlich, dass scheinbar bereits Caesar erkannt hatte, dass die Quelle für gute neue Mitarbeiter die eigenen Mitarbeitenden sind. Diese Legende deutet zumindest auf eine strategische Überlegung hin, wenngleich wir dies auch nicht belegen können.
Springen wir nun einige Jahrhunderte in die Zukunft und landen in der heutigen Zeit, sehen wir ein neues Bild. Seitdem die erste Auflage unseres Buches geschrieben wurde, hat sich unheimlich viel getan. Recruiting hat sich deutlich stärker professionalisiert und Recruiter gehören schon längst nicht mehr einer fernen Zukunftsvision an. Sie sind ein eigenständiges Berufsbild geworden und mittlerweile kann man diese in vielen Unternehmen finden. Längst ist es kein Privileg der großen Unternehmen und Konzerne, mehr als einen oder mehrere Recruiter zu haben. Hierbei hat uns vor allem das Jahr 2022 einen großen Schub verschafft, bei dem nochmals deutlich wurde, dass wir Recruiter und Recruiterinnen, die Personal aufbauen wollen, in den Unternehmen benötigen.
Bis wir es zur heutigen Stelle geschafft hatten, war es aber auch eine Reise. Über die erste und zweite Auflage dieses Buches könnt ihr diese Reise nachvollziehen. Nichtsdestotrotz sind wir noch längst nicht am Ende angelangt, wenn man überhaupt von einem Ende in diesem Zusammenhang sprechen kann. Parallel zu dieser Entwicklung digitalisiert sich die Welt, und nun kommen noch die Sprünge der künstlichen Intelligenz hinzu. Wenn wir in den vergangenen Jahren gerade bei Recruitern auch darauf geachtet haben, dass sie gewisse digitale Kompetenzen mitbringen, müssen wir mittlerweile tatsächlich vom nächsten Schritt sprechen: dem Schritt in Richtung künstliche Intelligenz. Die vielfach diskutierte Digital-Kompetenz wird sukzessive abgelöst durch die KI-Kompetenz.
Zeitgleich sehen wir viele Unternehmen, die tatsächlich noch in der Steinzeit leben, wenn es um Tools, Prozesse und Professionalität geht. Hier greift das alte Sprichwort: Die Zukunft bewegt sich in Wellen. Dieser Satz ist wahrer denn je. Die Wellen, in denen sich die Zukunft bewegt, werden immer höher. Es müssen nun immer größere Unterschiede überbrückt werden.
Während wir auf der einen Seite Recruiter sehen, die durch technische Unterstützung ihre Effizienz enorm steigern können, befinden sich zur gleichen Zeit auf der anderen Seite Unternehmen, die nach wie vor Schwierigkeiten dabei haben, effiziente Stellenanzeigen zu schalten.
Das Buch soll dir auch dabei helfen, dich in dieser großen, weiten Welt zurechtzufinden. Nachdem wir in den vergangenen Jahren darüber geschrieben hatten, wie viel unglaubliche Tools es auf diesen Markt des Recruitings geschafft haben, explodierte die Tool-Landschaft erneut mit dem Start von ChatGPT. Eine Strategie kann in einer solchen Situation ein Kompass sein, der dich dabei unterstützt und dir hilft, dich im Dschungel der vielen Software-Anwendungen zurechtzufinden. Nach wie vor gilt natürlich, dass Software nur dann nützlich ist, wenn diese an deine Prozesse und dein Unternehmen sowie an dein Ziel angelehnt ist.
In den letzten vier Jahren, seit Anbeginn der Pandemie, hat sich der Arbeitsmarkt mehrfach gedreht. Wenngleich diese Zeit sehr hart und schwierig war und niemand sie sich zurückwünscht, fungierte sie als Katalysator und Treiber von Technologie. Insbesondere im Arbeitskontext ist plötzlich sehr vieles möglich geworden, viele Dinge wurden anders betrachtet und wir schauen heute auf einen Arbeitsmarkt, den wir in dieser Form und Ausgestaltung zuvor nicht gesehen hatten. Aufgrund dieser Tatsache mussten wir sehr viele Teile dieses Buches neu schreiben, wie bereits im Vorwort erwähnt. Gerade in der Rückschau ist dir sicherlich auch bewusst, durch was für eine unglaubliche Phase dieser Arbeitsmarkt weltweit gegangen ist. Eine solche Phase kann nur von gravierenden Veränderungen begleitet werden.
2.1 Fachkräftemangel – War for Talents
Der unternehmerische Erfolg wird maßgeblich durch die bei dir beschäftigten Mitarbeitenden beeinflusst. Sowohl die Menge als auch die Qualität der verfügbaren Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt sind für dich besonders wichtig, gerade wenn sich dein Betrieb in einer wachsenden und fortschreitenden Wirtschaft befindet. Insgesamt erlebt die unternehmerische Wertschöpfung schon seit Längerem eine Kehrtwende, beeinflusst durch den gesellschaftlichen Wandel, die schnelle technologische Entwicklung der Digitalisierung und Automatisierung der Arbeit und nicht zuletzt auch durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland. Deshalb ist es notwendig, dass du dich mit den derzeit und auch zukünftig am Arbeitsmarkt verfügbaren Personen auseinandersetzt und Strategien sowie Perspektiven für deren Gewinnung entwickelst. Gerade das Recruiting nimmt dabei eine exponierte Stellung ein, denn es ist die Schlüsselfunktion für die Personalgewinnung.
EXKURS UNTERNEHMENSBEWERTUNG
Nach der heutigen Lage der Wirtschaft und der derzeitigen Entwicklung der Unternehmen ist davon auszugehen, dass der Erfolg und das Überleben eines einzelnen Unternehmens zukünftig davon abhängen wird, wie gut es darin ist, sich selbst zu regenerieren. Mit der Regeneration meinen wir die Fähigkeit, neues Personal zu akquirieren und bestehendes Personal zu binden. Bereits in der heutigen Zeit achten Geldgeber darauf, wie das Zielunternehmen in der Rekrutierung aufgestellt ist. Durch die besondere Knappheit von geeigneten Fachkräften können Businessmodelle noch so toll sein, doch wenn man niemanden findet, der diese umsetzt, sind sie wertlos. Mit dieser Perspektive kommen wir schnell zu dem Punkt Unternehmensbewertung. Der Wert des Unternehmens hängt maßgeblich von der Fähigkeit ab, zu rekrutieren und zu binden.
Kaum eine Debatte, die sich mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa auseinandersetzt, kommt ohne die Erwähnung des sogenannten »War for Talents« oder seines deutschen Pendants »Fachkräftemangel« aus. Das hat sich seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe nicht geändert, es hat sich sogar noch verstärkt. Ebenso scheint die personalbezogene Literatur, die sich vornehmlich mit dem Finden, Binden und Entwickeln von Mitarbeitern beschäftigt, diese Begrifflichkeit als eine Konstante zu verwenden. Leider werden diese Diskussionen nicht immer mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und dem angebrachten Fachwissen geführt. Daher ist eine sachliche und auf Fakten beruhende Diskussion aus unserer Sicht zielführender. Wir wollen hier nicht auf die oftmals sehr plakativen und schwarzmalenden Kampagnen aufsetzen, die den drohenden Fachkräftemangel in allen Bereichen prognostizieren und auch vom Aus der deutschen Wirtschaftskraft sprechen. Ebenso wenig sehen wir den »War«, den Krieg um die Talente, aus einer kampfbetonten Perspektive, sondern verstehen ihn als den »Kampf um die Besten« und somit als Chance und Herausforderung verschiedener Disziplinen des Human-Resources-Managements und insbesondere des Recruitings. Daher wollen wir Ansätze vorstellen, die außer für ein modernes Recruiting auch für die dauerhafte Sicherung von Fachkräften im Unternehmen anwendbar sind.
Um die gesamte Thematik umfassend zu beleuchten, bedarf es mehrerer Perspektiven. Zunächst müssen die Bedingungen des Arbeitsmarktes untersucht werden. Davon ausgehend, lassen sich die Angebots- und Nachfragekomponenten des Arbeitsmarktes analysieren und zu den gewandelten, derzeit vorherrschenden Bedingungen in Bezug setzen. Der Blick auf prognostizierte zukünftige Bedingungen für die Arbeitswelt im Allgemeinen und das Recruiting im Speziellen soll bei unserer Betrachtung einen wichtigen Stellenwert einnehmen, da die Weichenstellung im Jetzt beginnen muss. Bevor wir damit beginnen, ist eine definitorische Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten »Fachkräftemangel« und auch »War for Talents« angebracht.
In einer regelmäßig erscheinenden Online-Veröffentlichung der Managementberatung McKinsey The McKinsey Quarterly wurde 1998 in dem Journal »Number 3« von einer Autorengruppe um den damaligen Direktor Edward G. Michaels der Begriff »War for Talents« geprägt: »Better talent is worth fighting for« (Michaels et al. 1998) (deutsch: Es lohnt sich, um die besten Talente zu kämpfen). Die Verfasser sprachen im weiteren Verlauf des Journals bewusst von »War« (deutsch: Krieg), um den damals beginnenden »Kampf um die Besten« zu veranschaulichen. Dieser Aussage liegt eine von den Verfassern durchgeführte Untersuchung zugrunde, bei der 77 befragte große US-amerikanische Firmen zugaben, Probleme dabei zu haben, Talente zu erreichen und diese für ihr Unternehmen zu gewinnen (ebd.). Daraufhin wurde schon 1998 die Verknappung von Erwerbspersonen prognostiziert. Der Fokus der damaligen Betrachtungen lag aber auf den sogenannten High Potentials, den besten und talentiertesten Absolventen von Universitäten (ebd.). Mittlerweile hat sich der Kampf, also die Bemühungen, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen, auf weitere Berufsgruppen ausgebreitet. Laut McKinsey Deutschland (2011, S. 9) gibt es einen neuen »War for Talents«, der »[...] längst nicht mehr nur, wie zu Beginn des Jahrtausends, die Top-Absolventen [einbezieht], sondern alle für den Erfolg eines Unternehmens kritischen Mitarbeitergruppen« (ebd.). Der »War for Talents« bezeichnet, unabhängig von der Dekade, den Kampf bzw. die aktiven Bemühungen von Unternehmen um talentierte und für das Unternehmen als erfolgsrelevant einzustufende Mitarbeitergruppen. Im Jahre 1990 ging Bernhard von Rosenbladt mit seiner Veröffentlichung Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit im Rahmen eines Sonderdrucks der Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Frage nach, ob der damals von den Unternehmen beklagte Fachkräftemangel beschäftigungswirksam sein wird (ebd., S. 372). Dabei wurde untersucht, ob die Entwicklung des Arbeitsmarktes (u. a. steigende Arbeitskräftenachfrage in Relation zum Arbeitskräfteangebot) Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation deutscher Unternehmen haben wird. Aus unserer Sicht wurde im Rahmen dieser Veröffentlichung eine der ersten Untersuchungen unter Anwendung empirischer Methodik mit Fokus auf den Fachkräftemangel durchgeführt. Die dort vollzogene Herangehensweise wurde mit einigen kleineren Änderungen bis dato beibehalten. So wird der FachkräftemangelFachkräftemangel auch heute noch unter anderem aus einer Relation von Arbeitskräftenachfrage zum Arbeitskräfteangebot errechnet. Zusätzlich wird heute bei einzelnen Berufsgruppen bzw. Berufsgattungen die sogenannte Vakanzzeit berücksichtigt, also die Zeitspanne von der Meldung der Vakanz bei der Agentur für Arbeit bis zu ihrer Abmeldung (BMWi 2013).
In der heutigen Zeit müssen wir dieser Betrachtung noch eine weitere Dimension hinzufügen. Es handelt sich dabei um die Skill-Ebene. Wie sich genau der Fachkräftemangel im Detail weiter fortsetzen wird, ist aufgrund der anhaltenden Digitalisierung und des Fortschritts nicht unmittelbar ersichtlich. Die Effizienzsteigerung, die wir sehen, zieht in der Regel eine Entlastung des Fachkräftebedarfs nach sich: Weniger Fachkräfte schaffen in weniger Zeit mehr. Zur selben Zeit sehen wir auch, dass die fortschreitende Technisierung immer mehr Kompetenzen verlangt. Unser Fachkräftemangel könnte daher durchaus in einem Skill-MangelSkill-Mangel münden.
Betrachten wir nun die einzelnen Gruppen, in die Erwerbspersonen in Deutschland eingeteilt werden. Sie wurden 2010 neu definiert, haben Gültigkeit bis heute und geben uns Sicherheit im Umgang mit Studien und Erhebungen (BMWi 2013, S. 7).
Definitionen
Fachkraft
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) versteht heute unter einer »Fachkraft«Erwerbspersoneneinteilung Deutschland, Fachkraft eine Person, die eine abgeschlossene Berufsausbildung unabhängig von Branche und Berufsgattung absolviert hat. Die BA spricht hier von einem Anforderungsniveau 2.
Spezialist
Wurde zur erfolgreich absolvierten Ausbildung aufbauend ein sogenannter Fortbildungsabschluss absolviert, also ein Meistertitel oder ein Technikerabschluss erlangt, spricht die BA von SpezialistenErwerbspersoneneinteilung Deutschland, Spezialist (Anforderungsniveau 3).
Experte
Hochschulabsolventen, also Akademikerinnen und Akademiker, werden in der neuen Einteilung Expertinnen und ExpertenErwerbspersoneneinteilung Deutschland, Experte genannt (Anforderungsniveau 4) (BMWi 2013, S. 7 ff.).
Skills
Unter Skills versteht man in unserem beruflichen Kontext Kompetenzen, die dazu benötigt werden, den Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb des Berufes, den man ausübt, ausführen zu können. Skills können sowohl fachlich als auch überfachlich sein.
Betrachtungen anderer Institutionen subsumieren hingegen unter dem Begriff Fachkraft Personen, die den Anforderungsniveaus 2 bis 4 der BA entsprechen und teilen somit Personen mit Erwerbspotenzial in zwei Gruppen: »mit Ausbildung« und »ohne Ausbildung« ein (DIHK 2014, S. 10). Wir schließen uns dieser schlichteren Definition im Rahmen unserer Ausführungen an. Dennoch wollen wir anmerken, dass eine feine Ausdifferenzierung von Berufsgruppen aus Recruiting-Perspektive eine Notwendigkeitist, um zielgruppenadäquate und maßgeschneiderte Anspracheformate zu entwickeln (vgl. Kapitel 2.3.2 und 3.5.2). Für die Rekrutierung ist es wichtig, zu wissen, ob eine Fachkraft, ein Spezialist oder ein Experte gesucht wird. Tatsächlich wird es in Zukunft wichtig sein, zu wissen, welche Skills genau benötigt werden. Denn unter Umständen kann es sein, dass passende Personen am Markt zu finden sind, denen allerdings entscheidende Skills fehlen. Unter Umständen ließen diese sich nachschulen, um auf diese Weise die geeignete Person für den Job zu erhalten.
Wo immer man hinsieht, berichten durchgängig alle Studien und Untersuchungen von Engpässen und Verknappungen, die sich in den letzten beiden Jahren vornehmlich auf die sich verändernden Rahmenbedingungen der Arbeit durch die Digitalisierung stützen. Bei der Recherche für unsere ersten beiden Auflagen und nun auch für die dritte Auflage haben wir etliche dieser Studien gelesen. Sie alle wirken sehr undifferenziert, zumal nicht immer ganz klar wird, von welchen Definitionen bei der Untersuchung ausgegangen wurde. Mit Blick auf den Indikator »Vakanzzeit« bringen wir ein wenig mehr Schärfe in diese eher undurchsichtige Landschaft von Ergebnissen. So spricht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi 2014, S. 4) von zwei unterschiedlichen Ausprägungen: Es besteht ein FachkräfteengpassFachkräfteengpass, wenn kurzfristig regional und berufsbezogen die Fachkräftenachfrage höher ist als das Fachkräfteangebot. Ein Fachkräftemangel Fachkräftemangelentsteht erst, wenn über Jahre hinweg die Nachfrage höher ist als das Angebot (ebd.). Da die erwähnte Klassifizierung der Berufsgruppen erst im Jahr 2010 erfolgte, ist keine Langzeitbetrachtung möglich und damit auch keine rechnerische Aussage über einen tatsächlichen Fachkräftemangel. Als Hilfskonstrukt hat die Bundesagentur daher den Begriff der SockelengpassberufeSockelengpassberuf eingeführt. Dieser bezeichnet jene Berufsgruppen, die seit September 2011 eine Angebots-Nachfrage-Relation kleiner gleich zwei haben (ebd.). Nach dieser Definition können mit Stand Mai 2023 200 sogenannte Berufsgattungen als Engpassberufe benannt werden (Fachkräfteengpassanalyse 2022, S. 14). Es handelt sich also um Berufe, die über den Betrachtungszeitraum hinweg einen erkennbaren Mangel hatten.
Berufsuntergruppen
Gesamtwert der Engpassindikatoren
Pflegeberufe
2,8
5212 Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW)
2,4
8110 Medizinische Fachangestellte (o. S.)
2,5
2521 Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik
2,5
6330 Berufe im Gastronomieservice (o. S.)
2,3
2621 Berufe in der Bauelektrik
2,7
8111 Zahnmedizinische Fachangestellte
2,8
2441 Berufe im Metallbau
2,2
5311 Berufe im Objekt-, Werte- und Personenschutz
2,0
6231 Berufe im Verkauf von Back-, Konditoreiwaren
2,2
Tab. 1: Top Ten Engpassberufe »Fachkräfte« – Stand 2022
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, monatliche Sonderauswertungen, eigene Berechnungen
Obwohl diese Herangehensweise rechnerisch klare Hinweise auf einen bestehenden und auch voranschreitenden Mangel an Fachkräften lieferte und dies heute auch mit der Berechnung auf Basis der Vakanzzeiten tut, wurden und werden immer noch Schwächen dieser Vorgehensweise benannt (BMWi 2013, S. 7 ff.). Eines der Hauptargumente gegen diese Berechnungen ist die Kenntnis davon, dass nur jede zweite zu besetzende Stelle der Agentur gemeldet wird sowie die Abmeldung besetzter Stellen verzögert geschieht. Es kann daher keine allumfängliche rechnerisch fundierte Aussage zu Mangel- und Engpasszuständen getroffen werden. Besonders im Bereich der höher qualifizierten Berufe und bei neuen Berufsgruppen, die sich im Umfeld der Informationstechnologie entwickeln, sehen wir hier eine große Meldelücke. Wir nehmen aber an, dass unter Einbezug dieser sich in einer Grauzone befindlichen Vakanzen deutliche Indizien für Engpässe und Mangelsituationen aufgezeigt werden können. Des Weiteren wird bei der errechneten Angebots-Nachfrage-Relation unterstellt, dass eine gemeldete Stelle in Baden-Württemberg mit einer arbeitslos gemeldeten Person aus Berlin besetzt werden könnte. Diese berufliche Mobilität stellt sich in der Realität teilweise etwas anders dar und lässt die Studien hier unscharf erscheinen. Ebenso wird nicht berücksichtigt, dass eine gemeldete Stelle auch von einer artverwandten Berufsgattung besetzt werden kann. Beispielsweise könnte eine Stelle, die für einen Elektriker (m/w/d) ausgeschrieben ist, auch mit einem Mechatroniker (m/w/d) besetzt werden. Trotz der in der Methodik begründeten Schwachstellen dieser Erhebungen können wir von einem Trend in Richtung Mangel- und Engpassberufen ausgehen. Grundsätzlich gilt unserer Meinung nach aber die Empfehlung, voreilig entdeckte Engpässe nochmals zu hinterfragen.
Um die Begrifflichkeit »FachkräftemangelFachkräftemangel, Definition« nun abschließend zu definieren, ziehen wir aus der Vielzahl existierender Definitionen eine aus dem Jahr 2014 heran, die unseres Erachtens nach wie vor Gültigkeit besitzt. Diese Definition beschreibt zwei unterschiedliche Arten von Mangelzuständen auf dem Markt, berücksichtigt zudem die schon angesprochene Angebots-Nachfrage-Relation und bezieht schließlich alle Qualifikationsniveaus mit ein:
Definition
Fachkräftemangel
»Fachkräftemangel ist [...] gegeben, wenn unter Berücksichtigung der beruflichen Flexibilität der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften erkennbar und dauerhaft über dem Angebot an ausgebildeten Fachkräften liegt. Hiervon abzugrenzen ist der Arbeitskräftemangel, der die notwendige berufliche Qualifikation nicht berücksichtigt und auch nicht formal beruflich Qualifizierte mit einbezieht« (BIBB et al. 2014, S. 3).
Wir haben nun mehrfach schon den Begriff des Skills hier erwähnt und müssen nun an dieser Stelle erneut darauf hinweisen. Die Definition des Fachkräftemangels unterschreiben wir weiterhin so und würden diese nun noch durch die Definition des SkillmangelsSkill-Mangel, Definition (Skill Gap) ergänzen. Wir befinden uns in einer derart schnelllebigen Welt, die nicht nur viele Technologiesprünge hervorbringt, sondern ebenso schnell Anforderungen an neue Kompetenzen stellt. Das heißt, auch wenn ich geeignetes Personal finde, ist immer häufiger davon auszugehen, dass dieses nicht vollumfänglich bereits alle Skills beherrscht, die für die Ausführung der Tätigkeiten notwendig sind.
Definition
Skill-Mangel
Ein Skill-Mangel ist gegeben, wenn die nachgefragten Skills der Wirtschaft sich nicht erkennbar und dauerhaft in den Curricula der Grundausbildung in den unterschiedlichsten Fächern sowie dem Bildungsweg widerspiegeln. (Definition der Autoren, 2024)
Es lässt sich also als erste rechnerisch bestätigte Aussage festhalten, dass es in verschiedenen Berufsgattungen klare Hinweise auf bestehende Mangelzustände gibt, die sich unserer Meinung nach ausweiten und manifestieren werden. Es besteht aber in Deutschland kein flächendeckender und branchenübergreifender Mangel an Fachkräften (Bundesagentur für Arbeit 2011, S. 5).
Das aufgezeigte Vorgehen zur Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) beschreibt nur eine Momentaufnahme und lässt keine Vorhersagen bezüglich zukünftiger Veränderungen zu. Wir sehen dennoch in den Ergebnissen eine wichtige Bestätigung für die Notwendigkeit eines erfolgreich strategisch ausgerichteten Recruitings. Für diese notwendige Weitsicht ziehen wir für unsere folgenden Ausführungen Studien und Projektionen heran, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und der Arbeitskräftenachfrage sowie das diesen beiden entgegen stehende Arbeitskräfteangebot zu betrachten und, ausgehend von einem empirischen Maßnahmenbündel, hierzu Prognosen aufzustellen. Hierfür eine geeignete Auswahl an Studien zu finden, scheint aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Erhebungen, Analysen und Prognosen schwer. Neben den anerkannten staatlichen Stellen und Ministerien, wie das Statistische Bundesamt, die Agentur für Arbeit oder das Institut für Arbeitsforschung (IAB), führen auch die großen Arbeitgeberverbände, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) oder der Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Untersuchungen durch. Darüber hinaus existieren verschiedenste Studien, die ihren Fokus auf lokale Gegebenheiten richten oder auch einzelne Berufsgruppen zum Gegenstand der Untersuchung machen. Für die folgenden Darstellungen werden vornehmlich Studien der staatlichen Behörden sowie ausgewählte Studien großer Arbeitgeberverbände zugrunde gelegt.
Ein Blick in die Zukunft ist auch immer ein Wagnis, da sich Veränderungen nicht linear und eindimensional vollziehen, sondern sich in einem komplexen Gefüge abspielen. Daher müssen in Bezug auf das in der Zukunft vorherrschende Angebot an Arbeitskräften und die entsprechenden Nachfragen grundlegende Annahmen über gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen getroffen werden. Im Rahmen einer Metastudie, die von der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt wurde (Heidemann 2012), wurden unter Berücksichtigung anderer Studien Annahmen getroffen, die eine Projektion ins Jahr 2030 zulassen. Diese Projektionen geben einen guten Ausblick auf die geänderten Rahmenbedingungen und den daraus resultierenden Fachkräftebedarf. Die Basis dieser Projektionen bilden zwei Annahmen: Zum einen wird davon ausgegangen, dass die demografische Entwicklung, die durch die alternde und abnehmende Erwerbsbevölkerung und die schwachen nachfolgenden Geburtenjahrgänge gekennzeichnet ist, nicht genügend neue Erwerbspersonen auf den Markt bringen wird. Zum anderen geht man davon aus, dass sich die am Markt nachgefragten Qualifikationen drastisch ändern werden (ebd., S. 3 ff.). Hier wurde der zunehmenden Digitalisierung vieler Berufe bereits Rechnung getragen. Diese Annahmen werden durch die Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland (Bundesagentur für Arbeit 2011) unterstrichen, in der ebenso von einem deutlichen Rückgang des Arbeitskräftepotenzials ausgegangen wird.
Neben diesem demografisch begründeten, erkennbaren Rückgang an Arbeitskräften wird durch den Wandel der Wirtschaft hin zu wissensintensiven Produktionsprozessen, bei denen wir von »Industrie 4.0Industrie 4.0« sprechen, und (digitalen) Produkten die Nachfrage nach höher Qualifizierten in den nächsten Jahren zunehmen (Heidemann 2012, S. 12). Auch die Fertigungstiefe wird aufgrund der voranschreitenden Rationalisierung und Automatisierung am Standort Deutschland abnehmen und beratungsintensive Dienstleistungen sowie vor allem auch immer mehr digitalisierte Formen der Dienstleistungserbringung hervorbringen. »Deutsch, land wird seinen Weg in die Dienstleistungsökonomie mit Nachdruck fortsetzen« (Vogler-Ludwig/Düll 2013, S. 83). Dies führt dazu, dass die sogenannten Unternehmens- und Beratungsdienste bis 2030 allein in diesen Bereichen 750.000 neue Arbeitsplätze schaffen werden (ebd.). Hier sind vor allem Ausbildungen auf Hochschulniveau angesprochen, die sich vornehmlich mit der Wissensverarbeitung und Informationstechnologie beschäftigen. Duale Ausbildungsgänge werden der Projektion zufolge keine großen Einbußen verzeichnen und nach wie vor ein wichtiger Garant für den Produktionsstandort Deutschland sein (ebd.). Dagegen werden Tätigkeiten in produktionsnahen Bereichen, die keine Ausbildung erfordern, zurückgehen. Per saldo wird es im zukünftigen Arbeitsmarkt neben Mangel an Fachkräften auch Überschüsse an Erwerbspersonen geben. Darauf müssen sich nicht nur das Recruiting, sondern ebenso die Unternehmen und allen voran die Politik einstellen und geeignete Maßnahmen zur Qualifizierung und Weiterbildung schaffen, um so aktiv gegen das drohende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu arbeiten.
Der ansteigende Bedarf an Personen mit Hochschulabschluss trägt der angesprochenen Wissensintensivierung unserer Wirtschaft Rechnung. Hierbei entfallen die meisten dieser Stellen auf die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Damals war noch nicht abzusehen, wie stark die Digitalisierung Fahrt aufnehmen wird. So ist zum Beispiel die Zahl der erwerbstätigen Computerexperten im Jahre 2017 auf knapp eine Million gestiegen (Bundesagentur für Arbeit 2018, S. 4). Dazu kommen mehr als 17.000 gemeldete offene Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit (ebd.) und der Anstieg der Zahl der Studierenden im Bereich der IT auf den Höchststand von 25.000 (ebd.). Im Rahmen der dualen Ausbildung wird es zu einer verstärkten Nachfrage von Erwerbstätigen in den Bereichen der Gesundheits- und Pflegeberufe geben. Dies liegt vornehmlich in der alternden Gesellschaft begründet. Die Zahl der ausgebildeten Fachkräfte sowie die Nachfrage nach Auszubildenden in Fertigungsberufen wird gleich bleiben und sich vornehmlich im Bereich der Digitalisierung erhöhen, wogegen in den Bereichen der Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen sein wird – diese sind für den negativen Ausschlag verantwortlich (Vogler-Ludwig/Düll 2013). Wird der Fokus auf den gesamten Arbeitsmarkt gerichtet, so lässt sich auch mit einem unterstellten Rückgang der Arbeitslosigkeit und einem in den Studien bereits eingerechneten jährlichen Zuzug von 200.000 ausländischen Erwerbspersonen ab dem Jahr 2020 (Heidemann 2012, S. 7 ff.) eine deutliche Fachkräftelücke identifizieren. Es werden laut Vogler-Ludwig/Düll (2013) jedes Jahr ca. sieben Millionen Arbeitskräfte benötigt, die den sogenannten Ersatzbedarf ausmachen, also die Lücken füllen, die durch das altersbedingte Ausscheiden aus dem Berufsleben entstehen. Wird zeitgleich ein konstantes Wirtschaftswachstum in der Projektion berücksichtigt, so werden wir in den nächsten Jahren die Fachkräftelücke nicht vermeiden können.
Trotz des angesprochenen Rückgangs an Arbeitslosen, des verringerten Bedarfs an Fachkräften in den Bereichen der dualen Ausbildung sowie der reduzierten Nachfrage bei Erwerbspersonen ohne Ausbildung bleibt eine deutliche Fachkräftelücke. Um diese Lücke zu schließen, hat die Bundesagentur für Arbeit ein Maßnahmenpaket entwickelt, welches viele Aspekte berücksichtigt, die aus politischer Perspektive aktiv in die Gesamtausrichtung gegen den drohenden Fachkräftemangel eingebracht werden können. Auch McKinsey Deutschland (2011, S. 21 ff.) hat sich dieses Themas umfassend angenommen und formuliert unter Berücksichtigung der von der BA veröffentlichten Aspekte ein umsetzungsorientiertes Maßnahmenbündel. Die Bundesagentur für Arbeit setzt dabei auf ihre Kernkompetenzen, die sich mit der strategisch ausgerichteten Bearbeitung des Arbeitsmarktes beschäftigen. Neben der Qualifizierung bildungsferner Schichten sowie der Um- und Weiterqualifizierung von Erwerbspersonen will die BA zukünftig auch die Anwerbung von ausländischen Fachkräften vorantreiben. Zudem werden die von der Politik beschlossene Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie die nachhaltige Aufstockung des Frauenanteils ihren Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten (Bundesagentur für Arbeit 2011, S. 10 ff.). McKinsey Deutschland (2011, S. 21 ff.) betrachtet dieses Maßnahmenpaket in ihrer Veröffentlichung aus Unternehmensperspektive und erweitert die Maßnahmen um moderne Managementinstrumente, die sich konzeptionell mit Talentmanagement und einem zielgerichteten Recruiting beschäftigen. Im Rahmen des DIHK-Arbeitsmarktreports 2014 befragte die DIHK ihre Mitgliedsunternehmen dahin gehend, welche Maßnahmen aus Sicht der Unternehmer angedacht werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Neben den Punkten Ausbildung/Qualifizierung und Steigerung der Zahl älterer Arbeitnehmer im Unternehmen gehören das Recruiting im Allgemeinen, das Recruiting ausländischer Arbeitskräfte sowie die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zu den fünf wichtigsten der geplanten und als notwendig angesehenen Maßnahmen. Somit nimmt das Recruiting bei allen Befragungen und Erhebungen einen zentralen Stellenwert ein.
Deutlich wird, dass Politik und Wirtschaft die Problematik erkannt haben und entsprechende Maßnahmenkonzepte auf den Weg bringen oder bereits gebracht haben, um gemeinsam mit den Unternehmen an der unausweichlichen FachkräftelückeFachkräftelücke zu arbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob alle Maßnahmen zielführend umgesetzt werden können und die Fachkräftelücke, auf die wir faktisch gesehen zusteuern, dadurch reduziert werden kann. Als eine der wichtigsten Reaktionen aufseiten der Betriebe sehen wir neben den strukturellen Änderungen der Rahmenbedingungen von Arbeit auch ein optimal auf die erforderlichen Zielgruppen ausgerichtetes und funktionierendes Recruiting.
Um die eigenen Recruiting-Bemühungen auf eine strategisch-operative Ebene zu heben, muss vorab auch eine Auseinandersetzung mit den im ArbeitsmarktArbeitsmarkt bestehenden Gegebenheiten und Strömen stattfinden. Dieser Diskussion wollen wir im Folgenden nachgehen und den Arbeitsmarkt als solches unter die Lupe nehmen.
2.2 Der Arbeitsmarkt
Der Arbeitsmarkt bildet den Rahmen und ist auch gleichzeitig die Aktionsfläche des Recruitings. Hier kommen die Maßnahmenbündel in ihre Umsetzung und treffen im Idealfall direkt auf die anvisierten Zielgruppen. Es ist daher unerlässlich, das Marktgeschehen näher zu betrachten und das Recruiting daran auszurichten. Zunächst wollen wir der Frage nachgehen, wie aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Sicht der Arbeitsmarkt definiert wird und welche Spezifika diesen Markt ausmachen. Das daraus abgeleitete Marktgeschehen soll anschließend auf das Recruiting übertragen werden, um abschließend den Fokus auf die differenzierbaren Markteilnehmer zu lenken.
Ein Markt entsteht automatisch, wenn Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Auf dem Arbeitsmarkt werden, analog der aufgegriffenen Marktdefinition, ebenfalls Tauschgeschäfte vollzogen. Es existieren Nachfrage und Angebot. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wird durch die Unternehmen bestimmt. Die Anbieter sind in dieser Konstellation die Arbeitnehmer. Das angebotene Gut, hier die personenbezogene Arbeitsleistung, wird in Zeiteinheiten angeboten und gemessen. Für das Tauschgeschäft bringen die Unternehmen sogenannte Transferleistungen ein: den (Zeit-)Lohn (Franz 2006, S. 20).
Definition
Markt
»Der Markt ist der ökonomische Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage, an dem sich Preisbildung und Tausch vollziehen« (Woll 2000, S. 496).
In einer weiterführenden verfeinerten Betrachtung des Arbeitsmarktes lassen sich in der Literatur zwei unterschiedliche Ansätze finden: Der Arbeitsmarkt kann auf der einen Seite als FaktorenmarktArbeitsmarkt, als Faktorenmarkt bezeichnet werden. Dies bedeutet, dass der Arbeitsmarkt in Teilarbeitsmärkte zerlegt werden kann, beispielsweise nach Branchen und Regionen (Woll 2000, S. 277). In der anderen Sichtweise liegt der Fokus auf dem Tauschgut, das auf dem Arbeitsmarkt in Form von Arbeitszeit existent ist. In der sich daraus ergebenden Definition wird der Arbeitsmarkt als GütermarktArbeitsmarkt, als Gütermarkt beschrieben (Kortendieck 2009, S. 65). Der Arbeitsmarkt kann zusammenfassend aus volkswirtschaftlicher Perspektive als ein nicht vollkommener Markt bezeichnet werden, da die sieben definierten Kriterien eines vollkommenen Marktes nicht eingehalten werden (Wöhe 2002, S. 297). Die von Gerhard Brinkmann (1981, S. 225) veröffentliche DefinitionArbeitsmarkt, Definition fasst die angesprochenen Vorgänge am Arbeitsmarkt zusammen und soll als Grundlage für die folgenden Ausführungen dienen:
Definition
Arbeitsmarkt
Der Arbeitsmarkt ist der Ort, »[...] an dem die Nachfrage nach Arbeitskräften mit dem Selbstangebot von Arbeitskräften zusammentrifft« (Brinkmann 1981, S. 225).
Für die Konzeption der zukünftigen Recruiting-Bemühungen ist aus unserer Sicht vor allem die umgekehrte Aussage grundlegend und soll besonders hervorgehoben werden: Unternehmen sind die Anbieter von Stellen. Sehr folgerichtig wird schon seit Längerem das Stellenangebot am Markt platziert. Mit dieser veränderten Formulierung deutet sich schon erstmals der vollzogene Wandel des Arbeitsmarktes an. Der Arbeitnehmer (Arbeitsnachfragende) besitzt die Handlungsinitiative, zwischen verschiedenen Angeboten zu vergleichen und auszuwählen. Der Anbieter, das Unternehmen, ist daher angehalten, das Angebot so präzise und attraktiv wie möglich zu formulieren bzw. zu präsentieren. Um nun als Unternehmen Angebote gezielt zu platzieren, müssen wir uns in dieser veränderten Situation genauer mit den Arbeitsmärkten beschäftigen.
Abb. 1:
Differenzierung des ArbeitsmarktesQuelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Berthel/Becker 2013, S. 235
2.2.1 Teilarbeitsmärkte
Aus Sicht der Personalsuche handelt es sich bei den zu definierenden TeilarbeitsmärktenTeilarbeitsmarkt, als Beschaffungsmarkt in erster Linie um Beschaffungsmärkte, die es zu bearbeiten gilt. Die erste Entscheidung, die dabei zu treffen ist und bei der es sich mithin auch um die erste grobe Teilung der Beschaffungsmärkte handelt, ist die Einteilung nach internenBeschaffungsmarkt, interner oder externenBeschaffungsmarkt, externer Märkten. Soll die Vakanz intern besetzt werden, greifen dabei vornehmlichaus der Personalentwicklung bekannte Instrumente wie Jobrotation oder Jobenrichment. Bei diesen Kandidaten handelt es sich in aller Regel um Personen, die schon einer vergleichbaren Tätigkeit nachgehen. Auch interne Nachfolgeplanungen oder Ansätze eines internen Talentmanagementprogramms dienen als interne Märkte, jedoch handelt es sich bei diesen Kandidaten oft um Personen außerhalb des anvisierten Tätigkeitsbereichs. Liegen externe Märkte im Fokus der Beschaffung, so lassen sich inländische und ausländische Teilarbeitsmärkte identifizieren. Auf das Recruiting in ausländischen Arbeitsmärkten wollen wir in Kapitel 5 im Besonderen eingehen. Daher soll im Folgenden vertiefend auf die externen inländischen Teilarbeitsmärkte eingegangen werden:
Regional und überregional
Die hier vorgenommene Einteilung spiegelt vornehmlich die geografischen Gegebenheiten des gesamtdeutschen Arbeitsmarktes wider. Die Bundesagentur für Arbeit nimmt seit der Zusammenführung der ost- und westdeutschen Arbeitsmärkte lediglich eine Zweiteilung vor. Dabei ist zu beachten, dass sich diese Märkte je nach Standort ganz unterschiedlich ausprägen können. Ob du beispielsweise überregional auf der schwäbischen Ostalb Fachkräfte suchst oder aber in München, ist ein großer Unterschied und bedarf einer differenzierten Betrachtung der jeweiligen Recruiting-Strategien. So strahlt München bei einer überregionalen Suche eine deutlich höhere Standortattraktivität aus als die Ostalb. Unternehmen an weniger attraktiven Standorten sind daher häufig dazu gezwungen, eine Art Standortmarketing mitzuliefern, wenn sie sich auf dem überregionalen Arbeitsmarkt bewegen. Umgekehrt ist es so, dass der regionale Arbeitsmarkt in München hart umkämpft ist. Er zwingt die Unternehmen, teilweise in den überregionalen ArbeitsmarktTeilarbeitsmarkt, überregional zu wechseln. Dieser Herausforderung müssen sich viele der in ländlicheren Gegenden ansässigen Unternehmen vielleicht gar nicht stellen, da der regionale ArbeitsmarktTeilarbeitsmarkt, regional nur wenig Konkurrenz bietet.
Branche/Beruf/Qualifikation
Die Markeinteilung nach Branche, Beruf und Qualifikation zeichnet, einzeln betrachtet, sehr homogene Teilbereiche des Marktes aus. Diese Teilmärkte weisen in aller Regel eine überregionale Struktur auf und besitzen unterschiedlich viele Marktteilnehmer. Branchenspezifische ArbeitsmärkteTeilarbeitsmarkt, branchenspezifischer sind meist in sich geschlossen und bilden unterschiedliche branchenbezogene Berufe und Qualifikationen ab. Hier lassen sich die meisten Kandidaten finden. In Teilarbeitsmärkten, die sich an Berufen orientieren, finden sich Kandidaten wieder, die eine vergleichbare Ausbildung absolviert haben. Hier wird auch von NischenmärktenTeilarbeitsmarkt, Nischenmarkt gesprochen, die eine sehr zielgerichtete und spezialisierte Bearbeitung voraussetzen. Qualifikationsbezogene TeilarbeitsmärkteTeilarbeitsmarkt, qualifikationsbezogener bestehen oftmals aus sehr kleinen und meist sehr speziell qualifizierten Gruppen von Kandidaten, die je nach Qualifikation teilweise nur aus weltweit zwei bis drei Kandidaten bestehen können. Hier kommt ein auf persönliche Kontakte und Netzwerke bezogenes Recruiting zum Einsatz.
Sozialpolitische Einteilung
Im Rahmen einer von der Sozialpolitik vorgenommenen Einteilung wird zwischen dem 1. ArbeitsmarktTeilarbeitsmarkt, 1. Arbeitsmarkt und dem 2. ArbeitsmarktTeilarbeitsmarkt, 2. Arbeitsmarkt unterschieden. Oftmals ist auch vom 3. ArbeitsmarktTeilarbeitsmarkt, 3. Arbeitsmarkt die Rede. Die Stoßrichtung dieser Einteilung wird aus der Förderperspektive vorgenommen. Der 1. Arbeitsmarkt ist demnach der Markt, in dem reguläre Arbeitsverhältnisse bestehen, die auf Basis des genannten Marktprinzips und ohne Förderung zustande gekommen sind. Der 2. Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet von staatlich subventionierten Beschäftigungsverhältnissen, die ohne diese Förderung nicht bekundet werden können. Ziel der am 2. Arbeitsmarkt Geförderten ist der (Wieder-)Eintritt in den 1. Arbeitsmarkt (Oschmiansky et al. 2014, S. 7 ff.). Der 3. Arbeitsmarkt wird auch Ersatzarbeitsmarkt genannt. Hier finden jene Personen eine Beschäftigung, die aufgrund von Handicaps als »arbeitsunfähig« gelten.
Sonderform: versteckter Arbeitsmarkt
Der versteckte ArbeitsmarktTeilarbeitsmarkt, versteckter Arbeitsmarkt gilt als Sonderform, da er offiziell nicht existiert. Die im Vorfeld genannten Teilarbeitsmärkte finden ungeachtet ihrer Ausprägung offensichtlich und für jedermann zugänglich statt. Ihnen steht der versteckte Arbeitsmarkt gegenüber, der den Zugang von außen kaum zulässt, da dieser »unter der Hand« stattfindet. Es ist bekannt, dass nur jede dritte Stelle öffentlich sichtbar ausgeschrieben wird. Die anderen Stellen werden durch Marktteilnehmer des versteckten Arbeitsmarktes besetzt. Der Markteintritt in den versteckten Arbeitsmarkt kommt nur über direkte Kontakte, Headhunter oder Personalberater zustande. Eine initiativ platzierte Bewerbung kann darüber hinaus auch den Eintritt ermöglichen.
Abb. 2:
Aktive und passive AkademikerQuelle: eigene Darstellung mit Zahlen aus Trendence HR-Monitor
In all diesen Teilarbeitsmärkten interagieren Personen mit Unternehmen. Der Personenkreis der Erwerbsfähigen lässt sich wiederum in verschiedene Gruppen unterteilen. Suchende, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder eines erst kürzlich erworbenen Abschlusses einer Ausbildung am Markt sind, lassen sich der aktiven Suchgruppe zuordnen. Auch Personen, die sich dazu entschieden haben, eine neue Stelle in einem anderen Unternehmen anzutreten, tun dies aktiv und gehören damit derselben Gruppe an. Für das Recruiting ist diese Gruppe, die auch »ActiveTeilarbeitsmarkt, aktiv Suchende« genannt werden, einfacher zu erreichen als die sogenannten passiv SuchendenTeilarbeitsmarkt, passiv Suchende. Passiv Suchende lassen sich wiederum in drei unterschiedliche Subgruppen einteilen. Zunächst gibt es diejenigen, die mit ihrer Arbeitssituation absolut zufrieden sind. Man könnte diese Gruppe als »Super Passive« bezeichnen. Mitglieder dieser Gruppe interessieren sich nicht für andere Stellen und sind damit praktisch nicht am Markt vertreten. Die »Explorer« sind dagegen diejenigen, die auf der einen Seite zufrieden mit ihrer aktuellen beruflichen Situation sind, aber gleichzeitig offen für Neues stehen. Interessante Angebote mit Perspektive werden gern tiefer gehend geprüft. Zuletzt gehören noch die »Tiptoer« zu den passiv Suchenden. Dies sind die Mitarbeiter, die schon sehr aktiv über einen möglichen Wechsel nachdenken und bereits die Fühler ausgestreckt haben. Die beiden letztgenannten passiv suchenden Gruppen bieten insbesondere Potenzial für das Recruiting. Diese Gruppen sind wählerisch, informieren sich dezidiert und intensiv und können mit den richtigen Argumenten leicht für einen Wechsel gewonnen werden.
Inland/Ausland
Seit der Pandemie und der damit verbundenen Technisierung der Arbeitswelt hat sich der Radius für einzelne Berufsgruppen stark vergrößert. Das Stichwort ist Remote Work und das Phänomen ist global. So wie beispielsweise regionale Unternehmen innerhalb Deutschlands für einige Funktionen begannen, überregional zu rekrutieren, so muss man auch die Brille der potenziellen Bewerber und Bewerberinnen aufsetzen und verstehen, dass auch deren Radien sich verändert haben. Wenn mir gestattet ist, von zu Hause zu arbeiten – und uns ist allen bewusst, dass es natürlich Berufe gibt, in denen das nicht möglich ist –, dann kann ich mir leicht vorstellen, meinen Arbeitgeber in einer anderen Stadt zu suchen oder aber in einem anderen Land. Nach einer Umfrage des Trendence-Instituts im Jahr 2022 gaben 60 Prozent der befragten Akademiker an, dass sie sich durchaus vorstellen können, für ein Unternehmen mit Hauptsitz im Ausland zu arbeiten (Quelle: Trendence HR-Monitor 2022). Wir erleben damit eine enorme Verschiebung des Arbeitsmarktes, so wie wir ihn vor der Pandemie nicht kannten. Nicht nur die Radien veränderten sich, auch das Portfolio der Unternehmen, die wir als Wettbewerb definierten, veränderte sich in dieser Zeit. Auf einmal kann Standortmarketing auf LänderebeneTeilarbeitsmarkt, Standortmarketing auf Länderebene relevant werden.
2.2.2 Dynamik im Arbeitsmarkt
Die schematische Darstellung des Arbeitsmarktes mit seinen Teilarbeitsmärkten kann die am Markt bestehende Dynamik nur schwer abbilden. Die Ströme der einzelnen Märkte mit ihren Teilnehmern bestimmen diese Dynamik. So wurde auch der aus Unternehmensperspektive in den letzten Jahren wichtige und ernst zu nehmende Paradigmenwechsel auf dem Arbeitsmarkt durch die Marktteilnehmer bestimmt: Waren noch in den 1980er- und 1990er-Jahren die Unternehmen diejenigen, die den Arbeitsmarkt bestimmten, so hat sich ein Machtwechsel hin zum Anbieter der Arbeitsleistung vollzogen. Diese Verschiebung hin zum Bewerbermarkt hat weitreichende Konsequenzen für die Personalbeschaffung, deren maßgebliche IndikatorenDynamik im Arbeitsmarkt, Indikatoren nachfolgend vorgestellt werden:
Generationenwechsel
Der bereits nachgewiesene GenerationenwechselDynamik im Arbeitsmarkt, Generationenwechsel stößt unaufhaltsam eine gesellschaftliche Veränderung an, die das Selbstverständnis der neuen nachfolgenden Generationen nicht nur in Bezug auf Arbeit verändert. Vorgreifend kann hier die Generation Z angeführt werden, deren Mitgliedern man nachsagt, dass sie danach streben, Zeitmillionäre zu werden. Natürlich sind nach wie vor typische Idole wie YouTube Stars oder Sänger_innen in den Köpfen der nachwachsenden Generationen, nichtsdestotrotz ist klar erkennbar, dass dem Faktor Zeit eine andere Bedeutung zukommt. Wie flexibles Arbeiten kann man diesen Faktor nicht einer bestimmten Generation zuordnen. Durch die Pandemie hat sich dieser Faktor sogar zu einem globalen Trend entwickelt. Dieser setzt sich nicht nur über Länder hinweg, sondern auch über die Generationen.
Technisierung und KI