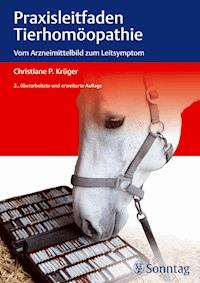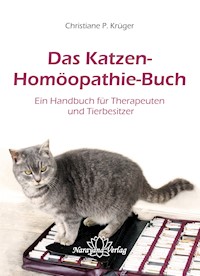86,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sonntag, J
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine praxistaugliche tiermedizinische Materia medica der 39 wichtigsten homöopathischen Arzneimittel für Haus- und Nutztiere mit anschaulichen Praxisbeispielen. Um das Ziel der Homöopathie – Ähnliches mit Ähnlichem heilen – zu erreichen, werden die Mittel in ihrem Wesen dargestellt und klar gegliedert in: - Thema, Signatur und Idee des Mittels - Grundsätzliche Eigenschaften des Mittels - Übersicht über den Krankheitsverlauf - Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten - Auffallende Zeichen und Symptome des Verhaltens - Leitsymptome des pathologischen Geschehens - Auslöser und Modalitäten Neu in der 3. Auflage: - 4 neue Mittel: Carcinosinum Burnett, Echinacea, Natrium phosphoricum, China - Komplett überarbeitet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1016
Ähnliche
Praxisleitfaden Tierhomöopathie
Vom Arzneimittelbild zum Leitsymptom
Christiane P. Krüger
3., überarbeitete und erweiterte Auflage
9 Abbildungen
Vorwort zur 3. Auflage
Homöopathie ist heute in vieler Munde, besonders wenn die therapeutischen Möglichkeiten der Schulmedizin ausgeschöpft sind. Die Zeiten haben sich geändert: Im 19. Jahrhundert gab es die „Allöopathie“, die damalige akademische Medizin, die „anders“ als die Homöopathie angewendet wird und Krankheiten mit dem „Gegensätzlichen“ therapiert. Heute dagegen gehört die Homöopathie zur „alternativen“ Medizin, die es „anders“ als die Schulmedizin macht, indem sie „Ähnliches mit Ähnlichem“ behandelt. Die homöopathische Medizin erlebte ihre Blütezeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Ära der Schulmedizin ließ die Homöopathie seit Anfang des 20. Jh. in den Hintergrund treten, weil sie schnell und einfach Symptome beseitigen kann. Viele Patienten erkennen heute, dass man damit noch lange nicht „gesund“ bzw. geheilt ist. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts befindet sich die Homöopathie nun wieder im Aufschwung.
Die Human-Homöopathie ist heute ein etablierter Zweig der Alternativ-Medizin. Die Veterinär-Homöopathie fristet jedoch – zumindest in Deutschland – noch immer ein verkanntes und untergeordnetes Dasein. Das therapeutische Potenzial der Tierhomöopathie wird bisher noch nicht im Entferntesten genutzt! Erschwerend wirkt sich für die Tierhomöopathie der Umstand aus, dass die Symptome der menschlichen Arzneimittelprüfungen analog aufs Tier übertragen werden müssen. Es gibt zwar heute eine Fülle an veterinärhomöopathischer Literatur; sie ist allerdings mehrheitlich an medizinische und homöopathische Laien gerichtet.
Nur wenige Bücher berücksichtigen die 200 Jahre alten Gesetze der Homöopathie von Hahnemann und vermitteln dem Therapeuten das notwendige und erfolgsentscheidende Basiswissen. Nachvollziehbare Dokumentationen zur homöopathischen Tier-Kasuistik sind leider eine Seltenheit. Homöopathie ist eine Wissenschaft, die nicht im Handumdrehen erlernt werden kann, sondern ein jahrelanges Studium erfordert. Jeder Patient – auch der vierbeinige – erfordert ein spezifisches Vorgehen für die Auswahl seiner individuellen Arznei und den weiteren Verlauf seiner Therapie. Somit wird der Therapeut durch jeden Patienten erneut vor eine neue Herausforderung gestellt. Dabei muss er nicht nur die infrage kommenden Arzneien, sondern auch ihre unterschiedlichen Aspekte ableiten und erkennen können. Einen kleinen Beitrag zur Überwindung dieser Probleme soll dieser „Praxisleitfaden“ leisten. Im Sinne der homöopathischen Meister soll hier das Verständnis für die Beziehung zwischen Ausgangssubstanz und homöopathischem Arzneimittelbild nahegebracht werden. Das mentale Verarbeiten dieser Analogien erleichtert das Verständnis des Arzneimittelbilds und damit das Ableiten der tierspezifischen Symptome aus den Arzneimittelbildern des Menschen. Daraus resultieren eigene Erkenntnisse, die ihrerseits den Impuls geben für das Sammeln weiterer Erfahrungen. So wird die Tier-Homöopathie zu einem faszinierenden Fachgebiet der eigenen Forschung, besonders in Fällen solcher Tier-Pathologien, die es beim Menschen nicht gibt.
Mich selbst haben oft die eigenen Tiere, insbesondere die Pferde, aber auch Patienten mit infauster Prognose dazu getrieben, immer wieder die humanmedizinischen Arzneimittellehren zu studieren, um Symptome des Menschen beim Tier zu verifizieren. Im Sinn des alten Spruches „ubi morbus, ibi remedium“ („Wo eine Krankheit, dort auch ein Heilmittel!“) fällt es mir immer schwer zu akzeptieren, dass kein heilendes – oder zumindest linderndes – Mittel gefunden werden kann. Das betrifft in besonderem Maße solche Pathologien beim Tier, die es beim Menschen nicht gibt. Auf diesem Wege konnte ich zahlreiche neue Erfahrungen sammeln, die sich in der Praxis bestätigt haben und auch in diesem Buch ihren Niederschlag finden.
Die Ergebnisse solcher Erfahrungen lieferten den Stoff für meine zahlreichen veterinärmedizinischen Homöopathie-Seminare und -Veröffentlichungen. Viele Rückmeldungen der Teilnehmer brachten die Bestätigungen für diese Erfahrungen. Pauschale Therapieanweisungen werden Sie in diesem Buch vergebens suchen. Vielmehr ist dieses Buch als „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu verstehen; es will zum Studium der Homöopathie anleiten und Impulse für eigene Assoziationen und Erfahrungen geben. Aus diesem Grund wurde auf ein Stichwortverzeichnis verzichtet, weil der Leser sonst allzu leicht in die Versuchung kommt, unüberlegt „Rezeptanweisungen“ auszuführen. Jeder Patient fordert uns dazu heraus, bei einer Indikation stets das ganze Arzneimittelbild auf seine Simile-Beziehung zum Kranken zu berücksichtigen.
An dieser Stelle möchte ich allen homöopathischen Lehrern danken, die mich besonders durch die – inzwischen fast legendären – „Spiekerooger Wochen“ der 80iger Jahre aus den „Sackgassen“ der Komplexmittel-Homöopathie zu Hahnemann und Kent geführt haben. Zu diesen Lehrern gehört besonders der Schweizer Arzt Dr. Jost Künzli, ferner George Vithoulkas, Masi-Elizalde, Edward Whitmont, Alf Geukens und viele andere. Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Tochter Ina Prisca, die mir unermüdlich mit geschicktem Rat und Wort in Text und Formulierung zur Seite stand und mit Lebensfreude und Humor so manchen Frust im bürokratischen Bereich zu vertreiben weiß. Ferner danke ich meinem Sohn Franz, der mir die überwältigende Fülle der digitalen Datenverarbeitung etwas näher brachte und mit großem Engagement die technischen Aspekte des Schreibens ermöglicht. Ferner gilt mein Dank den zahlreichen Seminar-TeilnehmerInnen, die durch ihren Wissensdurst, durch Mitarbeit und Rückmeldungen aus der eigenen Praxis die Arbeit an der ersten Auflage dieses Buches vorangetrieben haben. Und nicht zuletzt danke ich allen Tierpatienten und ihren Besitzern für ihr Vertrauen.
Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass der „Praxisleitfaden“ so viel Beachtung findet und nun in der 3. Auflage erscheint. Diese habe ich um vier Mittel erweitert. Das Layout wurde wesentlich verbessert und übersichtlicher gestaltet, eine besonders dankenswerte Leistung von Frau Anna Johne – daher ein großer Dank an das Lektorat, welches diese wichtige Arbeit geleistet hat, und ebenso dem Sonntag Verlag.
Möge dieses Buch einen Beitrag leisten, damit das therapeutische Potenzial der Homöopathie Hahnemanns auch für die Tierwelt weiter erschlossen wird!
Hüttlingen (CH), im August 2016
Christiane P. Krüger
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 3. Auflage
Teil I Einführung
1 Human- und Tierhomöopathie
1.1 Hahnemann und das Simile-Prinzip
2 Vom Arzneimittelverständnis zum Leitsymptom
2.1 Arzneimittelbild
3 Zum Aufbau des Buches
3.1 Ganzheitliches Verständnis und homoöpathische Anwendung
3.2 Signatur, Thema, Idee
3.3 Eigenschaften des Mittels
3.4 Übersicht über das Arzneimittelbild
3.5 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
3.6 Zeichen und Symptome des Verhaltens
3.7 Schwerpunkte und Leitsymptome des pathologischen Geschehens
3.8 Auslöser und Modalitäten
3.9 Ausgewählte Fallbeispiele
Teil II Allgemeiner Teil
4 Grundlagen der Homöopathie
4.1 Entwicklung der Homöopathie – Samuel Hahnemann
4.1.1 Entwicklung und Stand der Tierhomöopathie
4.2 Das Ähnlichkeitsgesetz
4.3 Arzneimittelprüfung – Arzneimittelbild – Materia medica homöopathica
4.4 Lebenskraft
4.5 Funktionsweise der Homöopathie
4.5.1 Potenzierung
4.5.2 Einfluss potenzierter Arzneien auf die Lebenskraft
4.5.3 Mögliches Wirkungsprinzip der potenzierten Arznei
4.5.4 Potenzierung – Speicherung einer Information
4.6 Qualitative Kriterien der Homöopathie – Entstehung von Krankheiten
4.6.1 Hierarchisches Ordnungsprinzip in der Homöopathie
4.6.2 Modalitäten
4.6.3 Die wesentlichen Kriterien zum Finden des Simile
4.7 Paradigmen der akademischen und homöopathischen Medizin
4.7.1 Paradigmen der Hochschulmedizin
4.7.2 Paradigmen im modernen ganzheitlichen Denken
4.8 Krankheit – Heilung in der Homöopathie
4.8.1 Krankheit – das Ergebnis einer „inneren Krankheitsbereitschaft“
4.8.2 Unterdrückung einer Krankheit und Abfolge der Heilung
4.8.3 Heilung im Sinn der Homöopathie
4.9 Entstehung chronischer Krankheiten bei Tieren
4.9.1 Die angeborene Krankheitsdisposition
4.9.2 Die erworbene Krankheitsdisposition
4.10 Hahnemanns Theorie über die Entstehung von Krankheiten
4.10.1 Akute und chronische Miasmen
4.10.2 Therapie akuter und chronischer Krankheiten
4.10.3 Einteilung von chronischen Krankheiten – chronischen Miasmen
4.10.4 Arten von Miasmen
4.10.5 Äußerungen der Miasmen
4.10.6 Miasmenlehre in der Tierhomöopathie
4.10.7 Zusammenfassung – Sinn und Aufgabe der Miasmenlehre
4.11 Verschiedene Methoden der Homöopathie
4.11.1 Organotrope Homöopathie
4.11.2 Komplexmittel-Homöopathie
4.11.3 Homöopathie nach bewährten Indikationen
4.11.4 Die Homöopathie Hahnemanns
5 Praxis der Tierhomöopathie
5.1 Die drei Säulen der Homöopathie
5.1.1 Die erste Säule – „Similia“ – der Tierpatient
5.1.2 Die zweite Säule – „Similibus“ – das homöopathische Arzneimittel
5.1.3 Die dritte Säule – „Curentur“ – das Prozedere der Heilung
5.2 Ausnahmen im homöopathischen Prozedere
5.2.1 Das „lokale Übel“
5.2.2 „Einseitige Erkrankungen“
5.3 Der Verlauf der Heilung
5.3.1 Folgeverordnung
5.3.2 Das Ziel der Homöopathie
5.4 Resümee von Kent
Teil III Spezieller Teil – Arzneimittel
6 Aconitum napellus
6.1 Signatur, Thema und Idee
6.2 Eigenschaften des Mittels
6.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
6.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
6.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
6.6 Leitsymptome
6.7 Auslöser und Modalitäten
6.8 Fallbeispiele
6.8.1 Kater Minou – „Angstneurose“
6.8.2 Vollblutstute – perakute Laryngitis
6.8.3 Kolik bei einem Wallach
6.8.4 Absatzfohlen – Panikreaktion
7 Antimonium crudum
7.1 Signatur, Thema und Idee
7.2 Eigenschaften des Mittels
7.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
7.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
7.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
7.6 Leitsymptome
7.7 Auslöser und Modalitäten
7.8 Fallbeispiele
7.8.1 Die mürrische Cockerspaniel-Hündin Karina – Hautausschläge
8 Apis mellifica
8.1 Signatur, Thema und Idee
8.2 Eigenschaften des Mittels
8.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
8.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
8.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
8.6 Leitsymptome
8.7 Auslöser und Modalitäten
8.8 Fallbeispiele
8.8.1 Kuh Alda – Zysten mit Sterilität
8.8.2 Die Kuh Stilli – Klauenrehe
8.8.3 Schwarzbunte Kuh Lämmli – Gabelstich
9 Arnica montana
9.1 Signatur, Thema und Idee
9.2 Eigenschaften des Mittels
9.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
9.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
9.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
9.6 Leitsymptome
9.7 Auslöser und Modalitäten
9.8 Fallbeispiele
9.8.1 Kontraindikation von Arnica
9.8.2 Labrador Largo – Folge einer Bissverletzung
9.8.3 Fuchswallach Lancelot – Der Sprung über die Reithallenbande
9.8.4 Beobachtungen mehrerer Bauern zur Verwendung von Arnica nach der Kuh-Geburt
10 Arsenicum album
10.1 Signatur, Thema und Idee
10.2 Eigenschaften des Mittels
10.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
10.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
10.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
10.6 Leitsymptome
10.7 Auslöser und Modalitäten
10.8 Fallbeispiele
10.8.1 Minka – 20-jährige Katze mit Ekzem
10.8.2 „Unsere Katze spinnt!“
10.8.3 Akaba – Vollblutstute mit chronischer Mauke und Sarkoid
10.8.4 14 Jahre Erfahrung mit eigenen Arsen-Hunden
10.8.5 Datzu
11 Belladonna
11.1 Signatur, Thema und Idee
11.2 Eigenschaften des Mittels
11.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
11.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
11.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
11.6 Leitsymptome
11.7 Auslöser und Modalitäten
11.8 Fallbeispiele
11.8.1 Jungkatze Biene – Tortikollis nach unterdrücktem Fieber
11.8.2 Schweizer Braunvieh-Jungrind – Presswehen nach der Geburt
11.8.3 Akute Atemwegsinfektion einer Kuh
11.8.4 Ponystute Greina – Kolik –homöopathische Arzneiwirkung
12 Bryonia dioica oder cretica
12.1 Signatur, Thema und Idee
12.2 Eigenschaften des Mittels
12.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
12.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
12.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
12.6 Leitsymptome
12.7 Auslöser und Modalitäten
12.8 Fallbeispiele
12.8.1 Yorkshire Rüde – Neuralgie
12.8.2 Hündin Bessy – traumatische Peritonitis
12.8.3 Kalb – Bronchopneumonie
12.8.4 4-jähriges Springpferd – akute traumatische Tendinitis
13 Calcarea carbonica
13.1 Signatur, Thema und Idee
13.2 Eigenschaften des Mittels
13.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
13.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
13.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
13.6 Leitsymptome
13.7 Auslöser und Modalitäten
13.8 Fallbeispiele
13.8.1 Hinterwälder Kalb, 7 Tage alt – Entwicklungsrückstand
13.8.2 Blasenblutungen bei einer Katze
13.8.3 Hombro, Kaltblutwallach – juckender Hautausschlag
13.8.4 Andro, Hovawart-Rüde – Konditionsschwäche
14 Calcium fluoricum naturalis
14.1 Signatur, Thema und Idee
14.2 Eigenschaften des Mittels
14.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
14.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
14.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
14.6 Leitsymptome
14.7 Auslöser und Modalitäten
14.8 Fallbeispiele
14.8.1 Griffelbeinexostosen einer jungen Springpferdstute
15 Calcium phosphoricum
15.1 Signatur, Thema und Idee
15.2 Eigenschaften des Mittels
15.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
15.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
15.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
15.6 Leitsymptome
15.7 Auslöser und Modalitäten
15.8 Fallbeispiele
15.8.1 Fuchswallach – Entwicklungsrückstand
15.8.2 Irländer-Wallach Brandy – Strahlbeinlahmheit
16 Carcinosinum Burnett
16.1 Signatur, Thema und Idee
16.2 Eigenschaften des Mittels
16.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
16.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
16.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
16.6 Leitsymptome
16.7 Auslöser und Modalitäten
16.8 Fallbeispiele
16.8.1 Roxy – Kleinpferd-Wallach – Depression
16.8.2 Legrine – Cheval de Selle Francais – chronisch rezidivierende Hufrehe
17 Causticum Hahnemannii
17.1 Signatur, Thema und Idee
17.2 Eigenschaften des Mittels
17.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
17.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
17.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
17.6 Leitsymptome
17.7 Auslöser und Modalitäten
17.8 Fallbeispiele
17.8.1 Katja – Trakehner Stute mit Laryngitis
18 China – Cinchona officinalis
18.1 Signatur, Thema und Idee
18.2 Eigenschaften des Mittels
18.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
18.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
18.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
18.6 Leitsymptome
18.7 Auslöser und Modalitäten
18.8 Fallbeispiele
18.8.1 Brown-Swiss-Kalb – 6 Wochen alt – Verdauungsstörung
18.8.2 Chiron – Warmblut-Wallach – unklare Lähmung
19 Conium maculatum
19.1 Signatur, Thema und Idee
19.2 Eigenschaften des Mittels
19.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
19.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
19.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
19.6 Leitsymptome
19.7 Auslöser und Modalitäten
19.8 Fallbeispiele
19.8.1 Die Kuh Olga – „Krämpfigkeit“ und traumatisch-entzündliche chronische Liegeschwiele
19.8.2 Serom bei einer 2½-jährigen Angloaraber-Stute
19.8.3 Bonny – Schäferhündin – Astrozytom der Milz
20 Dulcamara
20.1 Signatur, Thema und Idee
20.2 Eigenschaften des Mittels
20.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
20.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
20.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
20.6 Leitsymptome
20.7 Auslöser und Modalitäten
20.8 Fallbeispiele
20.8.1 Cornello – Württemberger Wallach – chronischer Husten
20.8.2 Kater Jasper – generalisierter juckender Hautausschlag
21 Echinacea angustifolia und purpurea
21.1 Signatur, Thema und Idee
21.2 Eigenschaften der Mittel
21.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
21.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
21.5 Leitsymptome
21.6 Auslöser und Modalitäten
21.7 Fallbeispiele
21.7.1 Vaccine-induziertes Sarkom einer Katze
21.7.2 Impfreaktion einer Katze
21.7.3 Gangrän bei einer Kuh
21.7.4 Infektion mit multiresistenten Keimen nach Hüftgelenk-Operation eines Bauern
21.7.5 Vergiftung bei zwei Hunden
21.7.6 Kater Schnurrli – unklare Diagnose mit Leukopenie
22 Graphites – Reißblei
22.1 Signatur, Thema und Idee
22.2 Eigenschaften des Mittels
22.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
22.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
22.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
22.6 Leitsymptome
22.7 Auslöser und Modalitäten
22.8 Fallbeispiele
22.8.1 Hautausschlag hinterm Ohr
22.8.2 Hornige Follikulitis in der Sattellage
23 Hepar sulfuris calcareum ostrearum
23.1 Signatur, Thema und Idee
23.2 Eigenschaften des Mittels
23.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
23.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
23.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
23.6 Leitsymptome
23.7 Auslöser und Modalitäten
23.8 Fallbeispiele
23.8.1 Mirco – Hufabszess und Druse nach „Missbrauch“ von Silicea
23.8.2 Boxerwelpe – pflaumengroßer Abszess
23.8.3 Susi – Pekinesenhündin – Pyodermie
24 Hypericum perforatum
24.1 Signatur, Thema und Idee
24.2 Eigenschaften des Mittels
24.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
24.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
24.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
24.6 Leitsymptome
24.7 Auslöser und Modalitäten
24.8 Fallbeispiele
24.8.1 Paraplegie bei einem Kaninchen
25 Ignatia amara
25.1 Signatur, Thema und Idee
25.2 Eigenschaften des Mittels
25.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
25.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
25.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
25.6 Leitsymptome
25.7 Auslöser und Modalitäten
25.8 Fallbeispiele
25.8.1 Yorkshire-Hündin Kessy – Würgen und Erbrechen beim Autofahren
26 Kalium carbonicum
26.1 Signatur, Thema und Idee
26.2 Eigenschaften des Mittels
26.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
26.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
26.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
26.6 Leitsymptome
26.7 Auslöser und Modalitäten
26.8 Fallbeispiele
26.8.1 Benno – Mischlingsrüde mit „Altersschwäche“, Husten und Herzbeschwerden
27 Lachesis muta
27.1 Signatur, Thema und Idee
27.2 Eigenschaften des Mittels
27.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
27.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
27.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
27.6 Leitsymptome
27.7 Auslöser und Modalitäten
27.8 Fallbeispiele
27.8.1 Miezi – latente Peritonitis
27.8.2 Araber-Wallach – asthmoide Bronchitis
27.8.3 Golda – Nymphomanie, chronische Bronchitis und Headshaken – Unterdrückungsfolgen mit traurigem Ende
28 Lycopodium clavatum
28.1 Signatur, Thema und Idee
28.2 Eigenschaften des Mittels
28.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
28.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
28.5 Auffallende Zeichen und Symptome des Verhaltens
28.6 Leitsymptome
28.7 Auslöser und Modalitäten
28.8 Fallbeispiele
28.8.1 Absatzfohlen Gari – beginnende Kolik
28.8.2 Rüde Ako – Ekzem
28.8.3 Zorro – schwarzer Kater mit Harnwegsproblemen
29 Natrium muriaticum
29.1 Signatur, Thema und Idee
29.2 Eigenschaften des Mittels
29.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
29.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
29.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
29.6 Leitsymptome
29.7 Auslöser und Modalitäten
29.8 Fallbeispiele
29.8.1 Holzi – Hund mit Hautausschlag
29.8.2 Der traurige Wellensittich – Federnrupfen
29.8.3 Die Kuh Alice – rezidivierende Mastitiden
29.8.4 Sandy – Islandwallach – Sommerekzem
30 Natrium phosphoricum
30.1 Signatur, Thema und Idee
30.2 Eigenschaften des Mittels
30.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
30.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
30.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
30.6 Leitsymptome
30.7 Auslöser und Modalitäten
30.8 Fallbeispiele
30.8.1 Ronny – Fuchswallach – Sommerekzem
31 Nitricum acidum
31.1 Signatur, Thema und Idee
31.2 Eigenschaften des Mittels
31.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
31.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
31.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
31.6 Leitsymptome
31.7 Auslöser und Modalitäten
31.8 Fallbeispiele
31.8.1 Wallach Domino – Ulkus nach operiertem Sarkoid, Ulkus im Maul
31.8.2 Wallach Terry – ulzeriertes Sarkoid und Adynamie nach Zytostatika-Therapie
32 Nux vomica
32.1 Signatur, Thema und Idee
32.2 Eigenschaften des Mittels
32.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
32.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
32.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
32.6 Leitsymptome
32.7 Auslöser und Modalitäten
32.8 Fallbeispiele
32.8.1 Buddy – Arzneimittelintoxikation einer Hündin
32.8.2 Vergiftung bei einem Meerschweinchen
32.8.3 Vergiftung mit Holzschutzmittel bei 5 Pferden
32.8.4 Die Katze Iris – Nierenversagen
32.8.5 Ruppi – Homöopathische Arzneimittelvergiftung
33 Opium – Papaver somniferum
33.1 Signatur, Thema und Idee
33.2 Eigenschaften des Mittels
33.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
33.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
33.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
33.6 Leitsymptome
33.7 Auslöser und Modalitäten
33.8 Fallbeispiele
33.8.1 Opium – Antidot gegen Atropin bzw. Belladonna
33.8.2 Kolikverdacht und Inappetenz bei einer Stute
34 Phosphorus
34.1 Signatur, Thema und Idee
34.2 Eigenschaften des Mittels
34.2.1 Phosphor-Ausprägungen bei unterschiedlichen Spezies
34.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
34.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
34.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
34.6 Leitsymptome
34.7 Auslöser und Modalitäten
34.8 Fallbeispiele
34.8.1 Die Kuh Chara – Azetonämie
34.8.2 „Ölpest“ – die Katze Susi
34.8.3 Amaurose bei einem jungen Setter-Hund
35 Plumbum metallicum
35.1 Signatur, Thema und Idee
35.2 Eigenschaften des Mittels
35.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
35.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
35.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
35.6 Leitsymptome
35.7 Auslöser und Modalitäten
35.8 Fallbeispiele
35.8.1 Terrier – chronisch rezidivierender Durchfall
36 Pulsatilla
36.1 Signatur, Thema und Idee
36.2 Eigenschaften des Mittels
36.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
36.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
36.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
36.6 Leitsymptome
36.7 Auslöser und Modalitäten
36.8 Fallbeispiele
36.8.1 Milchmangel bei einer Kuh
36.8.2 Humerusnekrose bei einem Leonberger Rüden
37 Pyrogenium – Sepsinum
37.1 Signatur, Thema und Idee
37.2 Eigenschaften des Mittels
37.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
37.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
37.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
37.6 Leitsymptome
37.7 Auslöser und Modalitäten
37.8 Fallbeispiele
37.8.1 Kuh – subklinische Endometritis
37.8.2 15-jährige Pudelhündin – Zahnwurzelgranulome
37.8.3 Kuh Alina – septische Endometritis
37.8.4 Muttersau des Bauern M. – septische Endometritis
38 Rhus toxicodendron
38.1 Signatur, Thema und Idee
38.2 Eigenschaften des Mittels
38.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
38.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
38.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
38.6 Leitsymptome
38.7 Auslöser und Modalitäten
38.8 Fallbeispiele
38.8.1 Braunvieh-Kuh Mira – Distorsion der Fesselgelenke
38.8.2 Fenstersturz einer Katze
38.8.3 Tendinitis bei einem 5-jährigen Galopper
38.8.4 Amanda – Stute mit akuter Konjunktivitis-Keratitis
38.8.5 Wuschi – Pferd mit Verschlag
39 Ruta graveolens
39.1 Signatur, Thema und Idee
39.2 Eigenschaften des Mittels
39.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
39.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
39.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
39.6 Leitsymptome
39.7 Auslöser und Modalitäten
39.8 Fallbeispiele
39.8.1 Wing – Vollblutwallach – Ganglion am Fesselgelenk
40 Sepia succus
40.1 Signatur, Thema und Idee
40.2 Eigenschaften des Mittels
40.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
40.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
40.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
40.6 Leitsymptome
40.7 Auslöser und Modalitäten
40.8 Fallbeispiele
40.8.1 Die erste homöopathisch behandelte Pyometra einer Schäferhündin
40.8.2 Pyometra bei einem Meerschweinchen
41 Silicea terra
41.1 Signatur, Thema und Idee
41.2 Eigenschaften des Mittels
41.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
41.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
41.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
41.6 Leitsymptome
41.7 Auslöser und Modalitäten
41.8 Fallbeispiele
41.8.1 Tanka – Chronische Lahmheit einer Vollblut-Stute
42 Staphisagria
42.1 Signatur, Thema und Idee
42.2 Eigenschaften des Mittels
42.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
42.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
42.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
42.6 Leitsymptome
42.7 Auslöser und Modalitäten
42.8 Fallbeispiele
42.8.1 Nasenbluten bei einem Pferd
42.8.2 Neurome nach Neurektomie beim Pferd
42.8.3 Laufen lassen der Milch
43 Sulfur
43.1 Signatur, Thema und Idee
43.2 Eigenschaften des Mittels
43.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
43.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
43.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
43.6 Leitsymptome
43.7 Auslöser und Modalitäten
43.8 Fallbeispiele
43.8.1 Hefe-Mastitis einer Kuh
43.8.2 Ulcus corneae nach Kortikoid-Therapie
43.8.3 Fuchswallach – Chronische Urtikaria
43.8.4 Espero – Pyrenäenhund – Unterdrückungsphänomen
44 Thuja occidentalis
44.1 Thema, Signatur und Idee
44.2 Eigenschaften des Mittels
44.3 Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
44.4 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
44.5 Zeichen und Symptome des Verhaltens
44.6 Leitsymptome
44.7 Auslöser und Modalitäten
44.8 Fallbeispiele
44.8.1 Beagle-Hündin Jana – Chronische Otitis externa
44.8.2 Die störrische Eselin Bellinda
45 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Einführung
1 Human- und Tierhomöopathie
2 Vom Arzneimittelverständnis zum Leitsymptom
3 Zum Aufbau des Buches
1 Human- und Tierhomöopathie
1.1 Hahnemann und das Simile-Prinzip
Die homöopathische Medizin wurde vor mehr als 200 Jahren von Samuel Hahnemann begründet und existiert seither in unveränderter, noch immer gültiger und ebenso wirksamer Form.
Hahnemann entwickelte das seit Urzeiten bekannte Gesetz der Entsprechung zu einem medizinischen System mit Diagnose und Therapie für den kranken Menschen:
„Wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden (Homoion Pathos) für sich erregen kann, als sie heilen soll.“
„Similia similibus curentur“ – „Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt“
Homöopathische Arzneien sind hinsichtlich ihrer Wirkung am gesunden Menschen geprüft worden: Nach mehrmaliger Einnahme eines Arzneistoffes reagiert der Proband mit einem „spezifischen Leiden“, d. h., er bekommt definierte Krankheitssymptome.
Ist nun ein Patient aus unterschiedlichen Gründen an eben diesem Leiden erkrankt, so kann ihn derselbe Arzneistoff – in angepasster Dosierung – wieder gesund machen. Dieser Stimulus gibt ihm den Impuls zur Eigenregulation, welche zur Heilung führt.
Ein Spruch des Delphischen Orakels im alten Griechenland lautete:
„Was krank macht, ist auch heilsam.“
Der homöopathische Arzt Dr. Eugenio Candegabe definiert den Sinn der homöopathischen Medizin in einem Satz:
„Homöopathie ist im Grunde genommen ... die Suche nach einer Medikation, die fähig ist, auf geistiger und körperlicher Ebene die fehlgeleitete Dynamik des Organismus, sich an die Welt anzupassen, tief greifend zu modifizieren.“
Gemäß diesen Prinzipien ruht ein enormes Potenzial an Heilungsmöglichkeiten in der homöopathischen Medizin.
Hahnemann trat seit der Entwicklung der Homöopathie auch für ihre Anwendung am Tier ein.
Die Humanhomöopathie hat in den letzten 40–50 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt, um den Erkrankungen der Gegenwart gerecht zu werden. Generell hat eine Verschiebung im Schwerpunkt von Krankheiten bei Mensch und Tier stattgefunden.
Während zu Hahnemanns Zeiten akute und infektiöse Pathologien im Vordergrund standen, so sind es heute eher vegetativ bedingte und chronisch verlaufende Zustände.
Speziell für die Therapie von Haustieren gelten heute andere Bedingungen als noch vor 100 Jahren. Viele Kleintiere werden als Kind- und Partnerersatz gehalten und spiegeln in ihren Krankheiten die psychischen und körperlichen Probleme ihrer Bezugspersonen wider. Ferner gibt es Krankheitszustände von Tieren, die aus besonderen, spezialisierten Nutzungs- und Haltungsarten resultieren. Der homöopathische Therapeut muss z.B. den Erkrankungen des heutigen Sportpferdes ebenso gerecht werden wie denen der Hochleistungs-Milchkuh oder denen von Ratten oder Meerschweinchen.
Schließlich – und nicht zuletzt – hat sich auch das Verhältnis des Menschen zu Natur und Tier weiterentwickelt, sodass heute ein intensiverer Zugang zum Lebewesen zustande kommt.
Das Potenzial der Homöopathie ist noch nicht im Entferntesten ausgeschöpft.
Wenn der Zentralverein homöopathischer Ärzte verlauten lässt, die homöopathische Medizin für den Menschen stehe noch am Anfang, so gilt das in noch wesentlich höherem Maße für die Tierhomöopathie.
Die homöopathische Veterinärmedizin kann erst angemessen genutzt werden, wenn sie nach denselben Grundsätzen therapiert wie die heutige klassische Humanhomöopathie ( ▶ Abb. 1.1).
Nur vereinzelte Therapeuten setzen bereits heute die Homöopathie am Tier nach den Kriterien von Hahnemann und Kent ein.
Abb. 1.1 Die drei Säulen der Homöopathie.
Im vorliegenden Buch wird erstmals für die Veterinärmedizin der Versuch unternommen, die Kernideen und Leitsymptome einiger der häufigsten homöopathischen Arzneimittel so darzustellen, dass sie den Anforderungen einer modernen homöopathischen Praxis gerecht werden, wie es heute in der Humanhomöopathie üblich ist. Damit möge sich die Tierhomöopathie ein wenig dem Niveau der Humanhomöopathie annähern.
Es ist das wesentliche Anliegen des Buches, Impulse zum Verständnis von homöopathischer Arznei und Tierpatienten zu geben. Die Einsicht in das Wesen des Arzneistoffes lässt die homöopathischen Mittel zu lebendigen Bildern werden, in denen die Einzelsymptome einen Bezug zum Ganzen gewinnen. So erhält das Arzneimittelbild einen Zusammenhalt: Als in sich geschlossener Bewusstseinsinhalt steht es dem Gedächtnis für einzelne assoziative Bezüge zu den Zeichen und Symptomen der Patienten zur Verfügung.
Dagegen bringt das reine Auswendiglernen von Symptomen und Indikationen genauso viel zusammenhangloses Stückwerk, als wollte man sich eine lebendige Fremdsprache durch Vokabellernen aus dem Lexikon aneignen.
Das Verständnis von Wesen und pathophysiologischen Reaktionsweisen unserer Tierpatienten ist eine Voraussetzung für die Verordnung des passenden Simile. Kent sagt dazu:
„Gedächtnis ist so lange nicht Wissen, solange die Sache nicht begriffen und angewandt worden ist.“
Jeder homöopathische Therapeut steht vor dem Problem, aus der unspezifischen Materia medica homöopathica das individuell passende Arzneimittel für Zustand und Pathologie des Patienten herauszufinden. Dabei zeigt jeder einzelne Patient einen unterschiedlichen Ausschnitt aus dem jeweiligen umfassenden Arzneimittelbild.
Aber auch jede Spezies und manche Rassen zeigen schwerpunktmäßige Bezüge zu bestimmten Arzneimitteln oder deren Facetten. In den Arzneimitteldarstellungen werden ganz spezifische Eigenheiten der Haustiere in ihrer individuellen Ausprägung mit Pathologie aufgezeigt. Es handelt sich dabei größtenteils um Mittel, die über ein besonders breites Wirkungsspektrum verfügen und als Polychreste bezeichnet werden.
Der homöopathische Arzneischatz, die „Materia medica homöopathica“, basiert auf Arzneimittelprüfungen am Menschen. Damit ist auch der Mensch für die Tierhomöopathie immer die entscheidende Bezugsgröße – für viele Therapeuten ein ungewohnter Denkvorgang. Dennoch finden wir am Tier nichts, das nicht – zumindest latent oder homolog – auch im Menschen vorhanden ist, seien es körperliche Organe, Verhaltensmuster oder die Grundform einer Pathologie.
Die humanmedizinische Materia medica lässt sich erfahrungsgemäß grundsätzlich analog am Tierpatienten anwenden, bedarf jedoch in vielen Fällen besonderer Überlegungen. Ein versierter Humanhomöopath zu sein, impliziert nicht gleichzeitig den guten Tierhomöopathen – und umgekehrt.
2 Vom Arzneimittelverständnis zum Leitsymptom
2.1 Arzneimittelbild
James Tyler Kent, einer der wichtigsten Nachfolger Hahnemanns, prägte den Aphorismus:
„Erfasse zuerst das Mittel, dann die Leitsymptome.“
Dieser Ausspruch passt in vollkommener Weise zum Thema und Aufbau des vorliegenden Buches.
Unter Mittel versteht Kent die ursprüngliche Form und Bedeutung, die „grundlegende Natur“ eines Arzneistoffes, gleichsam als materieller Ausdruck einer geordneten „In-Form-ation“. Leitsymptome nehmen darin eine wesentliche Stellung ein, sind den anderen Symptomen des Arzneimittelbilds übergeordnet und ermöglichen so den Zugang zum Krankheitsbild des Patienten.
Das Verständnis der grundlegenden Natur eines Mittels erleichtert das Erkennen von analogen Zusammenhängen und das bildhafte Erlernen homöopathischer Arzneimittel. Arzneimittelbilder umfassen Auslöser, Entwicklung und Schwerpunkt einer Pathologie, das Erscheinungsbild des Patienten, seine Gemütsverfassung und sein Verhalten. Wer ein Arzneimittel in seiner grundlegenden Natur verstehen will, muss eine übergeordnete „Idee“ des Mittels im Sinn haben, welche dessen „Gesamtheit der Symptome“ gleichsam im Innersten zusammenhält und damit dem „Inbegriff der Symptome“ sehr nahe kommt. Das ist Hahnemanns Ausdrucksweise für das Wesentliche einer Arznei.
Dieses „geistige Band“ macht die „Summe der Teile“ – der Einzelsymptome eines Arzneimittelbildes – zu „einem Ganzen“, das dem Homöopathen als erlernter und verstandener Bewusstseinsinhalt zur Verfügung stehen sollte. Autoren der Humanhomöopathie bezeichnen solche Darstellungen auch als „Essenz“, „Kernelement“, „Seele“, „Idee“ oder „Porträt“ eines Arzneimittels.
„Ähnlichkeit“ – das Grundprinzip der Homöopathie – ist ein wenig präziser Ausdruck, der erst durch bestimmte Kriterien definiert werden muss. Die Leitsymptome gehören zu diesen Kriterien der „Ähnlichkeit“ zwischen Arznei und Patient. Das sind solche Symptome eines Arzneimittels, die sich in der Arzneimittelprüfung und in der Therapie am Patienten als besonders herausragende Schwerpunkte gezeigt haben und gewissermaßen eine Schlüsselfunktion („Schlüsselsymptom“ oder „Keynote“) für die Wahl des passenden Mittels einnehmen. Sie gehören meist zu den
„sonderlichen, auffallenden, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptomen“,
die Hahnemann im § 153 seines Organon als wesentliches Kriterium der Ähnlichkeit „besonders und fast einzig fest ins Auge zu fassen“ betont:
„Vorzüglich diesen müssen sehr ähnliche in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen.“
Als zweiten wichtigen Punkt für die Arzneimittelwahl erklärt Hahnemann in § 213 seines Organon:
„Man wird nie homöopathisch heilen, wenn man nicht bei jedem Krankheitsfalle zugleich mit auf das Symptom der Geistes- und Gemütsverfassung sieht.“
Auch diese Symptome können die Funktion von Leitsymptomen haben. Die „Geistes- und Gemütsverfassung“ entspricht dem Verhalten beim Tier. In manchen Arzneimittelbildern gibt sich das so deutlich zu erkennen, dass (wie beim Menschen) regelrechte Persönlichkeitsporträts von Hunden, Katzen, Pferden und anderen Tieren erstellt werden können.
Bei all dem geht es nach Kent nicht um Spekulationen oder Hypothesen:
„Homöopathie ist angewandte Wissenschaft und keine Theorie. Man versündigt sich gegen die Wissenschaft, wenn man ohne exaktes Wissen und ohne Begründung für sein Tun praktiziert.“
3 Zum Aufbau des Buches
3.1 Ganzheitliches Verständnis und homoöpathische Anwendung
Die Ausführungen des vorliegenden Buches sind nicht wie eine Arzneimittellehre konzipiert, sondern auf ein ganzheitliches Verständnis der Arzneien und deren Anwendung in der Praxis orientiert.
Die einzelnen Angaben gründen sich prinzipiell auf den Arzneimittelprüfungen der Humanhomöopathie. Jahrzehntelange Erfahrung in der tierärztlichen Praxis ließen gewisse Schwerpunkte für spezielle Tier-Persönlichkeiten und deren Erkrankungen herauskristallisieren.
Der ▶ allgemeine Teil des Buches soll skizzenhaft die Grundlagen und Praxis der homöopathischen Medizin aufzeigen, um Missverständnissen in der Anwendung homöopathischer Mittel vorzubeugen. Diese Übersicht kann jedoch keineswegs das Studium der homöopathischen ▶ Grundlagenliteratur ersetzen. Ferner sind hier wesentliche Gedanken über Wesen und Pathophysiologie („Miasmen“) einiger Spezies dargestellt, die den homöopathisch-arzneilichen Zugang erleichtern sollen.
Im ▶ speziellen Teil werden die Strukturen von 39 wichtigen homöopathischen Mitteln dargestellt.
Die Tierhomöopathie hat ein weites und äußerst interessantes therapeutisches Feld zu bearbeiten: Schließlich geht es nicht nur um den Homo sapiens, sondern um eine Fülle an verschiedenen Spezies und Rassen, die alle über unterschiedliche Verhaltensmuster, Metabolismen und Krankheitsdispositionen verfügen, welche aber auch beim Menschen nicht unbekannt sind: Diese Individualität im Tier ebenso zu erkennen, ist der Weg der „Klassischen (Tier-)Homöopathie“, der Homöopathie Hahnemanns.
Aus didaktischen Gründen sind die Darstellungen der Arzneimittel in folgende Abschnitte gegliedert:
Signatur, Thema und Idee des Mittels
Grundsätzliche Eigenschaften des Mittels
Übersicht über Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
auffallende Zeichen und Symptome des Verhaltens
Schwerpunkte und Leitsymptome des pathologischen Geschehens
Auslöser und Modalitäten
ausgewählte Fallbeispiele
3.2 Signatur, Thema, Idee
Die Signatur eines homöopathischen Arzneimittelbilds ist aus der Zusammenschau mit dem Ausgangsstoff eines Arzneimittels (Pflanze, Tierstoff, Mineral, Nosode) und dem Arzneimittelbild zu einem Thema bzw. einer Idee verdichtet worden.
Die ursprüngliche Signaturenlehre beruht auf den archaischen Gesetzen des Hermes Trismegistos: „Wie oben, so unten, innen wie außen, der Mikrokosmos entspricht dem Makrokosmos.“
Paracelsus nannte das Erkennen einer Signatur „das Sehen im Lichte der Natur“.
Emil Schlegel und William Gutmann, beide bedeutende, weltweit bekannte homöopathische Ärzte der Vergangenheit, betrachteten die lebendige Gestalt der Pflanze, eines Tierstoffs oder eines Minerals mit ihren physiologischen und toxikologischen Eigenschaften als Ausdruck ihrer Wirkkräfte, die mit den Ergebnissen der Arzneimittelprüfung in einem naturgesetzlichen Zusammenhang stehen. Beide wollten damit einen Beitrag „zum Verstehen der Natur der Substanz“ leisten, welcher „dem Prozess der Kausalität übergeordnet“ ist. Die Betrachtungsweise beider Autoren lässt sich unter dem Begriff der Signatur zusammenfassen. Auch einige moderne Autoren weisen auf solche Zusammenhänge hin, die teilweise so verblüffend erscheinen, dass sie nicht mehr allein dem Zufall zugeschrieben werden können (Whitmont, Appell u.a.).
Damit soll keineswegs gesagt sein, dass allein durch hypothetisch konstruierte Analogien zwischen Art und Vorkommen bzw. Lebensweise einer Substanz oder Pflanze auf ihre pharmazeutische Wirkung oder auf ein Arzneimittelbild geschlossen werden könnte. Hier dient der Abschnitt „Idee und Signatur“ in erster Linie als Mittel der Didaktik, um die Arzneimittellehre verständlich und lernbar zu gestalten.
Wer sich „dem Sehen im Lichte der Natur“ und den zugehörigen naturphilosophischen Gedanken öffnen will, mag die Zusammenhänge zwischen Eigenschaften der Ausgangssubstanz und dem Arzneimittelbild als Geheimnis der Schöpfung ansehen (Schlegel, Religion der Arznei ▶ [45]). Wer dem nicht folgen möchte, möge die Darstellungen dieser komplexen Bilder lediglich als kuriosen, didaktischen Trick betrachten. Bekanntlich ist das gleichzeitige bildhafte und verstandesmäßige Erfassen von Lerninhalten hervorragend für Gedächtnisleistungen geeignet.
3.3 Eigenschaften des Mittels
Die grundsätzlichen Eigenschaften des Mittels beschreiben die Wirkungsweise, deren Intensität sowie allgemein gehaltene Eigenschaften des Arzneimittels.
Art und Schnelligkeit der Entwicklung der Pathologie bezeichnen die Dynamik des Krankheitsgeschehens. Daraus resultieren vereinzelte Hinweise auf eine möglicherweise angezeigte Wiederholung der Mittelgabe, abhängig vom Verlauf der Heilung.
Manche Arzneimittel zeigen einen besonderen Bezug zu bestimmten Spezies oder Tierrassen und deren Disposition zu bestimmten Erkrankungen. Auch auf Gemeinsamkeiten bzw. Möglichkeiten einer Verwechslung mit anderen Mitteln oder eine besondere Abfolge von Ergänzungsmitteln wird hingewiesen, ferner auf Verwechslungsmöglichkeiten mit ähnlichen Mitteln, Kontraindikationen und Missverständnisse.
3.4 Übersicht über das Arzneimittelbild
Die Übersicht über das Arzneimittelbild dient der schnellen Orientierung über Schwerpunkte, Leitsymptome und wesentliche Modalitäten ohne Angabe von Einzelheiten.
3.5 Physiognomie und Erscheinungsbild des Patienten
Das Aussehen des Patienten, der erste Eindruck, kann durchaus Hinweise für die Mittelwahl geben: Haar- und Augenfarbe, körperliche Entwicklung und Gestalt, Körperhaltung, Körpertemperatur, Temperament. Natürlich ist diese Physiognomie in Relation zu Art und Schwere der Erkrankung zu setzen. Nicht jeder Patient muss dem angegebenen Bild entsprechen. Es handelt sich in der Homöopathie um Möglichkeiten der Abweichung vom „Normalen“. ▶ Negativsymptome sind grundsätzlich unter Vorbehalt einzuschätzen.
3.6 Zeichen und Symptome des Verhaltens
Die beschriebenen Verhaltensweisen homöopathischer Tierpatienten wurden im Laufe von jahrzehntelanger Praxis beobachtet und immer wieder bestätigt.
In chronischen Fällen gelingt es oft mithilfe dieser Verhaltenssymptome, das passende Mittel zu finden. Manchmal kann auch im Akutfall eine Verhaltensänderung als Schlüsselsymptom für das passende Arzneimittel gewertet werden.
Aber nicht jeder Patient zeigt das beschriebene Arzneimittel-spezifische Verhalten. Manche Arzneien treten uns häufiger mit ihrem zugehörigen Verhalten gegenüber (z.B. Pulsatilla), manche weniger häufig. In den speziellen Fällen „einseitiger“ oder ▶ „lokaler Krankheiten“ fehlen solche Verhaltensweisen häufig gänzlich.
3.7 Schwerpunkte und Leitsymptome des pathologischen Geschehens
Dieses Kapitel beschreibt Leitsymptome und gibt Anhaltspunkte für Indikationen, die jedoch nicht im Sinn von „bewährten Indikationen“ der ▶ organotropen Homöopathie zu verstehen sind. Die Angaben resultieren aus den Arzneimittelbildern des Menschen, aus den Rubriken des Repertoriums sowie aus zahllosen praktischen Erfahrungen eigener homöopathischer Tierpraxis.
Jeder Patient stellt immer nur einen Ausschnitt aus dem gesamten Arzneimittelbild dar, welcher meist begleitet ist von Modalitäten, die sich durch das gesamte Arzneimittelbild ziehen.
3.8 Auslöser und Modalitäten
In diesem Abschnitt sind wesentliche Ursachen und Auslöser der Pathologie sowie die hauptsächlichen Modalitäten katalogisiert.
3.9 Ausgewählte Fallbeispiele
Es handelt sich hier ausschließlich um Patienten, die einzig durch Homöopathie – ohne anderweitige Therapie – zur Heilung bzw. Besserung geführt wurden.
Die Darstellungen und Kasuistiken entspringen den Erfahrungen und Beobachtungen an unzählbaren Patienten aus mehr als 25 Jahren Praxis. Leider sind im Laufe der Zeit durch mehrfache Ortswechsel viele Fall-Belege verloren gegangen. Häufig kommen in der kurativen Praxis die Erfolgsmeldungen der zurückliegenden Therapie erst Monate oder Jahre später, der Patient wird an neue Besitzer weitergegeben oder fällt einem Verkehrsunfall zum Opfer, sodass über eine langfristige Beobachtung nichts mehr ausgesagt werden kann. Dennoch reihen sich die Erfahrungen und Beobachtungen so aneinander, dass sich die praktischen Erfahrungen im Folgenden zusammenfassen lassen.
In diesem Kapitel findet ein großer Teil der Leitsymptome seine Bestätigung in der Praxis. Die behandelten Erkrankungen kamen oft aus vergeblicher schulmedizinischer Vorbehandlung, waren zum Teil bereits austherapiert oder zeigten eine infauste Prognose. Die Fälle stammen größtenteils aus der eigenen Praxis, zum Teil von Dr. Hartmut Krüger und einige noch aus unserer gemeinsamen Praxis.
Die Kasuistik soll den Weg von der Anamnese zur Mittelwahl, die praktische Anwendung dieser Leitsymptome demonstrieren. Es gelangen unterschiedliche Wege der Arzneimittelwahl zur Anwendung: In manchen Fällen gibt das Verhalten den Ausschlag, dann deutliche Modalitäten oder die Gesamtheit der Symptome.
Teilweise handelt es sich um banale lokale Beschwerden, um Verhaltensstörungen oder um schwerwiegende Erkrankungen mit zweifelhafter Prognose. Akute, subakute, chronische und konstitutionelle Verordnungen zeigen die Übertragung der Symptome des Patienten in die Ausdrucksweise des Repertoriums. Die verschiedenen Fälle von ein und demselben Mittel verweisen auf die unterschiedlichen Aspekte, die uns mit diesem Mittel begegnen können.
Aus der Vielzahl bestimmter Beobachtungen ließ sich ein „Genius morbi“ (konstanter Krankheitsverlauf) konstruieren, der nun für den Praxisgebrauch zur Verfügung steht. Als Beispiele seien erwähnt:
Lycopodium für Harnwegsprobleme bzw. -steine von Katern
Phosphor für das lineare eosinophile Granulom sowie für das Lippengranulom der Katze
Phosphor für die Vergiftungen mit Petroleum („Ölpest“)
Arsen, Phosphor, Nux vomica, Pulsatilla oder Lycopodium als häufigste Indikation für Katzen mit Nierendegeneration
Apis, Bryonia, Nux vomica, Pulsatilla oder Pyrogenium als häufigste Indikation für die akute Hufrehe der Pferde
Conium als häufigstes Mittel (neben anderen!) für den Mammatumor der Hündin
Arsen für die Hauterkrankungen von Ratten usw.
Thuja als häufigstes Mittel für chronisch kranke Esel
Diese Angaben sind jedoch weder vollständig noch verbindlich.
Gerade für den Tierpatienten gilt es noch vieles zu entdecken. Solche Forschungen und Erfahrungen sind in Zusammenarbeit mit Kollegen für die Weiterentwicklung der Homöopathie dringend erforderlich!
Die angeführten Beispiele mit zum Teil überraschend schnell verlaufender Genesung von schwersten Krankheiten mögen dem Leser Mut machen, selbst nach der Lehre Hahnemanns zu therapieren und in seinem Sinn zu handeln:
„Macht’ s nach, aber macht’s genau nach!“
Teil II Allgemeiner Teil
4 Grundlagen der Homöopathie
5 Praxis der Tierhomöopathie
4 Grundlagen der Homöopathie
4.1 Entwicklung der Homöopathie – Samuel Hahnemann
Dieser allgemeine Teil soll dem Verständnis der homöopathischen Medizin dienen. Er wendet sich insbesondere an solche Leser, die der Homöopathie mit Skepsis gegenüberstehen. Der bereits praktisch tätige Homöopath möge einige Anhaltspunkte finden, dem Tierbesitzer fragliche Fakten zu erklären. Zusätzlich werden grundlegende Anstöße zum Verständnis und zur Anwendung der Homöopathie am Tier gegeben.
Zahllose neue Theorien und Richtungen prägen heute die homöopathische Medizin. Sie sind nicht nur bedingt durch die konträren Paradigmen zwischen Schulmedizin und Homöopathie, sondern auch durch unterschiedliches oder mangelndes Verständnis der Homöopathen selbst. Unterschiedliche Richtungen der Homöopathie spielen besonders in der Tierhomöopathie eine beträchtliche Rolle (s.u.).
Für die Heilung eines Patienten kommt es in erster Linie darauf an, seine Gesundheit nach Hahnemanns Forderung „schnell, angenehm, sicher und dauerhaft“ wiederherzustellen.
Die Homöopathische Medizin wurde begründet von dem Arzt und Apotheker Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, geboren 1755 in Meißen, gestorben 1843 in Paris. Hahnemann lehnte die nicht reproduzierbaren Spekulationen und Mutmaßungen seiner Zeit über die Wirkung von Arzneien ab. Er verwarf strikt die damals neue Idee von Tierversuchen als Prüfmethode für menschentaugliche Heilmittel. Zeit seines Lebens widmete er sich der Entwicklung der homöopathischen Medizin, deren therapeutische Möglichkeiten von seinen Nachfolgern bis heute noch nicht im Entferntesten ausgeschöpft sind.
Diese Instruktionen bestätigen und bewähren sich tagtäglich in der homöopathischen Therapie von Patienten aller Art. Noch heute ist dieses Organon ▶ [24] weltweit das grundlegende Arbeitsbuch für die seriöse Homöopathie.
Das Organon wurde von James Tyler Kent (1849–1916) mit Kommentaren versehen und als „Kent’s Philosophy about Organon“ herausgegeben, in der deutschen Übersetzung „Vorlesungen Kent’s zum Organon“ oder „Prinzipien der Homöopathie“▶ [30]. Dieses Werk ist heute noch die unverzichtbare Grundlektüre für Verständnis und Anwendung der Homöopathie Hahnemanns, auch für die Veterinärmedizin.
Die homöopathische Medizin breitete sich im 19. Jahrhundert schnell weltweit aus. Eine große Blütezeit erlebte sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA, insbesondere durch den Einfluss von Constantin Hering und durch James Tyler Kent.
Der Siegeszug der Pharmako- und Chemotherapie brachte zunächst in Europa und Amerika einen Stillstand und den Rückgang für die Homöopathie. Erst seit etwa der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als der Schweizer Homöopath Dr. Pierre Schmidt und sein Schüler Dr. Jost Künzli die Werke von J.T. Kent auch den europäischen Ärzten zugänglich machten, begann in Europa wieder ein langsam fortschreitender Aufschwung für die Homöopathie.
Ein weltweit wirksamer Impuls geht seit ungefähr 35 Jahren von dem griechischen Homöopathen Georgos Vithoulkas aus. Nach Vithoulkas ist die Homöopathie die „Medizin der Zukunft“.
4.1.1 Entwicklung und Stand der Tierhomöopathie
Von Hahnemanns Zeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es einige homöopathische Tierärzte, die beeindruckende Falldokumentationen hinterließen, diese aber leider nicht immer in nachvollziehbarer Form darstellten.
Boenninghausen, einer der besten Schüler zu Lebzeiten Hahnemanns, veröffentlichte eine ganze Liste erfolgreich behandelter Tierpatienten. Diese waren auch seine ersten Patienten, an denen er 1866 die 200. Centesimal-Potenz erprobte.
Durch die Erfolge der Pharmakotherapie geriet auch die Veterinärhomöopathie ab etwa 1900 ins Hintertreffen. Ab etwa 1950 war es das große Verdienst von Dr. Hans Wolter, dass er die Homöopathie für die Veterinärmedizin wieder zugänglich gemacht hat. Er arbeitete überwiegend gemäß der damals aktuellen „naturwissenschaftlich-kritischen Richtung“ nach organotropen Kriterien, womit man zwar manche akuten Erkrankungen erfolgreich angehen, aber chronisches Leiden meist nicht durchgreifend heilen kann. (Organotrope Homöopathie berücksichtigt in erster Linie das lokale Krankheitsgeschehen an einem Organ und lässt die Individualität des Patienten weitgehend außer Acht. Damit versuchte die naturwissenschaftlich-kritische Richtung der Homöopathie einen Kompromiss mit der Schulmedizin einzugehen.)
Leider fristet die Tierhomöopathie heute noch immer ein vernachlässigtes Dasein am Rande der etablierten akademischen Medizin und wird vielfach als Placebo belächelt, obwohl die Tierbesitzer vermehrt nach homöopathischer Behandlung verlangen. Das Potenzial der homöopathischen Medizin wird besonders in der Veterinärmedizin noch immer gewaltig unterschätzt, was durch mangelhafte Therapieerfolge bestätigt wird. Die Ursache hierfür liegt größtenteils in ungenügender Kenntnis der homöopathischen Arzneimittel und des homöopathischen Prozedere.
Das Erlernen der Homöopathie erfordert ebenso viel Mühe wie ein gesamtes Medizin-Studium.
Aber gerade dem akademischen Mediziner fällt es schwer, das analoge, phänomenologische, kybernetisch orientierte Vorgehen der Homöopathie in das gewohnte kausal-analytische Denken der heutigen Hochschulwissenschaft zu integrieren. Anerkennung und Verbreitung der homöopathischen Medizin leiden eminent unter dem insbesondere in der Medizin noch immer gültigen materialistischen Paradigma der letzten 250 Jahre.
4.2 Das Ähnlichkeitsgesetz
Dem kategorischen Imperativ von Hahnemann „Similia similibus curentur“ liegt das Gesetz der Entsprechung zugrunde.
Hippokrates und später Paracelsus sahen in der äußeren Natur die Entsprechung zum Menschen:
„Der Mensch als Mikrokosmos ist ein Teil der großen Natur.“
„Die Natur des menschlichen Körpers ist ähnlich der großen Natur.“ „Durch das ähnliche Prinzip (der Natur) entsteht die Krankheit, und durch Anwendung des Ähnlichen wird die Krankheit geheilt.“
Diese überlieferten Thesen finden ihre Bestätigung im modernen Denken in kybernetischen Zusammenhängen: Die Veränderung eines Bausteins in einem Netzgefüge zieht automatisch eine Änderung anderer Teile nach sich; und wenn diese in den ursprünglichen Zustand reponiert werden, gelangt auch der erste Baustein wieder in seine Ausgangsposition.
So kann jede Gesundheitsstörung als „ein Schrei nach dem Heilmittel“ angesehen werden, der das analoge Prinzip oder Muster aus dem Naturreich verlangt, welches der Krankheit entspricht, um die gestörte Balance der gesunden Lebenskraft im Patienten wieder herzustellen (C. Hering).
Hahnemanns Verdienst ist es, das Ähnlichkeitsgesetz zu einem medizinischen System ausgebaut zu haben, das sowohl Diagnose (Arzneimitteldiagnose) als auch Therapie (durch dieses Arzneimittel) beinhaltet. Er fordert eine Heilung, die nicht nur „schnell, angenehm, dauerhaft und sicher“, sondern auch „nach deutlich einzusehenden Gründen“ erfolgen soll. Damit appelliert er schon zu seiner Zeit an eine wissenschaftlich fundierte, reproduzierbare Arzneiwirkung:
„Jede wahre Arznei wirkt zu jeder Zeit, unter allen Umständen auf jeden lebenden Menschen und erregt in ihm die eigentümlichen Symptome, sodass jeder menschliche Organismus jederzeit von der Arzneikrankheit behaftet wird.“ (Organon § 32)
Allerdings richten sich seine Kriterien der Reproduzierbarkeit nach anderen Gesichtspunkten, als sie in der heutigen akademischen Naturwissenschaft üblich sind.
Das Ähnlichkeitsgesetz „Similia similibus curentur“ bildet die Grundlage, die ▶ drei Säulen der homöopathischen Medizin, ▶ Abb. 1.1:
„Similia“ entspricht dem Patienten (§§72–104 des Organon)
„Similibus“ der homöopathischen Arznei (§§105–145 des Organon)
„Curentur“ dem Prozedere der Heilung (§§146–291 des Organon)
Dieses Ähnlichste agiert nach einer Art Resonanzprinzip („Idiosynkrasie“), damit ist eine individuelle „persönliche Ansprechbarkeit“ gemeint (Berndt); in der Ausdrucksweise des englischen Biologen Rupert Sheldrake lässt sich die Beziehung zwischen Similimum und Patient auch als „morphische Resonanz“ bezeichnen.
4.3 Arzneimittelprüfung – Arzneimittelbild – Materia medica homöopathica
Die Anwendung des Ähnlichkeitsgesetzes fordert eine genaue Kenntnis der für den Patienten infrage kommenden Arznei, die in der homöopathischen Arzneimittelprüfung dokumentiert worden ist. Im § 22 des Organon heißt es: „Arzneien werden nur dadurch zu Heilmitteln, weil sie künstliche Krankheitssymptome erzeugen können.“
Um die pathogene Wirkung einer Arznei zu prüfen, nimmt ein gesunder Mensch in festgesetzten Intervallen eine gewisse Menge eines Arzneistoffes ein und bemerkt nach einiger Zeit spezifische Beschwerden. Diese werden in allen Äußerungen und Empfindungen gewissenhaft protokolliert. Die Symptome einer Arzneimittelprüfung treten sowohl bei toxischer Dosierung als auch bei Einnahme gehäufter Dosen potenzierter Arzneien ein, sogar wenn die Potenzstufe jenseits der Lohschmidt’schen Zahl (oberhalb D28 oder C12) liegt, in der kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr enthalten ist. Hahnemann empfahl für die Arzneimittelprüfung die Einnahme der 30. Centesimal-Potenz einmal pro Tag. In der Regel treten Prüfungssymptome nach 6 Tagen auf oder früher.
Nach Aussetzen der Arzneimittelprüfung lassen diese wieder nach und klingen aus. Natürlich werden homöopathische Arzneien nicht bis zum Auftreten schwerer organischer Schäden geprüft. Solche Symptome im Arzneimittelbild leiten sich aus toxikologischen Beobachtungen her oder sind bei der Heilung von Kranken beobachtet und dokumentiert worden. Die Ergebnisse einer Arzneimittelprüfung an verschiedenen Probanden sowie toxikologische Beobachtungen werden zusammengetragen als Arzneimittelbild, dessen Symptome durch erfolgreichen therapeutischen Einsatz am Patienten in vielen Fällen zusätzlich bestätigt wurden.
Die Zeichen und Symptome eines Arzneimittelbildes enthalten gewisse Schwerpunkte, die sowohl das pathologische Geschehen als auch die Gemütsverfassung sowie deren besonders spezifische Leitsymptome („Keynotes“) des Arzneimittelbildes in den Vordergrund stellen. Deren Kenntnis erleichtert ungemein die Auswahl der passenden Arznei für den Patienten. Inzwischen sind mehr als 500 Arzneistoffe gründlich am Menschen geprüft worden; es gibt zahlreiche weitere homöopathisch zubereitete Arzneien, von denen nur erst eine Teilwirkung erfasst wurde.
Die Gesamtheit der homöopathisch geprüften Arzneien bezeichnet man als Materia medica homöopathica, die in den Arzneimittellehren dargestellt ist. Aus diesen Arzneimittelbildern lassen sich zahlreiche Aspekte in überzeugender Art auch beim Tier eruieren. Leider sind die veterinärhomöopathischen Erfahrungen und Literaturangaben noch viel zu lückenhaft, als dass man sie ohne Probleme in der täglichen Routinepraxis anwenden könnte. Diese Lücken ein wenig aufzufüllen, ist Aufgabe dieses Buches.
Um die zahlreichen Symptome der Arzneimittelprüfungen für den Patienten wieder zu finden, wurden diese nach Körperregionen katalogisiert und sind im Repertorium (lat. reperire: wiederfinden) nachzuschlagen. Hier sind fast alle erdenklichen Zeichen und Symptome des Menschen mit den Angaben der jeweils dafür infrage kommenden Arzneimittel aufgezeichnet. Dieses Werk umfasst heute, je nach Herausgeber, 1200–3800 Seiten.
Das Repertorium ist das unentbehrliche Handwerkszeug des Homöopathen, ohne das in vielen Fällen keine präzise Arzneimittelwahl erfolgen kann. Die Anwendung dieses Nachschlagewerks ist – insbesondere für das Tier – nicht einfach und wird am besten in Repertorisationskursen unter entsprechender Anleitung erlernt. Heute bietet sich die Repertorisation mit dem Computer an; aber auch dies bedarf präziser Kenntnisse des Repertoriums und eine gewisse Einarbeitung, um ein Mittel richtig auswählen zu können.
4.4 Lebenskraft
Als verantwortliches Prinzip für Gesundheit, Krankheit und Heilung erkannte Hahnemann die „Lebenskraft“ oder „Dynamis“; dieser Begriff ist seit der Existenz jeglicher Art von Medizin bekannt – mit Ausnahme der heutigen Hochschulmedizin. In der traditionellen Chinesischen Medizin wird sie z.B. als „Chi“ bezeichnet. Die Lebenskraft ist das belebende Prinzip, das einen Leichnam vom lebendigen Organismus unterscheidet. Eine gesunde Lebenskraft bringt uns Elan, Lebensfreude und eine belastbare, selbst regulierende Immunabwehr und die Kraft zur Restitutio bzw. Heilung von Krankheiten.
Eine aus dem Gleichgewicht geratene oder verstimmte Lebenskraft verschafft uns schlechte Laune, reizbare oder depressive Stimmung, Erschöpfungszustände oder sorgt dafür, dass wir an Infekten, akuten oder chronischen Gesundheitsstörungen leiden. In Hahnemanns Organon heißt es:
„Im gesunden Zustand des Menschen waltet die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper belebende Lebenskraft unumschränkt und hält alle seine Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Tätigkeiten.“ „Krankheiten sind dynamische Verstimmungen unseres geistartigen Lebens in Gefühlen und Tätigkeiten“, das sind „immaterielle Verstimmungen unseres Lebens“.
Die Verstimmung der Lebenskraft kann sich in unzähligen Symptomen und Erkrankungen äußern.
„Es gibt keine noch so kleine Zelle oder ein Gewebe, das nicht Lebenskraft enthielte.“
(Kent)
Homöopathische Arzneien wirken nicht auf Krankheitserreger oder gegen Krankheiten, nicht durch einen pharmakologisch definierten Effekt oder über einen Blutspiegel, sondern einzig durch Aktivierung der Lebenskraft, indem sie subjektives Wohlbefinden und eine belastbare Eigenregulation herstellen. In einem solchen gesunden Organismus haben Krankheitserreger keine Chance, pathogen zu wirken, ihnen wird durch eine gesunde Immunreaktion der Boden entzogen.
Der § 1 des Organon bezeichnet einen wesentlichen Aspekt der Homöopathie:
„Des Arztes höchster und einziger Beruf ist es, kranke Menschen (das kranke Lebewesen – Anm. d. Verf.) gesund zu machen, was man Heilen nennt.“
Auch hier ist nicht die Rede von Krankheiten, von Erregern oder pathologischen Veränderungen, sondern von der Gesundwerdung des Menschen, zu verstehen wie die Definition von Gesundheit gemäß WHO (World Health Organisation):
„Gesundheit ist körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden, nicht allein die Abwesenheit von Krankheiten.“
Wohlbefinden ist ein subjektives, nicht quantitativ messbares Erleben, das wir beim Menschen ebenso wie beim Tier beobachten können.
4.5 Funktionsweise der Homöopathie
4.5.1 Potenzierung
Hahnemann entwickelte ein geniales Zubereitungsverfahren seiner Heilmittel: Er postulierte, die Arznei müsse der Dynamis, der Lebenskraft, angepasst, also dynamisiert oder potenziert sein.
„Wir potenzieren deshalb, um das Mittel so fein zu machen, dass es in die Lebenskraft einfließen kann. Wir müssen immer daran denken, dass die Lebenskraft eine geistige Substanz ist und dass das, was heilt, ebenfalls geistige Substanz sein muss.“
(Kent)
Potenzieren bedeutet ursprünglich „Kraft-Freisetzen“. In diesem Sinn ist der Vorgang des Potenzierens zu verstehen: Je intensiver potenziert worden ist, desto stärker ist die Wirkung.
Unter Potenzieren versteht man das stufenweise Verdünnen mit jeweiligen dazwischen geschalteten starken Schüttelschlägen. Feste Stoffe oder Pflanzenteile werden jeweils 1 Stunde im Verhältnis 1:100 mit Milchzucker verrieben und anschließend, ab C 3, als Dilution (flüssige Zubereitung) weiterverarbeitet. Je nach Verdünnungsgrad spricht man von Dezimal-Potenzen (Verdünnungsschritt 1:10), von Centesimal-Potenzen (Verdünnungsschritt 1:100) oder von LM- oder Q-Potenzen (1:50000).
Dezimal-Potenzen haben sich besonders im deutschsprachigen Raum durchgesetzt, die Centesimal-Potenzen Hahnemanns sind weltweit verbreitet und wirken intensiver als Dezimal-Potenzen. Für Q-Potenzen gelten besondere Dosierungsvorschriften.
Der Vorgang des Potenzierens oder Dynamisierens trifft noch heute auf das Unverständnis der akademischen Wissenschaft, insbesondere wenn die Arznei so weit verdünnt ist, dass kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr vorhanden sein kann (Lohschmidt’sche Zahl ab D 28 oder C 12). Kent sagt dazu:
„Alle Materie kann in ihren ursprünglichen strahlenden Zustand zurückgeführt werden.“
Diese energetische oder feinstoffliche Wirkung ist verständlicherweise nicht materiell-quantitativ nachweisbar. Dieses Phänomen ist bisher durch naturwissenschaftliche Forschung noch nicht erklärbar, weil hier offensichtlich physikalische Gegebenheiten zugrunde liegen, die nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Physik noch nicht nachvollziehbar sind. Man vermutet, dass sich durch den Potenzierungsvorgang in der Trägersubstanz (Wasser-Alkohol oder Zucker) gewisse strukturelle Veränderungen abspielen, welche eine Information speichern.
Derartige Phänomene sind nicht neu, sondern werden schon lange z. B. für die Kristallanalyse biologischer Substanzen verwandt. Auch die von Masaru Emoto festgestellten Kristallisationsphänomene von Wasser (Schneeflocken) unter bestimmten elektromagnetischen oder energetischen, nicht immer objektiv messbaren Einflüssen deuten dieses Geschehen an.
Sogar Kent erwähnt bereits formbildende Einflüsse, „wenn wir die Eisblumen am Fenster ansehen“.
Auch spektrografische Verfahren können Besonderheiten immateriell potenzierter Arzneistoffe sichtbar machen, nicht jedoch identifizieren.
4.5.2 Einfluss potenzierter Arzneien auf die Lebenskraft
Der § 26 des Organon besagt, dass die schwächere dynamische Affektion (die Krankheit des Patienten) durch die stärkere (die dynamisierte Arznei) gelöscht werde. Hahnemann nennt das Leiden des Patienten die „natürliche Krankheit“, die Wirkung der potenzierten Arznei die „Kunstkrankheit“.
Das heißt, die Kunstkrankheit (durch die Arznei) muss in geringem Maße stärker sein als die natürliche Krankheit (des Patienten). Daraus folgen wesentliche Überlegungen zur Auswahl der Potenz im ▶ Krankheitsfall. Kent sagt dazu, Arzneien können nicht heilen, wenn sie nicht potenziert werden bis zu der Ebene, auf der der Mensch (Organismus) krank ist.
„Unpotenzierte Arzneien wirken nur im niedrigsten Bereich ... auf der äußersten Ebene.“
4.5.3 Mögliches Wirkungsprinzip der potenzierten Arznei
4.5.3.1 Das „morphogenetische Feld“ nach Rupert Sheldrake
Eine sehr plausible Erklärung für die Wirkung homöopathisch potenzierter Arzneien bietet die Theorie über die „morphogenetischen Felder“ (Morphogenese, griech. Gestalt-erzeugend), die insbesondere von dem englischen Biologen Rupert Sheldrake formuliert wurde.
Edward Whitmont, Kenner der Homöopathie und ehemaliger Chairman am C. G. Jung Institut New York, sprach bereits 1987 von „Bewusstseinsformen, die im Raum existieren analog den Feldern der Physik“. Damit ist ein informatives (in Form bringendes) Energiefeld gemeint, das einer Materie die Gestalt gibt. Die These „Energie formt die Materie“ ist ebenfalls nicht neu. Sogar Kent sagt, die Lebenskraft sei mit formgebender Intelligenz ausgestattet.
Wer sich nun intensiver mit Sheldrakes Forschungen und Homöopathie beschäftigt, dem drängen sich Zusammenhänge zwischen der materiefreien Arznei und den Energiefeldern bzw. morphogenetischen Feldern auf.
Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie liegt es nahe, dass ein Energiefeld übrig bleibt, wenn der Ausgangsstoff soweit „herausgeschüttelt“ worden ist, dass er nicht mehr materiell vorhanden ist. Das heißt, Homöopathie ist (sehr wahrscheinlich) eine Therapie mit morphogenetischen Feldern.
Diese (vermutlich) durch energetische Felder imprägnierte homöopathische Arznei kann bei fortgesetztem Kontakt zur Veränderung des körpereigenen Energiefelds und damit zu Symptomen einer Arzneimittelprüfung führen. Der Proband nimmt gleichsam das morphogenetische Feld der Ausgangssubstanz (z. B. einer Giftpflanze) in sich auf und bringt damit deren Eigenschaften im wahrsten Sinn „zum Ausdruck“: Er empfindet sie in psychischer und physischer Weise und kann sie durch seine Sprache verständlich machen.
Hier sei nochmals auf die analogen Zusammenhänge zwischen Erscheinungsbild und Lebensweise der Pflanze (auch anderer Ausgangssubstanzen) und dem zugehörigen Arzneimittelbild hingewiesen, die im Sinn einer ▶ Signatur gedeutet werden und einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von Arzneimittelbild und Patient leisten können.
Wer also z. B. eine Arzneimittelprüfung mit Pulsatilla C 30 (oder anderer Zubereitung) durchführt, verhält sich in vielfacher Hinsicht so wie diese Pflanze, wenn sie sich in sprachlicher Ausdrucksweise für uns wahrnehmbar äußern könnte. Er sucht emotionale Zuwendung, er möchte gern dem anderen Geschlecht gefallen, er leidet unter Sonnenhitze und bekommt davon Kopfschmerzen, leidet unter Verdauungsstörungen durch zu viel oder durcheinander Essen, unter schweren Beinen durch Stase des Kreislaufs usw. ▶ Charakteristika von Pulsatilla. Wird aber dieses morphogenetische Feld einem Patienten mit eben diesen Beschwerden – also nach dem Ähnlichkeitsprinzip – einverleibt, dann wird sein Energiefeld, seine verstimmte Lebenskraft wieder ins Lot gebracht und er wird gesund ( ▶ Abb. 5.2).
Rupert Sheldrake bezeichnet dieses Phänomen als „morphische Resonanz“. Diese Gedanken treffen sich auch mit den oben erwähnten Aussprüchen von Paracelsus ( ▶ Abb. 1.1).
Die Theorie der morphogenetischen Felder kann ferner erklären, warum wir bei Tieren viele Verhaltenszeichen und psychosomatischen Reaktionen beobachten, die eigentlich dem menschlichen Verstand zugeschrieben werden müssten. Die Deutung dieser Symptome im Sinn der Homöopathie, ihre Übertragung in die Ausdrucksweise der Arzneimittelbilder bzw. des Repertoriums und erfolgreiche Anwendung der so herausgefundenen Arzneien bestätigen diese Hypothese.
Diese Erklärungsmodelle können durch reproduzierbare Beobachtungen gestützt werden.
Homöopathisch potenzierte Arzneien wirken z. B. nicht nur durch Resorption über die Schleimhaut oder durch Injektion, sondern auch durch Hautkontakt. Das heißt, Arzneimittelwirkungen können auch erzielt werden, wenn der Proband das potenzierte Arzneimittel lange genug (bei Potenzen in C30 oder 200 einige Stunden lang) auf der Haut, z. B. in der Hosentasche, trägt.
Wenn ein Patient unmittelbar nach einer schweren Verletzung mit intensiven Prellungen (z. B. Sturz, Hirnerschütterung, Verkehrsunfall – ohne Knochenfraktur) sofort die diesem Trauma entsprechende Arznei in einer Potenz erhält, die der Läsion der Lebenskraft entspricht, also eine sehr hoch potenzierte (XM oder CM) ▶ Arnica , kommt es erstaunlicherweise nicht oder nur in geringem Ausmaß zu den erwarteten Schmerzen, Hämatomen und deren Folgeerscheinungen. Es ist mit medizinischem Wissen absolut nicht erklärbar, wie erwartete Konsequenzen einer Verletzung durch rechtzeitige Gabe der passenden Arznei in angemessener Potenz verhindert werden können.
4.5.4 Potenzierung – Speicherung einer Information
Die Lebenskraft ist ein absoluter Wert, sie belebt als geistartige Dynamis den materiellen Körper. Die Information für die Lebenskraft ist (oberhalb der 30. Centesimal-Potenz) rein qualitativer Art, weitgehend unabhängig von der Menge (Quantität: Anzahl der Globuli oder Tropfen) der verabreichten Arznei und ebenso unabhängig von Körpergröße und Körpergewicht.
Dagegen wirken tiefe Potenzen (z. B. D 6, C 6, D8, C8, D12) noch eher durch ihren materiellen Anteil und können nach Körpergröße dosiert werden. Für die Tierhomöopathie heißt das, oberhalb der C 30 spielt die Menge der applizierten Arznei eine untergeordnete Rolle: 1 Globulus wirkt auf die Lebenskraft einer Maus genauso wie auf die eines Elefanten.
4.6 Qualitative Kriterien der Homöopathie – Entstehung von Krankheiten
Die Theorie von den morphogenetischen Feldern trifft sich auch mit der von Hahnemann und Kent beschriebenen Entstehung chronischer Krankheiten.
Hahnemann nennt die Wichtigkeit der Geistes- und Gemütssymptome. Kent betont, dass den körperlichen Erkrankungen Störungen des inneren Menschen vorangehen, die gemäß seinem „Wollen und Denken“ die grobstofflichen Krankheitserscheinungen nach sich ziehen. Das entspricht auch der alt überlieferten These „Der Geist formt die Materie“ – mit anderen Worten: Das morphogenetische Feld – gesteuert von Bewusstsein und Verhalten – somatisiert die körperlichen Leiden.
In diesem Sinn kann die Homöopathie als eine psychosomatische Medizin verstanden werden, das trifft auch für die Veterinärmedizin zu und bestätigt die Einflüsse des Besitzers auf sein Haustier.
4.6.1 Hierarchisches Ordnungsprinzip in der Homöopathie
Bekannterweise waltet in biologischen Systemen eine hierarchische Ordnungsstruktur. So sind Arten, Gattungen, Bewusstseins- und Entwicklungsstufen, Sozialstrukturen, Organsysteme und körperliche Funktionen etc. nach ihrem Rang geordnet. Die Hierarchisation der homöopathischen Symptome des Patienten ist ein wesentlicher Faktor für die Arzneimittelwahl (s.u.).
Die Tierhomöopathie orientiert sich – wie erwähnt – an den Arzneimittelprüfungen des Menschen. Der Homo sapiens steht in der Hierarchie der Lebewesen an oberster Stelle. Er ist „die Krone der Schöpfung“: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Bilde schuf er ihn.“
Kent beschreibt das in seinen Worten:
„Der Mensch nimmt eine unvergleichliche Stellung neben dem Tier- und Pflanzenreich ein. In ihm vereinigen sich Himmel und Erde.“
Daher ist es durchaus sinnvoll, den tierischen Organismus am Menschen zu messen und die Abweichungen, Phänomenologie und Verhalten von Spezies und Rassen für die Homöopathie als Zeichen bzw. Symptom zu nutzen. Auf diese Weise gelangen wir zu einer gewissen Anzahl von homöopathischen Arzneien, die bevorzugt – aber nicht ausschließlich – für Erkrankungen dieser Tierspezies oder -rasse infrage kommen. Damit ist es möglich, spezifische homöopathische Mittel (bzw. deren Teilaspekte) für bestimmte ▶ Tierspezies oder -rassen im Voraus einzukreisen.
Auf der körperlichen Ebene stehen die lebenserhaltenden Leistungen und Organe (Bewusstsein, Sinnesorgane, Herz-Kreislauf, Atmung) rangmäßig höher als z. B. die Funktion der Gliedmaßen. Geistes- und Gemütsverfassung bestimmen das Wollen und Denken des Menschen und sind den materiellen, körperlichen Symptomen übergeordnet. Geist ist das, was uns zum Menschen macht, was uns das Ich-Bewusstsein, unsere Schöpferkraft und die freie Entscheidung über unsere Lebensgestaltung verleiht.
Beim Tier spricht man stattdessen von Verhaltenssymptomen.
Das „Wollen und Denken“ der Tiere bezieht sich zunächst auf die Funktionen von Lebens- und Arterhaltung sowie auf die Äußerung von Lebensfreude (z. B. Spieltrieb, Bewegungsdrang). Zu ergänzen ist, dass – auch entsprechend einer hierarchischen Lebensordnung, die eine Tierspezies geprägt hat – das „Wollen und Denken“ des Menschen durch willkürliche Zuchtauswahl zahlreiche Aspekte von rasseeigentümlichen Merkmalen geprägt hat. Somit ist er verantwortlich für nutzbringende Spezialisierungen oder vermeintliche Schönheitsideale wie auch für die damit verbundenen Krankheitsdispositionen.
4.6.2 Modalitäten
Homöopathische Arzneien werden nicht nach klinischen Diagnosen verordnet, nicht beispielsweise gegen eine Streptokokken-Erkrankung, nicht gegen eine Diskushernie, nicht nach quantitativmessbaren Maßstäben. Das Kriterium ist vielmehr qualitativer Art und bezeichnet die Art und Weise (Modalität), wie sich die Erkrankung äußert und wie der Patient darunter leidet.
Die Zeichen des Patienten, die Symptome und Modalitäten seiner Erkrankung sind der Ausdruck einer inneren Erkrankung und weisen den Weg zum passenden Mittel; sie sind nicht das Objekt, das therapiert wird!
In der homöopathischen Anamnese müssen diese besonders untersucht werden. Sie beziehen sich auf das
Wer: Wer hat diese Erkrankung? Wie ist seine Gemütsverfassung? Seine äußeren Merkmale, seine Vorgeschichte?
Was: Was für eine Erkrankung, Schweregrad, Verlauf, Ausbreitung?
Wo: Wo hat sich die Erkrankung lokalisiert?
Wie: Wie äußert sie sich? Wie wird die Erkrankung subjektiv empfunden und geäußert? Was bessert, was verschlechtert den Zustand?
Wann: Tageszeit, Jahreszeit, Wetter, unter welchen sonstigen Umständen?
Seit wann?
Warum: Was war los? Gab es einen, mehrere Auslöser, Zusammenhänge mit Ereignissen?
Was begleitet: Gibt es Zeichen, Symptome oder Beschwerden, die mit der Erkrankung scheinbar nichts zu tun haben?
Hat sich die Gemütsverfassung seitdem verändert?
Was gibt es noch?
Die homöopathische Arznei muss also dem Patienten individuell angepasst sein. Eine schematische Verordnung nach oberflächlichen Gesichtspunkten bringt nur selten eine Heilung, bestenfalls einen vorübergehend bessernden Effekt, der nach Absetzen der Arznei nicht anhält (Palliation).
Patienten zeigen i.d.R. nur einen Ausschnitt, eine Facette aus dem Arzneimittelbild. Dasselbe Arzneimittel kann z. B. für ganz unterschiedliche Erkrankungen eingesetzt werden, wenn diese durch gemeinsame Modalitäten gekennzeichnet sind:
Nux vomica kann beispielsweise für eine akute Infektion der Atemwege, für eine Gastroenteritis, für einen akuten Lumbago u.a. verordnet werden, wenn alle diese Erkrankungen durch folgende Modalitäten gekennzeichnet sind:
ausgelöst durch Kaltwerden, durch psychischen Stress, Arbeitsdruck, Stimulanzien (z. B. Kaffee, Nikotin) oder Pharmakotherapie (z. B. Analgetika, Antibiotika)
begleitet von gereizter Stimmung
heftiges Krankheitsgefühl mit intensivem Frieren
heftige Anstrengung (Tenesmus) bei Körperausscheidungen (Erbrechen, Husten, Stuhlgang)
am schlimmsten morgens, besser abends, besser durch Ruhe
Umgekehrt können mehrere Patienten mit derselben Beschwerde, aber unterschiedlichen Modalitäten verschiedene Arzneien erfordern. Als Beispiel diene ein akuter Lumbago:
Der erste Patient leidet unter Rückenschmerzen durch Überheben, kann nicht still stehen, sitzen oder liegen, muss sich häufig recken und strecken, trägt eine Wärmflasche auf dem Rücken, kann wegen nächtlicher Unruhe und Herumwälzen im Bett keinen Schlaf finden; einzig bei fortgesetzter langsamer Bewegung erfährt er Linderung und braucht Rhus toxicodendron.
Der zweite Patient hat sich ebenfalls verhoben, aber liegt still und steif an die Wand gedrückt im Bett und vermeidet jede kleinste Bewegung, will weder untersucht noch berührt werden und wehrt energisch eine warme Bettflasche ab; er braucht Bryonia.