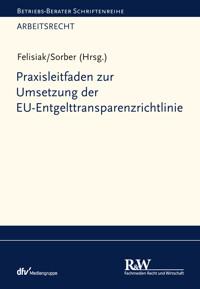
57,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Betriebs-Berater Schriftenreihe/ Arbeitsrecht
- Sprache: Deutsch
Die Entgelttransparenzrichtlinie der EU und ihre nationale Umsetzung entwickeln sich zum strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Künftig wird in Unternehmen offen über Geld gesprochen – ein Perspektivwechsel mit weitreichenden Folgen. Dieser Praxisleitfaden vermittelt kompakt und verständlich die zentralen Grundlagen der Richtlinie. Er bietet nicht nur arbeitsrechtlich Versierten, sondern insbesondere Nicht-Jurist*innen im Unternehmen einen praxisnahen Zugang zur Umsetzung. Unternehmen, die untätig bleiben, riskieren nicht nur Bußgelder und Schadensersatzforderungen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste. Vergütungstransparenz ist kein Selbstzweck – sie wird zum entscheidenden Baustein einer zukunftsorientierten und rechtssicheren Unternehmensstrategie. Unternehmen, die frühzeitig auf Transparenz setzen, verschaffen sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Umsetzung erfordert sorgfältige Vorbereitung: Der Leitfaden stellt die Systematik der Richtlinie ebenso dar wie deren vielfach unterschätzte Regelungsinhalte. Zentrale Erfolgsfaktoren wie effektives Stakeholder-Management und klare interne Verantwortlichkeiten werden ebenso behandelt wie vertiefende Einzelfragen. Dazu zählen: - Missbrauchsschutz und prozessuale Risiken - Kollektivrechtliche Bezüge (Betriebsrat, Tarifbindung) - Auswirkungen auf variable Vergütung - Equal Pay und interne Entgeltstrukturen - Haftungsrisiken für Arbeitgeber*innen und Organe - Relevanz in M&A-Transaktionen und Due-Diligence-Prozessen - Aufbau von Funktions- und Hierarchieebenen bis hin zu Grading-Systemen Abschließend werden konkrete Lösungsansätze zur Beseitigung ungerechtfertigter Entgeltunterschiede sowie praxiserprobte Handlungsempfehlungen für die Unternehmenspraxis aufgezeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Praxisleitfaden zur Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie
Herausgegeben von:
Dr. Michaela Felisiak, LL.M.
und
Dr. Dominik Sorber
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar
ISBN 978–3–8005–1975–0
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza Printed in Germany
Autoren- und Herausgeberverzeichnis
Nicole Barz
Rechtsanwältin München
Jan-Philipp Brune
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Michaela Felisiak, LL.M.
Fachanwältin für Arbeitsrecht, München
Niklas Kastel
Rechtsanwalt München
Christina Knoepffler
Referentin im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, München
Markus Matt
Journalist & HR-Experte, München
Dr. Dominik Sorber
Fachanwalt für Arbeitsrecht, München
Raffaela Stutz
Senior Principal, Mercer – Career / Rewards, München
Stefan Würz
Senior Principal, Mercer – Career / Rewards, Frankfurt am Main
Rorry Zhang
Manager, Mercer – Career / Rewards, Wien
Vorwort
Entgelttransparenz ist kein Randthema mehr – sie wird zum strategischen Erfolgsfaktor.
Jahrzehntelang galt: Über Geld spricht man nicht. Dieses Sprichwort ist überholt. Mit der Entgelttransparenzrichtlinie müssen Arbeitgeber, Betriebsräte und Beschäftigte offenlegen, begründen und vergleichen, wie sich Gehälter zusammensetzen.
Die vertrauten Unternehmensphilosophien wie „Aber das haben wir schon immer so gemacht“, „Aber das haben wir noch nie so gemacht“ und „Aber die anderen machen das genau so“ tragen künftig als Ausreden nicht mehr. Wer sie weiter pflegt, riskiert Rechtsverstöße, Imageschäden und den Verlust von Fachkräften.
Dieses Praxisbuch zeigt, warum Offenheit beim Entgelt kein Risiko, sondern eine Chance ist – und wie Sie die Richtlinie rechtssicher, pragmatisch und mit Mehrwert umsetzen. Es verbindet die juristische Präzision eines Kommentars mit der HandsonPerspektive eines Leitfadens: Sie erfahren die Hintergründe, Pflichten und Fristen, lernen erprobte Werkzeuge zur diskriminierungsfreien Gehaltsgestaltung kennen und sehen, wie sich Transparenz in eine tragfähige Arbeitgeberstrategie übersetzen lässt – damit Sie in Ihrem Unternehmen sagen können: Wir sprechen über Entgelt und machen das zur Unternehmensstrategie.
Utting/München, Mai 2025
Dr. Michaela Felisiak, LL.M.
Dr. Dominik Sorber
Inhaltsverzeichnis
Autoren- und Herausgeberverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Einleitung & Status Quo aus Unternehmenssicht
A. Chancen und Herausforderungen für Unternehmen
I. Chancen mit Umsetzung der EntgTranspRL
II. Herausforderungen bei der Umsetzung der EntgTranspRL
B. Entgelttransparenz aus Unternehmensperspektive im Überblick
I. Ziele der EntgTranspRL
II. Überblick über die zentralen Aspekte der EntgTranspRL
1. Transparenz im Bewerbungsverfahren
2. Informationspflichten während des Beschäftigungsverhältnisses
3. Erweitertes Auskunftsrecht
4. Entgeltberichterstattung
5. Gemeinsame Entgeltbewertung
6. Beweislastumkehr
7. Sanktionen bei Verstößen
III. Status Quo in Deutschland
C. Rückschau: Überblick über die Entwicklungen der Entgelttransparenz auf europäischer und nationaler Ebene
I. Kurzüberblick über die Entwicklung der Entgelttransparenz auf EU-Ebene
1. Frühe Initiativen und Rechtsgrundlagen
2. Einordnung der EntgTranspRL
II. Kurzüberblick über die Entwicklung der Entgelttransparenz auf nationaler Ebene (Deutschland)
1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 2006
2. Entgelttransparenzgesetz 2017
3. Zwischenfazit
III. Überblick über die jüngste Rechtsprechung
IV. Verschärfungen bei Umsetzungsfrist der EntgTranspRL
1. Gravierende Verschärfungen mit Blick auf den Auskunftsanspruch
2. Absenkung der Schwellenwerte für Berichtspflicht
3. Striktere Sanktionen für Verstöße
4. Beweislastumkehr bei Lohnklagen
5. Stärkere Einbindung von Betriebsräten und Gewerkschaften
D. Bedeutung für das HR-Personalmanagement
I. Überblick über die künftigen Aufgaben für HR-Abteilungen
1. Überprüfung und Anpassung der Vergütungssysteme
2. Implementierung von Transparenzmaßnahmen im Recruiting-Prozess
3. Erstellung von Entgeltberichten
4. Vorbereitung auf die Beweislastumkehr
5. Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Arbeitnehmervertretungen
6. Schulungen und Sensibilisierung der Führungskräfte
II. Risiken bei Nicht-Umsetzung und Sanktionen
1. Hohe Bußgelder
2. Schadenersatzforderungen
3. Ausschluss von öffentlichen Aufträgen
4. Reputationsverlust
E. Fazit
Kapitel 2 Vom Stakeholder-Management zur Rechtsdurchsetzung: Systematik der Entgelttransparenz-Richtlinie
A. Die Entgeltgleichheit nach der EntgTranspRL
I. Einführung
1. Zielsetzung und zentrale Regelungen der EntgTranspRL
2. Historischer Rückblick: Frühe Rechtsprechung des BAG
3. Aktuelle Bedeutung der historischen Argumente
4. Grundrechtsdimension der EntgTranspRL
5. Anforderungen an (zulässige) Vergütungssysteme VOR der Umsetzung EntgTranspRL
a) Rechtliche Grundlagen und unionsrechtlicher Rahmen
b) Anforderungen an die Ausgestaltung objektiver Vergütungskriterien
aa) Maßstab: Objektivierbarkeit
bb) Erfordernis der vollständigen Abbildung der Tätigkeit
cc) Verbot geschlechtsabhängiger Bewertungssysteme
6. Praxiserprobte objektive Differenzierungskriterien in Vergütungssystemen
a) Eingeschränkter Katalog zulässiger Kriterien
b) Voraussetzungen für leistungs- und qualifikationsbezogene Differenzierungen
c) Berufserfahrung als legitimes Differenzierungskriterium
d) Konsequenzen für die Praxis und Handlungsempfehlungen
II. Der Rechtsanspruch – gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit
1. Grundsatz der Gleichbehandlung
2. Begriff „gleichwertige Arbeit“
3. Update der Begriffsbestimmung durch die EntgTranspRL
III. Verstärkte Durchsetzungsmechanismen und prozessuale Besonderheiten
1. Beweislastumkehr und Prozessökonomie
2. Einführung kollektiver Rechtsverfolgung
3. Sanktionen und Rechtsfolgen bei Verstößen
4. Neue Rolle der Gleichstellungsstellen und Aufsichtsbehörden
B. Stakeholder-Management im Kontext der EntgTranspRL
I. Bedeutung des Stakeholder-Managements
II. Wer sind die relevanten Stakeholder (Stakeholder-Management):
1. Unternehmen
2. Mitarbeitende/betroffene Beschäftigtengruppen
3. Arbeitnehmervertretungen
4. Gewerkschaften/Tarifparteien
5. Behörden/Verbände
6. Antidiskriminierungsstellen/Gleichstellungsbeauftragte
7. Aufsichtsbehörden/Gleichbehandlungsstellen gem. Art. 28 EntgTranspRL
8. Bewerberinnen und Bewerber
III. Stakeholder-Management
1. Interaktionen und Interessenkonflikte
2. Gestaltung einer wirksamen Stakeholder-Strategie
3. Exkurs: Stakeholder-Management im internationalen Konzernkontext
C. False Friends
I. Wer (unerwartet) dazugehört
1. Persönlicher Anwendungsbereich
2. Geschäftsführer
II. Tarifbindung – ein gefährlicher False Friend
1. Langjährige unionsrechtliche Überprüfbarkeit tariflicher Regelungen
2. Keine Ausnahme für Tarifverträge – unionsrechtlich unzulässig
3. Zur Diskussion im nationalen Umsetzungsprozess
III. Variable Vergütung, Leistungsbeurteilung und virtuelle Beteiligungen– versteckte False Friends
1. Variable Vergütungsbestandteile – kein rechtsfreier Raum
2. Virtuelle Beteiligungen – kein rechtsfreier Raum für Führungskräfte
IV. Umsetzungspflicht und unmittelbare Wirkung – ein weiterer False Friend
V. Weitere trügerische Annahmen – das große Finale der False Friends
1. Datenschutz – kein Schutzschild gegen Transparenzpflichten
2. Gleichbehandlung ≠ Gleichmacherei – differenzieren ist erlaubt, aber begründungspflichtig
3. Vergleich über den Betriebszaun hinaus – der Mythos vom „gleichen Arbeitgeber“
4. Diskriminierung in einer geschlechtsgleichen Gruppe – kein Widerspruch
VI. Fazit
D. Rechtsmissbrauch und Entgelttransparenz
I. Rechtsmissbrauch nach nationalem Recht
II. Rechtsmissbrauch als Rechtsgrundsatz im Unionsrecht
III. Rechtsmissbrauch im Anwendungsbereich des Entgelttransparenzgesetzes
IV. Bedeutung des Rechtsmissbrauchs mit Blick auf die Entgelttransparenzrichtlinie
Kapitel 3 Entgelttransparenz und kollektives Arbeitsrecht
A. Rolle und Rechte der „Sozialpartner“ nach der EntgTranspRL
I. Rolle und Rechte der „Arbeitnehmervertretung“ nach der EntgTranspRL
1. Begriffsbestimmung
2. Beteiligung im Rahmen der Entgeltbewertung
a) Aufstellung der Bewertungskriterien
b) Mitwirkung bei der Berichterstattung
c) Gemeinsame Entgeltbewertung
3. Vertretung und Unterstützung der Beschäftigten bei der Rechtsdurchsetzung
a) Unterstützung bei der Geltendmachung von Auskunftsrechten
b) Unterstützung und Vertretung in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
4. Schutz vor Diskriminierung
II. Bewertung und praktische Umsetzungshinweise
1. Handlungs- und Überprüfungsbedarf für alle Arbeitgeber
2. Zuständigkeitsfragen
a) Konkurrenz zwischen betrieblichen Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften
aa) Zuständigkeit bei der Entgeltbewertung
bb) Zuständigkeit bei der Unterstützung der Beschäftigten bei der Rechtsdurchsetzung
b) Konkurrenz zwischen mehreren betrieblichen Arbeitnehmervertretern
3. Schulungsbedarf
B. Fazit
Kapitel 4 Vergütungsansprüche und Haftungsrisiken
A. Das Entgelttransparenzgesetz – (k)ein Grund zu klagen?
I. Prozessuale Herausforderungen und Änderungen
1. Darlegungs- und Beweislast Rechtsprechung – status quo
2. Änderung der Darlegungs- und Beweislast durch die Entgelttransparenzrichtlinie
3. Kostentragung des Verfahrens
4. Verjährung von Ansprüchen aus dem Entgelttransparenzgesetz
II. Schutz vor rückwirkenden Ansprüchen – Ausschlussklauseln und Abgeltungsklauseln
1. Ausschlussklauseln für Ansprüche aus dem Entgelttransparenzgesetz
2. Abgeltungsklauseln in Beendigungsvereinbarungen
3. Einfluss der Entgelttransparenzrichtlinie auf Ausschlussklauseln und Abgeltungsklauseln
B. Fazit
Kapitel 5 Transparente Deals: Zum Einfluss der neuen Entgelttransparenzrichtlinie auf M&A-Transaktionen
A. Die Entgelttransparenzrichtlinie als treibender Faktor in künftigen M&A-Verhandlungen
I. Risiken und Nebenwirkungen der Entgelttransparenz im Rahmen von M&A-Transaktionen
II. Allgemeine Bestimmungen (Kapitel I der EntgTranspRL) unter dem Blickwinkel von M&A-Transaktionen
1. Geltungsbereich (Art. 2 EntgTranspRL) auch für M&A-Transaktionen
2. Gleiche und gleichwertige Arbeit (Art. 4 EntgTranspRL) hinsichtlich M&A-Transaktionen
III. Entgelttransparenz im Sinne der EntgTranspRL (Kapitel II der EntgTranspRL) hinsichtlich M&A-Transaktionen
1. Rechte der Stellenbewerber und Arbeitnehmer (Art. 5 und 7 EntgTranspRL) und M&A-Transaktionen
2. Pflichten der Arbeitgeber (insbes. Art. 6 und 9 EntgTranspRL) hinsichtlich M&A-Transaktionen
IV. Rechtsmittel und Rechtsdurchsetzung (Kapitel III der EntgTranspRL) mit Bezug zu M&A-Transaktionen
1. Schadensersatzanspruch (Art. 16 EntgTranspRL)
a) Beweislastverlagerung (Art. 18 EntgTranspRL)
b) Nachweis für gleiche oder gleichwertige Arbeit (Art. 19 EntgTranspRL)
c) Beweismittelzugang (Art. 20 EntgTranspRL)
2. Sanktionen (Art. 23 EntgTranspRL)
3. Regelungen zu öffentlichen Aufträgen und Konzessionen (Art. 24 EntgTranspRL) als Red Flag
B. Fazit – Herausforderungen der Entgelttransparenzrichtlinie in M&A-Transaktionen meistern
Kapitel 6 Umsetzung der Entgelttransparenz-RL auf Vergütungsstrukturen
A. Umsetzung auf Vergütungssysteme
I. Grundanforderungen der Richtlinie & Stand in Deutschland
1. Wesentliche Vorgaben der Richtlinie
2. Umsetzung und aktuelle Situation in Deutschland
II. Vorbereitung auf die neuen Anforderungen
1. Aufbau einer kohärenten Funktions- und Hierarchiestruktur
a) Erfassung und Analyse bestehender Funktionsprofile
b) Definition funktional ähnlicher Tätigkeitsgruppen („Funktions-Cluster“)
c) Einführung eines Grading-Systems
2. Definition einer Vergütungsstrategie
3. Aufbau einer marktkonformen Gehaltsstruktur
4. Durchführung erster Pay-Equity-Analysen
5. Entwicklung und Anpassung der HR-Prozesse
III. Praktische Herausforderungen und Lösungsansätze
1. Verzerrungen durch die Job Architektur
2. Unbewusste Verzerrung in Gehalts- und Beförderungsentscheidungen
3. Mangelnde Transparenz und Widerstand gegen Veränderung
4. Langfristige Sicherstellung von Entgeltgerechtigkeit
B. Fazit & Handlungsempfehlungen
Kapitel 7 Lösungsansätze zur Beseitigung nicht gerechtfertigter Entgeltunterschiede
A. Ausgangspunkt: Gemeinsame Entgeltbewertung (Art. 10 EntgTranspRL)
I. (Neue) Rechtliche Rahmenbedingungen
II. Einordnung
B. Möglichkeit 1: Entgeltgleichheit durch Angleichung der Arbeitsentgelte „nach oben“
C. Möglichkeit 2: Entgeltgleichheit durch Angleichung „nach unten“
I. Rechtliche Rahmenbedingungen
II. Herstellung von Entgeltgleichheit im Wege der Änderungskündigung
III. Entgeltreduzierung durch Einführung/Änderung kollektiver Arbeitsvertragsbedingungen
D. Fazit: Besitzstandswahrung – Beibehaltung des Status quo?
Kapitel 8 Zukunftsausblick & Handlungsempfehlungen
I. Analyse der bestehenden Lohnstruktur
II. Festlegung transparenter Vergütungsstrategien
III. Benchmark
IV. Kommunikation vorbereiten
V. Einhaltung rechtlicher Vorgaben
VI. Erstellung von Entgeltberichten
VII. Verantwortlichkeiten klären/Internes Kontrollsystem
Anhang
Kapitel 1Einleitung & Status Quo aus Unternehmenssicht
A. Chancen und Herausforderungen für Unternehmen
1
Wir schreiben das Jahr 2025 und immer noch gibt es massive Unterschiede zwischen den Gehältern bei Männern und Frauen. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Nachbarländern. Und das, obwohl bereits seit 1957 in den europäischen Verträgen1 verankert ist, dass Männer und Frauen in Europa bei „gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ das gleiche Entgelt beziehen sollen.
2
Nach wie vor bestehen signifikante Unterschiede in der Entlohnung von Männern und Frauen – das sogenannte Gender Pay Gap (nachfolgend „GPG“). Damit ist der Umstand gemeint, dass Frauen in Deutschland durchschnittlich 18% weniger verdienen als Männer (sog. unbereinigter Gender Pay Gap). Selbst bei vergleichbarer Qualifikation, Tätigkeit und Erwerbsbiografie verdienen Frauen 6% weniger als ihre männlichen Kollegen (sog. bereinigter Gender Pay Gap).2 Diese Ungleichheit zieht sich durch viele Branchen und Unternehmensgrößen. Um dem entgegenzuwirken, trat am 6. Juni 2023 die Entgelttransparenz-Richtlinie (EU) 2023/9703 in Kraft (nachfolgend „EntgTransp-RL“). Bis zum 7. Juni 2026 haben die Mitgliedstaaten Zeit, diese in nationales Recht umzusetzen. Viele Unternehmen haben noch nicht erkannt, was das konkret bedeutet und dass bereits jetzt Handlungsbedarf besteht.
3
Manch einer könnte einwenden: Gibt es in Deutschland nicht längst Regelungen hierzu? Immerhin untersagt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) die unmittelbare sowie mittelbare Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Zudem wurde bereits 2017 das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) verabschiedet.
4
Das ist richtig – und dennoch ist von echter Entgeltgleichheit in Deutschland (noch) keine Rede. Das zeigt sich sowohl an Hand der hierzu ergangenen Rechtsprechung4 als auch an einschlägigen Statistiken5. Unternehmen sollten sich bereits jetzt darauf vorbereiten, dass die Debatte um Entgeltgleichheit an Dynamik und Bedeutung auf verschiedenen Ebenen gewinnt. Gleichzeitig wächst der Druck aus Brüssel: Die EntgTranspRL geht in vielen Punkten deutlich über die bestehenden Vorgaben des deutschen EntgTranspG hinaus – und zwingt Unternehmen zum Handeln.
I. Chancen mit Umsetzung der EntgTranspRL
5
Das Wichtigste gleich vorab: Wie bei vielen Compliance-Themen bietet die Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie für Unternehmen erhebliche Chancen. Durch eine aktive und transparente Beschäftigung mit Entgeltfragen können Arbeitgeber ihre Attraktivität am Markt signifikant steigern: Faire und nachvollziehbare Bezahlungsstrukturen stärken die Mitarbeiterzufriedenheit, erhöhen das Vertrauen und verbessern langfristig die Mitarbeiterbindung. Gerade in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels ist es entscheidend, sich als moderner und glaubwürdiger Arbeitgeber zu positionieren, um Talente anzuziehen und langfristig zu binden. Unternehmen, die sich aktiv für Entgeltgleichheit einsetzen, profitieren zudem von einer verbesserten Reputation, übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und heben sich positiv von Wettbewerbern ab. Transparente und faire Vergütungssysteme reduzieren Konfliktpotenziale, erhöhen die Mitarbeitermotivation, minimieren rechtliche Risiken und fördern ein produktives Betriebsklima.
6
Entgelttransparenz bietet Unternehmen zudem die Chance, sich als Vorreiter in Sachen Fairness und Gleichberechtigung zu positionieren. Gerade in Zeiten, in denen Diversity und Inklusion immer stärkerin den Fokus rücken, setzt Entgelttransparenz ein klares Signal für Gleichbehandlung am Arbeitsplatz. Diese Transparenz schafft Vertrauen innerhalb der Belegschaft und erhöht die Mitarbeiterbindung an das Unternehmen.
7
Die Umsetzung der Richtlinie ermöglicht es Unternehmen langfristig, effizienter und gerechter zu agieren, da strukturelle Probleme wie verdeckte Lohnunterschiede aufgedeckt und gezielt beseitigt werden können. Transparente Gehaltsstrukturen erleichtern (auch für Unternehmen) Gehaltsverhandlungen und fördern die Leistungsmotivation, da Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Arbeit fair und nachvollziehbar – insbesondere auch im Vergleich zu Kollegen – honoriert wird.
8
Aus strategischer Sicht ist eine frühzeitige Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie ratsam. Unternehmen, die rechtzeitig agieren, schaffen sich wertvollen Gestaltungsspielraum. Dieser kann resp. sollte genutzt werden, um proaktiv strategische Anpassungen der Vergütungsstruktur vorzunehmen, etwa durch gezielte Gehaltserhöhungen (z.B. in Etappen) oder Anpassungen einzelner Entgeltbestandteile (individueller Bonus).6 So können bestehende Ungleichheiten schrittweise und nachhaltig korrigiert werden, anstatt später kurzfristig reagieren zu müssen. Ein frühzeitiges Handeln ist Kernbestandteil nachhaltiger Unternehmensführung und signalisiert der Belegschaft, dass faire und leistungsgerechte Bezahlung aktiv gefördert wird. Dies stärkt die positive Wahrnehmung im Unternehmen und reduziert das Risiko kostenintensiver Konflikte und rechtlicher Auseinandersetzungen, die dem Image und Betriebsklima nachhaltig schaden könnten.
9
Unternehmen sollten die Entgelttransparenz zudem als Gewinn betrachten: Transparenz in Vergütungsfragen ist eng mit Unternehmenswerten, Mitarbeiteridentifikation sowie der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter verbunden. Leistungsträger und Talente gewinnt und hält man nicht mit einfachen Benefits wie einem Obstkorb, sondern mit einer nachhaltigen HR-Strategie, zu der Entwicklungsmöglichkeiten, Verantwortung und transparente, marktgerechteVergütungsstrukturen zählen. Auch innovative Vergütungsbestandteile wie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme7 sind längst nicht mehr nur in Startups, sondern auch in mittelständischen Unternehmen zu finden. Die Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie ist daher nicht nur eine lästige Pflicht, sondern ein essenzieller Schritt hin zu einer zukunftsorientierten HR-Strategie. Die Planung und Umsetzung sollten daher frühzeitig mit klaren Verantwortlichkeiten und abgestimmten Entscheidungen erfolgen. Falls Sie in Ihrem Unternehmen noch überzeugende Argumente für eine umfassende HR-Strategie suchen, hilft möglicherweise ein kurzer Selbsttest:
10
Fragen Sie sich, warum Sie selbst in der Vergangenheit einen Arbeitgeber gewechselt haben. Der häufigste Grund ist laut Studien das Gehalt (73%)8. Unzufriedenheit mit Arbeitsbedingungen und ungerechter Vergütung zählen regelmäßig zu den Hauptursachen für Jobwechsel. Erfassen Sie intern, warum Mitarbeiter Ihr Unternehmen verlassen? Wenn nicht, sollten Sie dies zukünftig tun. Ermitteln Sie dabei auch, welche Kosten dadurch entstehen – etwa durch Produktivitätsverlust, weiteren Folgekündigungen im Team, Recruiting-Kosten oder Einarbeitungsaufwand. Diese Kostenanalyse verdeutlicht, dass die Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie nicht nur aus Compliance-Sicht wichtig ist, sondern auch erhebliche finanzielle Vorteile mit sich bringt. Zu den wesentlichen Faktoren, die Mitarbeiter bei einem neuen Arbeitgeber erwarten, zählen langfristige Arbeitsplatzsicherheit (69%), höheres Gehalt (65%) und gutes Führungsverhalten (63%).9
II. Herausforderungen bei der Umsetzung der EntgTranspRL
11
Allerdings birgt die Umsetzung der EntgTranspRL auch Herausforderungen, insbesondere für Unternehmen kleiner und mittlerer Größe (nachfolgend „KMUs“). Der bürokratische und administrative Aufwand steigt, da Unternehmen beispielsweise künftig verpflichtet sind, nicht nur Gehälter offenzulegen, sondern bereits ab 100 Arbeitnehmern10 auch umfassende Entgeltberichte zu erstellen. Unter 100 Arbeitnehmern „sollten“ Unternehmen dies bereits tun.
12
KMUs fehlen häufig die personellen, finanziellen und organisatorischen Ressourcen, um komplexe Vergütungsstrukturen detailliert zu analysieren und Anpassungen schnell umzusetzen. Darüber hinaus verfügen KMUs oft nicht über spezialisierte HR-Abteilungen (People and Culture) oder rechtliches Know-how, um den Anforderungen effizient gerecht zu werden. Deshalb sind gerade diese Unternehmen gut beraten, sich frühzeitig und strukturiert mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Nur so können sie sicherstellen, die gesetzlichen Vorgaben fristgerecht zu erfüllen und gleichzeitig potenzielle Haftungs- und Reputationsrisiken zu vermeiden.
B. Entgelttransparenz aus Unternehmensperspektive im Überblick
13
Am 10. Mai 2023 wurde die EntgTranspRL erlassen, im Juni 2023 trat sie in Kraft. Wenngleich bis zum Ablauf ihrer Umsetzungsfrist am 7. Juni 2026 (Art. 34 Abs. 1 EntgTranspRL) nur noch weniger als ein Jahr Zeit ist, sind Diskussionen (in der Fachwelt) über die Umsetzung bislang ausgeblieben.11 Allein angesichts der Tatsache, dass sich die Mehrheiten im Deutschen Bundestag nach den Neuwahlen Ende Februar 2025 erst finden mussten, kann kaum mit Sicherheit behauptetwerden, dass diese Frist eingehalten werden wird. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD gibt es keine konkreten Hinweise auf die Umsetzung der EntgTranspRL.12 Dennoch werden die Auswirkungen der EntgTranspRL die Unternehmen und die Arbeitsgerichte unabhängig von einer nationalen Umsetzung erreichen. Arbeitgeber sollten frühzeitig Vorkehrungen treffen, um die eigenen Entgeltstrukturen richtlinienkonform auszugestalten und die Chancen, Entgeltstrukturen (neu) aufzubauen, zu nutzen.
I. Ziele der EntgTranspRL
14
Ziel der EntgTranspRL ist es, die geschlechtergerechte Entgeltstruktur und Transparenz zu fördern sowie den Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit (vergleiche hierzu Art. 157 Abs. 1 AEUV) wirkungsvoll durchzusetzen (siehe Art. 1 EntgTranspRL). Dazu soll sie
die Entgeltdiskriminierung, insbesondere geschlechtsspezifische Lohnunterschiede, abbauen (vergleiche zum Beispiel Art. 1, 4 Entg-TranspRL),
die Entgeltgestaltung transparenter machen, indem unter Umständen detaillierte Informationen über Entgeltstrukturen bereitgestellt werden müssen (vergleiche zum Beispiel Art. 5ff. EntgTranspRL, insbesondere Art. 7 EntgTranspRL (Auskunftsrecht)), und
Verstöße gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts durch verstärkte Durchsetzungsmechanismen effektiv verhindern und gegebenenfalls sanktionieren (vergleiche insbesondere Art. 23 EntgTranspRL, aber in diesem Zusammenhang auch Art. 16 EntgTranspRL).
15
Schon aus dieser kurzen Zusammenstellung wird deutlich: Die Auswirkungen der EntgTranspRL werden sich nicht nur punktuell zeigen. Sie werden das Beschäftigungsverhältnis umfassend prägen und sogar vor Eingehen einer vertraglichen Beziehung Einfluss auf ein etwaiges künftiges Beschäftigungsverhältnis haben (vergleiche zum Beispiel Art. 5 EntgTranspRL). Für Arbeitgeber bedeuten die massiven Ausweitungen, insbesondere auf der Durchsetzungs- und Sanktionsebene, im Vergleich zum bestehenden Recht und dem nationalen Entgelttransparenzgesetz13, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, um gesetzeskonform aufgestellt zu sein.14
II. Überblick über die zentralen Aspekte der EntgTranspRL
16
Die Richtlinie beinhaltet mehrere spezifische Anforderungen:
1. Transparenz im Bewerbungsverfahren
17
Arbeitgeber müssen Bewerbern Informationen über das Einstiegsentgelt oder dessen Spanne sowie über einschlägige Tarifbestimmungen bereitstellen. Zudem dürfen sie Bewerber nicht nach ihrer bisherigen Gehaltsgeschichte fragen.
2. Informationspflichten während des Beschäftigungsverhältnisses
18
Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter über die Kriterien für die Festlegung und Entwicklung des Entgelts zu informieren.
3. Erweitertes Auskunftsrecht
19
Beschäftigte haben das Recht, Informationen über das durchschnittliche Entgelt anderer Arbeitnehmer des eigenen und des anderen Geschlechts für gleiche oder gleichwertige Arbeit zu erhalten.
4. Entgeltberichterstattung
20
Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten sind verpflichtet, regelmäßig über ihre Entgeltstrukturen zu berichten. Die Häufigkeit dieser Berichte variiert je nach Unternehmensgröße:
Unternehmen mit 250 oder mehr Beschäftigten: jährliche Berichterstattung ab dem 7. Juni 2027.
Unternehmen mit 150 bis 249 Beschäftigten: dreijährliche Berichterstattung ab dem 7. Juni 2031.
Unternehmen mit 100 bis 149 Beschäftigten: dreijährliche Berichterstattung ab dem 7. Juni 2031.
5. Gemeinsame Entgeltbewertung
21
Wenn ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle von mindestens 5%
festgestellt wird und nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt ist, sind Arbeitgeber verpflichtet, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern eine Entgeltbewertung durchzuführen.
6. Beweislastumkehr
22
In Fällen von vermuteter Entgeltdiskriminierung liegt die Beweislast für das Gegenteil beim Arbeitgeber. Dieser muss nachweisen, dass keine Diskriminierung stattgefunden hat.
7. Sanktionen bei Verstößen
23
Arbeitgeber, die die Vorgaben der Entgelttransparenzrichtlinie missachten, müssen künftig mit spürbaren Sanktionen rechnen. Art. 23 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein Sanktionsregime einzurichten, das „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ ist. In der Praxis können dies Bußgelder sein, die sich am Bruttojahresumsatz oder an der gesamten Lohn- und Gehaltssumme des Unternehmens orientieren – vergleichbar mit den Bußgeldmechanismen der DSGVO.15 Ebenso kommt der Entzug öffentlicher Fördermittel oder der Ausschluss von Vergabeverfahren in Betracht. Ergänzend gewährt Art. 16 den betroffenen Beschäftigten einen Anspruch auf Entschädigung beziehungsweise Schadensersatz, sodass finanzielle Folgen nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch zivilrechtlich drohen.
III. Status Quo in Deutschland
24
Deutschland hat bereits mit dem Entgelttransparenzgesetz (Entg-TranspG) von 2017 erste Schritte unternommen, um die Entgeltgleichheit zu fördern. Dieses Gesetz gewährt Beschäftigten in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern einen individuellen Auskunftsanspruch über das Vergleichsentgelt. Zudem sind Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten verpflichtet, regelmäßig Berichte zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit zu erstellen. Allerdings hat eine Evaluierung des Gesetzes gezeigt, dass nur wenige Beschäftigte von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch gemacht haben und viele Unternehmen ihre Entgeltstrukturen nicht überprüft haben.
25
Mit der neuen EU-Richtlinie steigt der Druck auf Unternehmen, ihre Vergütungsstrukturen transparenter zu gestalten und proaktive Maßnahmen zur Sicherstellung der Entgeltgleichheit zu ergreifen.
C. Rückschau: Überblick über die Entwicklungen der Entgelttransparenz auf europäischer und nationaler Ebene
26
Die Gleichstellung der Geschlechter mit Blick auf das Thema Vergütung ist seit Jahrzehnten ein zentrales Anliegen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Trotz vielfältiger Bemühungen bestehen indes nach wie vor geschlechtsspezifische Lohnunterschiede. Um diesen entgegenzuwirken, wurden sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland verschiedene gesetzliche Maßnahmen ergriffen. Zentraler Umsetzungsschritt ist die EntgTranspRL, die bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss.
I. Kurzüberblick über die Entwicklung der Entgelttransparenz auf EU-Ebene
1. Frühe Initiativen und Rechtsgrundlagen
27
Das Prinzip des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist seit den Anfängen der Europäischen Gemeinschaft verankert. Bereits im Vertrag von Rom 1957 wurde in Artikel 119 das Gebot der Entgeltgleichheit festgeschrieben. In den folgenden Jahrzehnten wurden mehrere Richtlinien erlassen, um die Gleichstellung am Arbeitsplatz zu fördern.
28
Trotz dieser rechtlichen Rahmenbedingungen blieben die Fortschritte bei der Schließung des Gender-Pay-Gaps begrenzt. Das war auch der Auslöser, der die Europäische Union veranlasste, weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Entgeltgleichheit zu ergreifen.
2. Einordnung der EntgTranspRL
29
Angesichts der anhaltenden Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern verabschiedete das Europäische Parlament im März 2023 die EntgTranspRL.
30
Klar ist: Die Richtlinie zielt darauf ab, durch erhöhte Transparenz und spezifische Informationspflichten die Lohnlücke zu schließen und darüber hinaus den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu stärken. Die EntgTranspRL verpflichtet Unternehmen, ihre Entgeltstrukturen offenzulegen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Entgeltgleichheit zu implementieren. Die Mitgliedstaaten sind angehalten, diese Richtlinie bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umzusetzen.
II. Kurzüberblick über die Entwicklung der Entgelttransparenz auf nationaler Ebene (Deutschland)
1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 2006
31
In Deutschland wurde mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Jahr 2006 ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz eingeführt, das unter anderem die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts im Arbeitsleben verbietet. Das AGG bildet die Grundlage für den Schutz vor Diskriminierung und fördert die Gleichbehandlung in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Entlohnung.
32
Obwohl das AGG formell sämtliche Entgeltbenachteiligungen wegen des Geschlechts untersagt, hat sich in der Praxis gezeigt, dass das Gesetz sein Ziel – eine wirksame Beseitigung unter anderem des Gender Pay Gaps – nur unzureichend erreicht. Dies belegt insbesondere der Statistische Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS): Dort stieg der Anteil der Beschwerden, die sich speziell auf Entgelt- und Beförderungsdiskriminierung beziehen, in den letzten Jahren kontinuierlich an. Parallel weisen die von der ADS ausgewerteten Erfolgsquoten gerichtlicher Klagen darauf hin, dass die Darlegungs- und Beweislastregelung des § 22 AGG für Betroffene weiterhin eine hohe Einstiegshürde bleibt.
33
Vor diesem Hintergrund mehren sich in Wissenschaft und Politik die Rufe nach einer Reform des AGG.
2. Entgelttransparenzgesetz 2017
34
Um die Entgeltgleichheit weiter zu fördern, trat am 6. Juli 2017 das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) in Kraft. Dieses Gesetz sollte bereits das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchsetzen. Es ergänzt das AGG und sieht verschiedene Instrumente zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit vor:
Auskunftsanspruch
35
Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern können danach Auskunft über die Kriterien und Verfahren der Entgeltfestlegung sowie über das Vergleichsentgelt erhalten.
36
Nach derzeitigem Entgelttransparenzgesetz gilt der individuelle Auskunftsanspruch nur in Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten (§ 12 Abs. 1 EntgTranspG16). Die anfragende Person muss außerdem selbst eine Tätigkeit benennen, die ihrer Arbeit gleich oder gleichwertig ist (§ 10 Abs. 1 S. 2). Kommt der Arbeitgeber der Anfrage nach, reicht bislang die Mitteilung des Medians der Vergleichsvergütung aus (§ 11 Abs. 3 S. 2); weitergehende Entgeltangaben schuldet er nicht.
Beweislast
37
Bislang enthält das EntgTranspG nur eine ausdrückliche Beweislastregel für den Sonderfall, dass ein nicht tarifgebundener oder nicht tarifanwendender Arbeitgeber seiner Auskunftspflicht nach § 10 Entg-TranspG nicht nachkommt (§ 15 Abs. 5 EntgTranspG). Tarifgebundene bzw. tarifanwendende Arbeitgeber genießen hier ein Privileg: Für sie sieht das Gesetz bislang keine entsprechende Sanktion vor.17
38
Allerdings hat das BAG klargestellt, dass eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer bereits dann ein Indiz im Sinne des § 22 AGG vorweisen kann, wenn das eigene Entgelt unterhalb des mitgeteilten Medianwerts liegt.18 Kann eine Partei darlegen – und im Bestreitensfall beweisen –, dass Kolleg*innen des anderen Geschlechts für gleiche oder gleichwertige Arbeit höher bezahlt werden, besteht danach regelmäßig die Vermutung einer geschlechtsbedingten Entgeltbenachteiligung.
Berichtspflicht
39
Nach geltendem EntgTranspG sind bislang nur Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten verpflichtet, einen Entgeltbericht vorzulegen (§ 21 Abs. 1 EntgTranspG).
3. Zwischenfazit
40
Trotz dieser Maßnahmen wurde das Gesetz in der Praxis nur begrenzt19 genutzt, und es wurden weiterhin geschlechtsspezifische Lohnunterschiede festgestellt. Kritiker bemängelten unter anderem die hohen Schwellenwerte für die Anwendung des Gesetzes und das fehlende Verbandsklagerecht.
III. Überblick über die jüngste Rechtsprechung
41
Die aktuelle Rechtsprechung zeigt deutlich, warum Arbeitgeber das Thema Entgelttransparenz ernst nehmen sollten. Die Rechtsprechung des BAG zur Kausalitätsvermutung ist vor allem durch den Zweck des EntgTranspG, Entgeltdiskriminierung wegen des Geschlechts zu verhindern, geprägt.20
42
Grundlage dafür sind insbesondere §§ 3 Abs. 1, 7 EntgTranspG sowie Art. 157 Abs. 1 AEUV. Um zum Beispiel als Frau einen solchen Anspruch geltend zu machen, muss die betroffene Arbeitnehmerin zunächst darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass sie bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit im Vergleich zu männlichen Kollegen ein geringeres Entgelt erhält und damit benachteiligt wird. Dabei kommt ihr zugute, dass sie zur Begründung einer Benachteiligung „wegen des Geschlechts“ lediglich sogenannte Indizien glaubhaft machen muss, die eine geschlechtsbezogene Benachteiligung überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen. Sobald dies gelingt, tritt nach § 22 AGG eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast ein: Der Arbeitgeber trägt dann die volle Beweislast dafür, dass die unterschiedliche Bezahlung ausschließlich auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien beruht und das Geschlecht keinerlei Rolle spielte. Die Praxis zeigt, dass Arbeitgebern dieser Vollbeweis regelmäßig nur schwer gelingt. Für Unternehmen ist daher von entscheidender Bedeutung, welche konkreten Umstände von der Rechtsprechung als ausreichend gewichtige Indizien angesehen werden, um die Beweislastumkehr gemäß § 22 AGG auszulösen, und welche Strategien zur Widerlegung solcher Indizien erfolgversprechend sind. Klarheit zu diesen Fragen liefern insbesondere aktuelle Entscheidungen wie das Equal-Pay-Urteil des BAG vom 16. Februar 2023 (8 AZR 450/21), die die Anforderungen an die Indizwirkung und den Vollbeweis konkretisieren.
IV. Verschärfungen bei Umsetzungsfrist der EntgTranspRL
43
Die EntgTranspRL stellt die Mitgliedstaaten vor die Aufgabe, die darin enthaltenen Bestimmungen bis zum 7. Juni 2026 in nationalesRecht umzusetzen. Für Deutschland bedeutet dies, dass bestehende Gesetze, insbesondere das Entgelttransparenzgesetz, überprüft und angepasst werden müssen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Da einige Regelungen der EntgTranspRL über die bestehenden nationalen Vorschriften hinausgehen, ist mit Änderungen in folgenden Bereichen zu rechnen:
44
Die in den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie verankerten proaktiven Instrumente sorgen dafür, dass sämtliche relevanten Akteure – Arbeitgeber, Tarifparteien und Arbeitnehmervertretungen – künftig gemeinsam an der Verwirklichung der Entgeltgleichheit arbeiten. Wo bisher guter Wille allein nicht genügte, führt die EntgTranspRL verbindliche Verfahren ein: Vergütungssysteme sind systematisch auf mögliche – auch strukturelle – Benachteiligungen zu prüfen, und bei festgestellten Verstößen müssen konkrete Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden.
45
Unterstützung erhalten die Betriebe dabei von staatlicher Seite. Die Befugnisse der Antidiskriminierungsstelle des Bundes – und perspektivisch auch der entsprechenden Landesstellen – werden erheblich ausgeweitet, um die neuen Aufgaben aus EntgTranspRL wahrnehmen zu können.21 Parallel dazu werden die Mitwirkungs- und Kontrollrechte der Arbeitnehmervertretungen neu zugeschnitten und deutlich gestärkt, nicht zuletzt im Zusammenhang mit den künftig obligatorischen Entgeltberichten. Betriebs- und Personalräte übernehmen damit eine wesentlich aktivere und vielfältigere Rolle als bislang.
1. Gravierende Verschärfungen mit Blick auf den Auskunftsanspruch
46
Art. 7 der EntgTranspRL weicht in wesentlichen Punkten von den bisherigen §§ 10ff. EntgTranspG ab und zwingt den deutschen Gesetzgeber zu erheblicher Nachjustierung: So wird der individuelle Auskunftsanspruch künftig allen Beschäftigten zustehen – unabhängig von der Betriebsgröße.
47
Die bislang im Entgelttransparenzgesetz verankerte Schwelle von mehr als 200 Beschäftigten (§ 12 Abs. 1 EntgTranspG) darf damit nicht bestehen bleiben. Ebenso entfallen die bisherigen Begrenzungen zur Häufigkeit und zum inhaltlichen Zuschnitt der Anfrage: Während§ 10 Abs. 2 nur alle zwei Jahre und höchstens zu zwei Entgeltbestandteilen einen erneuten Antrag zulässt, erlaubt die Richtlinie weder ein Zeitintervall noch eine Beschränkung auf einzelne Vergütungskomponenten. Künftig muss der Zugriff auf sämtliche fixen, variablen und ergänzenden Entgelte in einer einzigen Auskunft möglich sein.
48
Auch die formalen Hürden des deutschen Rechts verlieren an Relevanz. Zwar kann es aus Dokumentationsgründen sinnvoll bleiben, das Auskunftsverlangen schriftlich zu stellen und eine Vergleichstätigkeit zu benennen; die Textform des § 10 Abs. 2 EntgTranspG sowie das Erfordernis einer „zumutbaren“ Tätigkeitsangabe (§ 10 Abs. 1 EntgTranspG) dürfen jedoch nicht länger als Aussschlusskriterium wirken.
49
Darüber hinaus fallen die engen Vorgaben des § 12 Abs. 2 und 3 Entg-TranspG – etwa Mindestgröße der Vergleichsgruppe oder diverse Vergleichsverbote – weg, weil die Richtlinie solche Einschränkungen nicht kennt; Vergleiche über verschiedenartige, aber gleichwertige Tätigkeiten werden ausdrücklich eröffnet.
50
Weiterer Anpassungsbedarf besteht hinsichtlich der Bezugsgröße des Vergleichsentgelts. Nach Art. 7 Abs. 1 EntgTranspRL ist die durchschnittliche Entgelthöhe der jeweiligen Vergleichsgruppe offenzulegen, während das EntgTranspG bislang auf den Median abstellt (§ 11 Abs. 3). Aber Vorsicht: Wo der Median für die anfragende Person vorteilhafter wäre, greift das in Art. 27 Abs. 2 EntgTranspRL verankerte Verschlechterungsverbot: Die Umsetzung der Richtlinie darf keinesfalls zu einem niedrigeren Schutzniveau führen.
2. Absenkung der Schwellenwerte für Berichtspflicht
51
Während das deutsche Entgelttransparenzgesetz derzeit nur für Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern Berichtspflichten vorsieht, erfasst die EU-Richtlinie Unternehmen bereits ab 100 Mitarbeitern. Die Bundesregierung wird die Schwellenwerte anpassen müssen. Die Mitgliedstaaten können von Arbeitgebern mit weniger als 100 Arbeitnehmern verlangen, Informationen über das Entgelt vorzulegen (Art. 9 Abs. 5 S. 2 EntgTranspRL). Von dieser Möglichkeit sollte der deutsche Gesetzgeber keinen Gebrauch machen, um kleinere Unternehmen zu entlasten.
52
Künftig müssen Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten (Art. 9 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5 EntgTranspRL) folgende Informationen zum Unternehmen zur Verfügung stellen:
das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle
das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen;
das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle;
das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen;
der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ergänzende oder variable Bestandteile erhalten;
der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jedem Entgeltquartal;
das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle zwischen Arbeitnehmern bei Gruppen von Arbeitnehmern, nach dem normalen Grundlohn oder -gehalt sowie nach ergänzenden oder variablen Bestandteilen aufgeschlüsselt.
53
Diese Informationen sind öffentlich zugänglich zu machen – beispielsweise auf der Unternehmenswebsite – oder in vergleichbarer Weise zu veröffentlichen (Art. 9 Abs. 7 EntgTranspRL). Der erstellte Bericht ist mindestens vier Jahre aufzubewahren. Daraus lässt sich im Umkehrschluss und aus der Binnensystematik der Richtlinie ableiten, dass Ansprüche aus der Richtlinie maximal vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden können. Denn wenn Unternehmen die Daten für vier Jahre vorzuhalten haben, scheiden Auskunftsansprüche und Ansprüche auf Geltendmachung nach vier Jahren aus. Die Frist berechnet sich nach den allgemeinen Regelungen.
54
Wird ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle von mindestens fünf Prozent festgestellt, das nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Faktoren erklärt werden kann, ist das Unternehmen verpflichtet, gemeinsam mit Arbeitnehmervertreter*innen – Betriebsrat oder Gewerkschaft – eine Entgeltbewertung durchzuführen und Abhilfemaßnahmen zu vereinbaren (Art. 10 EntgTranspRL).
55
Damit lassen sich aus der EntgTranspRL systematische Überprüfungen der Entgeltstrukturen und Maßnahmen zur Korrektur von geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden ableiten, sofern die Voraussetzungen aus Art. 10 Abs. 1 EntgTranspRL vorliegen. In Deutschland existieren (bis auf die Mitbestimmungstatbestände des BetrVG bzw. im Rahmen von Tarifverträgen) bisher keine verbindlichen Vorgaben zur Überprüfung und Korrektur der Entgeltstrukturen.
3. Striktere Sanktionen für Verstöße
56
Während Verstöße gegen das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland bislang kaum geahndet wurden, sieht die EU-Richtlinie spürbare Bußgelder und Sanktionen vor. Nach Art. 23 der Richtlinie sind für Verstöße wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorzusehen, darunter Geldbußen. Arbeitgebern, die gegen die neuen Vorschriften verstoßen, drohen zudem künftig nicht nur Geldstrafen, sondern auch der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.
4. Beweislastumkehr bei Lohnklagen
57
Eine wesentliche Neuerung der EU-Richtlinie ist die Einführung einer Beweislastumkehr: In Streitfällen müssen Unternehmen künftig nachweisen, dass es keine geschlechtsspezifische Diskriminierung gegeben hat – nicht mehr der Arbeitnehmer. Dieses Prinzip wird erhebliche Auswirkungen auf das Arbeitsrecht in Deutschland haben und Arbeitgeber anhalten, ihre Gehaltsentscheidungen zu dokumentieren. Denn ohne nachvollziehbare Dokumentation wird der Nachweis prozessual nicht (mehr) gelingen können.
5. Stärkere Einbindung von Betriebsräten und Gewerkschaften
58
Die EU-Richtlinie sieht vor, dass Arbeitnehmervertretungen stärker in die Überprüfung und Analyse von Gehaltsstrukturen eingebunden werden. In Deutschland haben Betriebsräte bei Entgeltfragen Mitbestimmungsrechte (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 Betriebsverfassungsgesetz). Die Richtlinie stärkt ihre Position im Vergütungskontext. Vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2023 (nur) noch 7% der Betriebe einen Betriebsrat hatten, dürfte die EntgTranspRL eine Trendwende bringen. Denn nur mit Betriebsrat können sehr zügig flächendeckend Entgeltstrukturen eingeführt werden, ohne jeden einzelnen Arbeitsvertrag zu ändern. Das bedeutet, dass kollektivrechtliche Vertretungsstrukturen wieder an Attraktivität – weil es dann einen Verhandlungspartner und nicht 500 verschiedene gibt gewinnen werden.
59
Aktuelle Pflichten (Entgelttransparenzgesetz, EntgTranspG)
Zukünftige Pflichten nach Umsetzung der EU-Richtlinie 2023/970 (bis spätestens 7. Juni 2026)
Individueller Auskunftsanspruch(§§ 10–16 EntgTranspG)
Unternehmen ab 200 Beschäftigten
Anspruch alle 2 Jahre
Beschränkung des Vergleichs auf „bis zu zwei“ Entgeltkomponenten
Beschränkung bzgl. Mindestgröße der Vergleichsgruppe
NEU: Erweiterter Auskunftsanspruch
Gilt für alle Beschäftigten, unabhängig von Unternehmensgröße – d.h. die bisherige Größenbegrenzung entfällt künftig!
Richtlinie kennt weder ein Zweijahres-Intervall noch eine Begrenzung der Entgeltbestandteile.
Arbeitgeber müssen innerhalb von zwei Monaten individuelle Vergütungsdaten und geschlechtsspezifische Entgeltdaten vergleichbarer Tätigkeiten mitteilen.
Betriebliche Prüfverfahren (§§ 17–20 EntgTranspG)
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten
Freiwillige regelmäßige Überprüfung der Entgeltstrukturen auf geschlechtsspezifische Benachteiligungen
Verpflichtende Berichte zu Entgelt-/Vergütungsstrukturen
Unternehmen ab 250 Beschäftigten: jährlich
Unternehmen zwischen 150 und 249 Beschäftigten: alle drei Jahre
Unternehmen zwischen 100 und 149 Beschäftigten: alle drei Jahre, erstmals bis 2031
NEU: Ggf. gemeinsame Entgeltbewertung
Unternehmen mit geschlechtsspezifischem Entgeltgefälle ab 5%
Unter bestimmten Voraussetzungen: Verpflichtende Entgeltbewertung gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung zur Ermittlung und Beseitigung der Ursachen.
Berichtspflicht (§§ 21–22 Entg-TranspG)
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, die lageberichtspflichtig nach HGB sind.
Regelmäßiger Bericht zu Gleichstellung und Entgeltgleichheit
–
NEU: Transparenz bei Stellenausschreibungen
Verpflichtende Angabe des Einstiegsgehalts oder einer Gehaltsspanne
Verbot der Abfrage des bisherigen Gehalts von Bewerbenden
D. Bedeutung für das HR-Personalmanagement
60
Die Umsetzung der EntgTranspRL wird nicht von heute auf morgen gelingen, da die Vorgaben der EntgTranspRL nicht ohne weiteres umzusetzen sind: Denn selbst der vorstehende Überblick verdeutlicht, was auf Unternehmen und HR-Personalmanagement zukommt: Gefordert werden Entgeltstrukturen, die objektiv, geschlechtsneutral und mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarte Kriterien enthalten, sodass beurteilt werden kann, ob sich die Arbeitnehmer im Hinblick auf den Wert der Arbeit in einer vergleichbaren Situation befinden. Das bedeutet: Es müssen nicht nur solche Kriterien aufgestellt, sondern auch mit den Betriebsräten vereinbart werden. Diese Kriterien dürfen weder in unmittelbarem noch in mittelbarem Zusammenhang mit dem Geschlecht stehen und umfassen Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls etwaige weitere Faktoren, die für den konkreten Arbeitsplatz oder die konkrete Position relevant sind. Hierbei soll jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen werden.
I. Überblick über die künftigen Aufgaben für HR-Abteilungen
61
Die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie bringt eine Menge an neuen Aufgaben für das HR-Personalmanagement mit sich. Personalabteilungen spielen eine zentrale Rolle bei der Anpassung und Implementierung der neuen Anforderungen. Folgende Aspekte sind besonders relevant:
1. Überprüfung und Anpassung der Vergütungssysteme
62





























