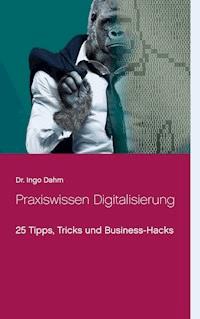
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Immer noch haben Unternehmen Schwierigkeiten, echte digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Mit einer gefährlichen Mischung aus Anpassung, Aussitzen und halbgaren Experimenten sollen bislang erfolgreiche Firmen in die digitale Zukunft geführt werden. Diese Transformation wird scheitern, denn in vielen Unternehmen hat sich das Management die vier Todfeinde der Digitalisierung ins Haus geholt: Angst vor Veränderung, Misstrauen gegenüber Neuem, ein Tagesgeschäft, das Strategie und Vision erdrückt und eine Investitionen fressende Profitgier. So wird Innovation wirkungsvoll unterbunden! Mit kurzweiligen Anekdoten werden Grundlagen und Zusammenhänge rund um die digitale Transformation leicht verständlich und unterhaltsam erklärt. 25 Kapitel mit praktischen Tipps und leicht nachvollziehbare Handlungsempfehlungen helfen, die notwendigen Schritte selbständig zu erkennen und den Wandel erfolgreich zu meistern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle, die die Welt ein bisschen digitaler machen wollen.
Inhalt
Digitalisierung
Wie funktioniert Innovation?
Die Reiter der digitalen Apokalypse
Die vier Todfeinde der Digitalisierung
Die digitale Revolution frisst Ihre Kinder
Warum Geld an Bedeutung verliert
Gute Nacht, Chief Digital Officer!
Marketing & Vertrieb voll digital
Vertrieb boosten... aber wie?
Was kommt nach Content Marketing?
AdTech Irrsinn und Daten-Schmu
Gefahren durch Amazon & Co.
Ist Pokémon das neue Facebook?
Daten, das Öl des Informationszeitalters
Big Data - Big Bullshit
Wie viel sind meine Daten wert?
Wie viel ist ein Gigabyte Daten wert?
5 Tipps um Datenschätze zu bergen
Sind das Daten oder kann das weg?
Die Kunst, Daten intelligent auszuwerten
Gute Gründe, auf KI zu verzichten
In 48 Stunden zum Data Scientist
Drei Mythen, die Talente fern halten
Künstliche Intelligenz - echte Gefahr?
Wie verändere ich meine Organisation?
Todsünden im Projektmanagement
Change Management: 4 effektive Hacks
Ultimativ bestes Projektmanagement
Sind Affen bessere Changemanager?
Was wir von Rittern lernen können
Literaturverzeichnis
Schlusswort
Digitalisierung
Die Welt ist komplex und vernetzt. Die Geschwindigkeit des Wandels nimmt aufgrund ausgefeilter Technologien drastisch zu, Ansprüche der Konsumenten wachsen und bislang turmhohe Markteintrittsbarrieren fallen wie Kartenhäuser in sich zusammen. Viele Unternehmer haben verstanden, dass mit herkömmlichen Methoden, also einer inkrementellen, schrittweisen Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen, das Geschäft dauerhaft in Schieflage geraten, vielleicht sogar untergehen wird.
Gesucht werden nun neue Methoden, um schneller auf den Wandel von geschäftskritischen Rahmenbedingungen wie Kundenbedürfnisse, Technologiewandel sowie Gesetz und regulatorische Anforderungen zu reagieren. Ändern sich zwei oder drei dieser Störfaktoren gleichzeitig, dann wird es sehr schwer, diesen Wandel mit konventionellen Mitteln erfolgreich zu meistern.
Die Fähigkeit zu schneller Innovation ist gefragt.
Wie funktioniert Innovation?
Wie Innovation geschieht, ist den meisten von uns anschaulich klar: Völlig durchgeknallte Wissenschaftler experimentieren in Geheimlaboren mit viel Farbe, Rauch und Knallgas, um Heilmittel gegen Alien-Killerviren zu entdecken und die kalte Fusion zur Serienreife zu bringen. Mit der Wirklichkeit hat das (leider) wenig zu tun.
Stattdessen folgt Innovationsmanagement einem genial einfachen Plan: der Darwin'schen Evolutionstheorie: Mutation, Rekombination, Selektion - das sind ihre drei Grundprinzipien [1]. Zwar gibt es dann noch ein paar Einschränkungen, aber im Grunde ist es schon alles.
Innovation und Darwin'sche Evolution folgen dem gleichen Plan.
Angenommen, es wird eine Erfindung gesucht, die super-weiße Zähne macht. Da fallen uns im ersten Schritt drei Ideen ein: Lackieren, Bleichen, Polieren. Keine dieser Lösungen ist gut genug, es auf Anhieb in die Verkaufs-Charts zu schaffen. Also kombinieren wir die Ideen aller Kollegen miteinander und haben drei weitere Ansätze: „Lackieren und Bleichen“, „Bleichen und Polieren“ sowie „Lackieren und Polieren“. Diesen Vorgang nennt man die Rekombination.
Die letzte Idee funktioniert leider nicht, denn der Lack wird durch das Polieren sofort wieder abgetragen. Die Idee kommt auf den Müll, sie ist aussortiert; man spricht von der Selektion.
Das dritte Prinzip - die Mutation - bedeutet, dass die verbleibenden Varianten mit kleinen Veränderungen erneut ins Rennen geschickt werden: eine andere Sorte Lack, eine mildere Bleiche, eine feinere Poliermethode.
Danach geht es weiter mit dem Karussell aus Selektion, Kombination und Mutation.
Im Unterschied zur Natur haben Erfinder im Labor a) relativ wenig Zeit und b) vergleichsweise wenige parallel durchdenkbare Alternativen. Diese Anzahl gleichzeitig untersuchter Varianten nennt man Populationsgröße. Dass die Populationsgröße in aller Regel beschränkt ist, liegt typischerweise am begrenzten Budget der Entwicklungsabteilung.
Finanzstarke, große Unternehmen wählen Innovationsstrategien mit vielen parallel untersuchten Varianten. Die hohen Kosten werden mit kontrollierbar hoher Entwicklungsgeschwindigkeit belohnt. Kleine Firmen arbeiten aus Ressource-Gründen anders und mutieren ihre Ideen stärker, aggressiver um die preiswertere, geringe Populationsgröße zu kompensieren.
Da bei dieser Vorgehensweise die Entwicklungskosten eher gering ausfallen, ist ein (seltener) Volltreffer ist dann umso lukrativer, das Forschungsrisiko hingegen relativ hoch.
Im Geschäftsleben gelten also ähnliche Gesetze wie in der Natur: Nicht etwa die Größten oder die Stärksten werden überleben, sondern die Unternehmen mit der besten Anpassungsfähigkeit, der höchsten Agilität.
Technologie ist daher nicht eine Lösung, sondern Werkzeug. Der aktuelle Wandel bringt viele Implikationen mit sich – es geht nicht etwa darum, Aufgaben an Computer, Smartphone oder andere intelligente Geräte zu übertragen. Der Charme der Digitalisierung liegt darin, dass durch sie bisher nur schwer einschätzbare Prozesse messbar werden. Und genau das kann und wird unsere Geschäfte verbessern.
Dazu müssen Unternehmer bestehende Konzepte über Bord werfen und sich mutige auf Neues einlassen.
Aber das ist schwer.
Die Reiter der digitalen Apokalypse
In jüngster Zeit herrscht Untergangsstimmung. Das nervt, ist aber nicht zu ändern. Perception is reality. Die digitale Welle rollt und wird uns alle in die Untiefen des Internets ziehen. Oder vielleicht spült sie uns ins #Neuland [2]. Es komme was wolle, die vier Reiter der Apokalypse [3]- die vier Antihelden der digitalen Transformation sind bereits da! Die Reiter stehen (im Bild von links nach rechts) für Krieg, Hunger, Furcht und Gerechtigkeit. Und sie symbolisieren gleichermaßen die vier Ursachen für den Untergang des analogen Abendlandes:
Der Wettbewerbsdruck hat sich massiv verschärft, ist internationaler geworden, Markteintrittsbarrieren bröckeln, Zölle schwinden, Sprache und Kultur stellen längst keine Schranken mehr dar und die Logistik ist als Service verfügbar. So manchen Unternehmen fühlt sich bedrängt. Die Metapher hierfür: Krieg.
Fehlende Investitionen in Innovation und Produktentwicklung sind Ursache für ein ausgemergeltes Produktportfolio mit dürftigen Umsätzen und mageren Margen. Die knappen Deckungsbeiträge reichen kaum aus, das Unternehmen zu ernähren, geschweige denn um bitter nötige Investitionen zu tätigen. Um im Bild zu bleiben: Solch ein Unternehmen leidet Hunger.
Angst statt Inspiration: Ich kenne einige Produktmanager, die wie ein Kaninchen vor der Schlange den TechCrunch Newsfeed verfolgen nur um interne Checklisten pflegen: „Können wir nicht, können wir nicht, werden wir niemals können.“
Auf dem C-Level sieht es oft gar nicht besser aus: „Haben wir schon immer so gemacht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht.“ Die Furcht hat Einzug gehalten.
Gelingt es nicht, diese drei Übel strategisch aus dem eigenen Unternehmen auszusperren, so wird man die Macht des vierten Reiters spüren: Gerechtigkeit. Märkte und Kunden kennen da keine große Gnade. Sie setzen ihre Ansprüche durch - notfalls bei einem anderen Anbieter, auf Dauer auch bei einem Mitbewerber, den es bei der eigenen Firmengründung noch gar nicht gab, oder gar bei einem, der vorgestern noch ein ganz anderes Kerngeschäft hatte.
So einfach Roß und Reiter zu benennen sind, so einfach sind sie auszusperren
Die folgenden drei Methoden können ihnen helfen, die apokalyptischen Reiter auszusperren:
Mut und Vertrauen.
Angst zeigt sich in Organisationen in diversen Formen. Sie beginnt beim Kontrollwahn der ersten Führungsebene und endet bei Narzismus und Ignoranz im C-Level. Erfolgreiche Unternehmen leben flache Hirarchien, steuern mutig auf neue Märkte zu und erfinden sich so immer wieder selbst. Angst ist der größte Hemmschuh. Werfen sie ihn über Board!
Innovation, Innovation, Innovation.
Ursache für die Notwendigkeit digitaler Transformation ist meist ein verludertes Innovationsmanagement. Unternehmen jedoch, die Innovation als strategische Kernkompetenz begreifen, haben in der Regel keinen Bedarf an Digitalisierung - sie sind es Branchenführer. Wer das nicht glaubt sollte mal im Valley den Bedarf für Digitalisierung erfragen.
Inspiration durch Wettbewerb
Betrachten Sie die Konkurrenz nicht als Feind, sondern als Unterstützer, neue Märkte zu erschließen. Jeder Player, der den Nutzen eines neuen Produktes in einem neuen Markt erläutert ist ein Türöffner. Jedes Startup das ihr Kerngeschäft durch innovative Ideen bedroht stiftet ihren Kunden nutzen. Und Kundennutzen - das ist doch genau das, was sie wollen! Konzentrieren sie sich auf die Frage, wie sie diesen Rückenwind nutzen anstatt darüber zu grübeln, wie sie dem Wettbewerb den Wind aus den Segeln nehmen.
Gerechtigkeit kommt so oder so
Jedenfalls in dem Sinne, das ihr Kunde genau das Produkt oder den Service aussuchen wird, das ihm den größten Nutzen verspricht. Es liegt an Ihnen, ob er das Optimum bei Ihnen findet - oder beim digitalen Wettbewerb.
Kurzum: Es gibt keine Alternative zum Digitalisieren. Ebenso wenig war das Festhalten an der Kutsche eine Alternative zum Automobil. Sicher, auch heute werden Kutschen verkauft und es gibt immer noch einen Markt für ausgebildete Hufschmiede – aber im realen Leben geht der Anteil von Pferdefuhrwerken im Vergleich zu Benzinkutschen ganz klar im Rauschen unter.
Es liegt also auf der Hand, dass Digitalisierung erfolgen muss, viele Unternehmer, Führungskräfte und Experten stimmen hier zu. Und trotzdem scheitern viele große Projekte.
Woran liegt das?
Die vier Todfeinde der Digitalisierung
Immer noch haben Unternehmen der Prä-Internet-Ära Schwierigkeiten, echte digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Statt disruptiver Veränderung versuchen sie ihr Unternehmen mit einer Mischung aus Anpassung (aka „Evolution statt Revolution“), Aussitzen oder halbgaren Experimenten in die Gegenwart zu bringen. Digitalisierung geschieht letztlich nur halbherzig, denn das Management hat nur zu oft die vier Todfeinde der Digitalisierung im Haus:
Angst erzeugt massive Widerstände
Der größte Feind der Innovation ist die Angst. Viele Unternehmenslenker fürchten nicht steuerbare Kanibalisierung, schrumpfende Margen und generell den Verlust von Kontrolle. Dabei täten sie gut daran, sich lieber heute als morgen mit Innovationen anzufreunden. „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, lautet ein altes deutsches Sprichwort. Schrumpfen erst einmal die Marktanteile, weil Kunden zum digitalen Innovationsführer wechseln, wird es weit schwerer (und teurer!), diese Kunden wieder zurück zu gewinnen als wenn vorübergehend sinkende Profite mit dem Ziel der Eroberung neuer Märkte in Angriff genommen werden.
Gier frisst Innovation
Ich will an dieser Stelle nicht über Unternehmen mit einer stets auf Sparflamme kochenden R&D Abteilung sprechen. Dieser aus meiner Sicht in aller Regel völlig fehlerhafte Sparansatz wird noch übertroffen von einem wesentlich größerem Problem: der Annahme, man könne noch ein wenig länger die Cashcow melken und sich später um Innovation bemühen. Dies funktioniert eventuell in Unternehmen mit großen Produktportfolios. Dort jedoch, wo eine Abhängigkeit von einem Kernprodukt entstanden ist, muss dieser Ansatz zum Scheitern verurteilt sein. Jedes Quartal, das ungenutzt verstreicht ist Wasser auf die Mühlen des Wettbewerbs.
Misstrauenskultur verschleiert Fehler und verjagt Talent





























