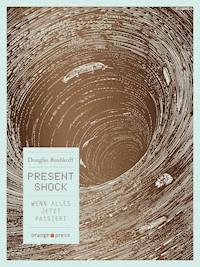
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: orange-press
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Maschinen, die für uns arbeiten, damit wir mehr Zeit für uns haben! Was einmal wie ein Traum vom Paradies klang, hat eher albtraumhafte Züge angenommen. Statt auf dem Rücken liegend den Vogelflug zu bewundern, sind wir Sklaven von Email, Twitter und Facebook geworden. Wir sehen von allem zu viel und doch nie das richtige, da zuviele Welten gleichzeitig um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Diagnose: Present Shock. Douglas Rushkoff fasst in Worte, was wir alle erleben, aber kaum einordnen können. Seine kritische Bestandsaufnahme als Medientheoretiker und als Betroffener erklärt, wodurch wir den Augenblick verloren haben. Er eröffnet eine Perspektive auf das Leben im digitalen Zeitalter, die uns das gewaltige Ausmaß des Umbruchs vor Augen führt - und uns auf geradezu kathartische Art und Weise damit versöhnt. »Wir wissen zwar nicht mehr, wo es langgeht, aber wir kommen viel schneller voran.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Douglas Rushkoff
Present ShockWenn alles jetzt passiert
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder und Andy Hahnemann
Douglas Rushkoff
PRESENTSHOCK
WENNALLESJETZTPASSIERT
Douglas Rushkoff: Present Shock. Wenn alles jetzt passiert.
Übersetzt von Andy Hahnemann und Gesine Schröder.
Freiburg: orange-press 2014
© 2013 by Douglas Rushkoff. All rights reserved.Titel der Originalausgabe: Present Shock. When Everything Happens Now.© für die deutsche Ausgabe 2014 bei orange pressAlle Rechte vorbehalten.
Gestaltung: Katharina Gabelmeier, unter Verwendung der Illustration von Harry Clarke zu Edgar Alan Poes Erzählung »A Descent into the Maelström« (1919)Lektorat: Undine Löhfelm, Torben PahlKorrektorat: Birgitta Höpken
Im Text angegebene URLs verweisen auf Websites im Internet.Der Verlag ist nicht verantwortlich für die dort verfügbaren Inhalte,auch nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen.
ISBN: 978-3-936086-75-1 | www.orange-press.com
Für meine Tochter Mamie, meine Gegenwart
Inhalt
Vorwort
1 | Narrativer Kollaps
2 | Digiphrenie
3 | Überspanntheit
4 | Fraktalnoia
5 | Apokalypsie
Dank
Literaturnachweis
Auswahlbibliografie
Stichwortregister
Über das Buch
Der Autor
Weitere Titel bei orange-press
Vorwort
Er ist einer der wachsamsten Hedgefonds-Manager der Wall Street, und doch scheint er mit seinen Transaktionen immer zu spät zu kommen. Händler größerer Firmen mit schnelleren Computern bemerken sofort, wenn er eine Order platziert, und nehmen diese vorweg. Der Kurs steigt dadurch um den Bruchteil eines Cents, was sein Geschäft weniger rentabel macht als gedacht. Er agiert in der Vergangenheit, weil ihm Software und Rechenleistung fehlen, um zur Gegenwart aufzuschließen. Und seine Kunden halten sowieso nichts mehr davon, in die Zukunft von Unternehmen zu investieren; sie wollen am Handel selbst verdienen, und zwar sofort.
Sie sitzt in einer Bar in der Upper East Side von Manhattan, scheint sich aber weder für die Leute drumherum noch die Musik zu interessieren. Statt mit jemandem zu reden, scrollt sie durch Textnachrichten von Freundinnen, die an einem anderen Ort feiern – schließlich muss sie entscheiden, ob sie hierbleiben oder ob anderswo etwas Besseres geboten wird. Tatsächlich weckt etwas auf dem Bildschirm ihres Smartphones ihr Interesse, und Sekunden später ist sie mit ihrer Clique im Taxi Richtung East Village unterwegs. Sie betritt eine zweite, fast identische Bar und beschließt, das hier sei the place to be – aber statt die Party zu genießen, macht sie eine Stunde lang mit ihrem Handy Fotos von sich und ihren Freundinnen, die sie sofort hochlädt, damit die ganze Welt sie sehen kann.
Er sieht die Zeichen überall: eine neue »Naturkatastrophe« in den Abendnachrichten, die Schwankungen der Benzinpreise, Diskussionen um eine einheitliche Weltwährung. Die Flut der Informationen bedeutet nicht, dass mehr passiert. Aber mehr von dem, was passiert, dringt zu uns durch. Prophezeiungen scheinen nicht mehr die Zukunft zu beschreiben, sondern einen Leitfaden für die Gegenwart darzustellen. Ob man der Quantenphysik vertraut oder dem Maya-Kalender: Das Ende aller Zeiten steht ohnehin bald bevor. Wir müssen uns nicht mehr auf das messianische Zeitalter vorbereiten; wir sind schon mittendrin.
Das ist das neue »Jetzt«.
Unsere Gesellschaft konzentriert sich auf den gegenwärtigen Moment. Wir erleben alles im Liveticker, in Echtzeit, always-on.
Auch wenn neue Technologien und ein veränderter Lebensstil dafür gesorgt haben, dass wir alles immer schneller tun: Es geht nicht nur um Beschleunigung. Es geht um den Bedeutungsverlust von allem, was nicht gegenwärtig ist – weil der Ansturm von allem, was genau jetzt passiert, so gewaltig ist.
Es geht darum, dass sich die weltweit führende Suchmaschine zu einem in Echtzeit generierten Datenstrom namens Google Now weiterentwickelt, der sich ungefragt individuell anpasst und unsere Bedürfnisse antizipiert; darum, dass die Sofortnachricht die E-Mail verdrängt und Twitter-Feeds die Blogs ablösen. Es geht um die Frage, warum Schüler keiner linearen Argumentation mehr folgen können, warum Reality-TV einen so großen Platz im Fernsehen einnimmt und wir uns schon über Bücher und Platten aus dem letzten Monat kaum noch sinnvoll unterhalten können; geschweige denn über globale Probleme, die uns noch langfristig beschäftigen werden. Es geht um eine Finanzwirtschaft, die Unternehmern nicht mehr das nötige Kapital für ihre Investitionen zur Verfügung stellen kann. Und es geht um die Sehnsucht nach der »Singularität«, nach irgendeiner Form von Apokalypse, in der das lineare Zeiterlebnis abgelöst wird durch eine posthistorische, ewige Gegenwart, zur Not auf Kosten der menschlichen Freiheit oder der Zivilisation als Ganzes.
Das neue Jetzt bedeutet aber auch, dass wir erfahren, was auf den Straßen von Teheran, Istanbul und Kiew passiert, bevor CNN ein Kamerateam zusammenstellen kann. Es bedeutet, dass ein erfolgreicher Manager den Traum, mit seiner Familie nach Vermont zu ziehen und Kajaks zu produzieren, nicht auf den Ruhestand verschiebt, sondern jetzt verwirklicht. Es bedeutet, dass Millionen Menschen mit neuen Formen von Aktivismus experimentieren können, bei denen Konsens mehr gilt und mehr bewirkt als die Durchsetzungsfähigkeit eines Einzelnen. Es bedeutet, dass Firmen wie H&M oder Zara Überproduktion vermeiden können, indem sie quasi on demand produzieren: Sie reagieren fast in Echtzeit auf die Daten eines Etiketts, das in fünftausend Meilen Entfernung über den Kassenscanner läuft. Es bedeutet, dass ein Präsidentschaftskandidat die Wahl gewinnen kann, der weder die glorreiche Vergangenheit noch die drohende Zukunft ins Feld führt, sondern seinen Wählern zuruft: »Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.«
Tja, das Warten hat ein Ende. Wir sind da.
So wie das Ende des 20. Jahrhunderts vom Futurismus geprägt war, steht das beginnende 21. im Zeichen des Präsentismus.
Der Blick nach vorn, der in den späten 1990ern so verbreitet war, hatte sich mit dem Beginn des neuen Jahrtausends erledigt. Wie einige andere prophezeite auch ich damals ein gesteigertes Gegenwartsbewusstsein, ein Interesse an echten Erfahrungen und dem Wert der Dinge im Augenblick. Dann kam 9/11 und verstärkte diese Tendenz noch. Der Terror zwang Amerika dazu, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Die Menschen zeugten reihenweise Kinder1 oder reichten die Scheidung ein2, weil sie – zumindest unbewusst – spürten, dass wir nicht ewig leben, und weniger bereit waren, Entscheidungen immer weiter aufzuschieben. Wenn dann noch die Echtzeittechnologien von Smartphone bis Twitter dazukommen, permanentes Multitasking, kurzlebige Konsumkreisläufe und eine Wirtschaft, die darauf basiert, dass wir jetzt mehr ausgeben, als wir im ganzen Leben verdienen werden, dann kann man schon mal die Orientierung verlieren. Die Ausgangslage ist vergleichbar mit der, die der Futurologe Alvin Toffler in den 1960er-Jahren als »Zukunftsschock« bezeichnete.
Nur dass es heute ein Gegenwartsschock ist, den wir erleben. Und obwohl dieser ein Phänomen unserer unmittelbaren Gegenwart ist, hat er doch wenig mit Unmittelbarkeit und Gegenwärtigkeit zu tun.
Viele haben richtig vorausgesagt, wie dieser neue Präsentismus Investitionen und die Finanzwelt beeinflussen würde und wie sich Technologien und Medien weiterentwickeln müssten. Aber wir hatten keine Ahnung, was es für uns als Menschen bedeuten würde, im »Jetzt« zu leben. So hat uns unsere Konzentration auf die Gegenwart etwa von den großen Ideologien des 20. Jahrhunderts befreit. Niemand – na ja: fast niemand – lässt sich heute noch einreden, dass irgendwelche mythischen Zwecke alle Mittel heiligen. Arbeitnehmer und Konsumenten fallen nicht mehr so leicht auf die Loyalitätsrhetorik der Unternehmen herein. Aber der Wandel hat uns nicht dazu gebracht, genauer wahrzunehmen, was um uns herum vorgeht. Wir nähern uns keinem zenbuddhistischen Zustand der ewigen Gegenwart, in dem wir ganz mit uns selbst und unserer Umgebung eins werden und zu einer fundamentalen Erkenntnis unseres Selbst gelangen würden.
Stattdessen leben wir in einem Zustand ständiger Ablenkung, in dem wir das Unwichtige nicht mehr vom Wichtigen unterscheiden können. Unsere Fähigkeit, einen Entschluss zu fassen – geschweige denn ihm zu folgen –, leidet unter dem Bedürfnis, auf unzählige externe Impulse zu reagieren, die uns jeden Moment aus der Bahn werfen können. Wir sind im Hier und Jetzt nicht etwa sicher verankert, sondern reagieren nur noch auf den allgegenwärtigen Ansturm simultaner Impulse und Anforderungen.
In gewisser Weise entspricht das sogar dem, was die Entwickler unserer heutigen Rechner und Netzwerke erreichen wollten. Computer-Visionäre wie Vannevar Bush und J.C.R. Licklider träumten Mitte des 20. Jahrhunderts von Maschinen, die uns die Erinnerungsarbeit abnehmen würden. Sie sollten uns von der Last der Vergangenheit – und vom Schrecken des Zweiten Weltkriegs – befreien, indem sie es uns ermöglichten, uns ganz auf die Lösung gegenwärtiger Probleme zu konzentrieren und alles Zurückliegende zu vergessen. Die Informationen über die Vergangenheit sollten erhalten bleiben, aber außerhalb unseres Körpers, im Speicher der Maschine.
Und tatsächlich ist es ihnen gelungen, die Gegenwart von der Bürde der Erinnerung zu befreien, ohne diese zu verlieren. Wir können jetzt sozusagen mehr Rechenkapazitäten unseres Gehirns auf das RAM verwenden, den Prozessor, statt nur unsere zerebralen Festplatten ordentlich zu befüllen. Aber wir laufen Gefahr, diesen kognitiven Überschuss an die Beschäftigung mit Trivialitäten zu verschwenden, anstatt uns mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, die auf uns zukommen.
Verhaltensökonomen nutzen die wachsende Kluft zwischen unserem kognitiven Zugriff auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Sie ermuntern uns, zukünftige Schulden als weniger wichtig zu erachten als gegenwärtige Kosten, und drängen uns zu finanziellen Entscheidungen, die eigentlich nicht in unserem Interesse liegen. Wo diese Kurzsichtigkeit auch das Bankwesen und die wirklich großen Budgets erfasst – etwa die der Federal Reserve oder der Europäischen Zentralbank –, tappen ganze Volkswirtschaften in dieselben logischen Fallen wie die einzelnen Darlehensnehmer und Kreditkartennutzer.
Wie wir unsere Entscheidungen treffen, beschäftigt eine ganze Reihe Neurowissenschaftler, meist im Auftrag von Konzernen, die auf gefügigere Angestellte und Konsumenten hoffen. Aber egal wie viele Probanden sie in ihre Kernspintomographen schieben: Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stehen immer die Gehirnbereiche, die bei kurzfristigen, impulsiven Entscheidungen aktiv werden, und nicht die, die für rationale Erwägungen zuständig sind. So werden letztere zunehmend in den Hintergrund gerückt, und wir werden damit ermutigt, uns ganz auf spontanes, instinktgesteuertes Verhalten zu verlassen – so als sei es der einzige Schlüssel. Diese Betonung des Augenblicks hilft den Neurotechnologen vermutlich, ihre Dienstleistungen an Konzerne zu verkaufen, aber in Wirklichkeit wird das menschliche Verhältnis zum Augenblick dadurch nicht angemessen dargestellt.
Obwohl ihr Arsenal an Forschungsmethoden wächst und zunehmend invasiver wird, kommen Marketingexperten und Meinungsforscher doch nie an den lebendigen Prozess heran, in dem die Wahl auf ein Produkt oder auf einen bestimmten Kandidaten fällt. Ihre Hochrechnungen basieren immer nachträglich darauf, was die Probanden gerade gekauft oder beschlossen haben. Das »Jetzt«, mit dem sie sich befassen, verrät ihnen nichts über Wünsche, Gründe und Kontexte. Sie versuchen, aus Entscheidungen, die bereits getroffen wurden, künftige Entscheidungen abzuleiten – und zu beeinflussen. Ihre Kampagnen gaukeln uns vor, dass wir im Augenblick leben, und spornen uns zu entsprechend impulsiven Verhaltensweisen an. In Wirklichkeit macht uns das nur empfänglicher für Manipulationen.
In Wirklichkeit gibt es dieses »Jetzt« gar nicht – jedenfalls nicht das Jetzt, von dem die Marketingexperten sprechen. Es liegt in seiner Natur, dass es nicht festgehalten werden kann, und eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. In dem Moment, wo das »Jetzt« wahrgenommen wird, ist es auch schon vorüber. Wie bei gesichtsgelähmten Botox-Junkies, die einer immer kleiner werdenden Schönheitsrendite nachjagen, nimmt uns gerade der Versuch, die Zeit anzuhalten und den Augenblick zu bewahren, unsere Fähigkeit, diesen Augenblick wirklich zu erleben.
Der Versuch, den flüchtigen Moment einzufangen, macht aus unserer Kultur ein einziges entropisches, statisches Rauschen. Erzählstrukturen und Ziele lösen sich auf, und was übrig bleibt, sind verzerrte Aufnahmen vom Echten und Unmittelbaren in Form von Tweets und Status-Updates. Was wir gerade im Augenblick tun, wird wichtiger als alles andere – mit verheerenden Folgen.
Denn dieser verzweifelte, narzisstische Zugriff auf die Zeit kann nicht gelingen. Welches »Jetzt« soll denn wichtiger sein – das von gerade eben oder das, in dem ich mich jetzt befinde?
In den folgenden Kapiteln untersuchen wir den Gegenwartsschock in verschiedenen Ausprägungen, auf unterschiedlichen Ebenen. Es wird darum gehen, wie wir Kulturgüter produzieren und erleben, wie wir unsere Geschäfte führen, unser Geld investieren, Politik machen, die Wissenschaften verstehen und uns die Welt erklären. Panikreaktionen auf den Gegenwartsschock werden ebenso betrachtet wie die erfolgreicheren Versuche, uns in der neuen Zeit zurechtzufinden.
Das Buch ist in fünf Abschnitte unterteilt, die sich jeweils einer charakteristischen Manifestation des Gegenwartsschocks widmen. »Narrativer Kollaps« stellt die Frage, wie sich Geschichten erzählen und Werte vermitteln lassen, wenn wir nicht mehr dazu kommen, einer linearen Handlung zu folgen. Die Popkultur kommt ohne traditionelle Plots aus – aber wie funktioniert Politik ohne Rückgriff auf die großen Erzählungen? In »Digiphrenie« befassen wir uns damit, dass es uns die Medien erlauben, an mehreren Orten gleichzeitig präsent zu sein, und was das für uns bedeutet. Wie jede andere Technologie davor prägt die Digitalität unser Zeitempfinden und stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. »Überspanntheit« steht für den Versuch, große Zeitskalen in viel kleinere hineinzupressen, also in einem einzigen Augenblick Wirkungen zu erzielen, die sich eigentlich erst über einen längeren Zeitraum entfalten. Wie verändert das die Geschäfts- und Finanzwelt, die zunehmend mit Derivaten operiert? Im darauf folgenden Kapitel sehen wir uns an, was passiert, wenn wir die Welt ausschließlich aus der Gegenwart heraus interpretieren. Den verzweifelten Versuch, willkürlich und in Echtzeit Zusammenhänge herstellen, ohne Einordnung von Ursache und Wirkung auf einer Zeitschiene, bezeichne ich als »Fraktalnoia«. Und zuletzt betrachten wir die Symptome von »Apokalypsie – der Sehnsucht nach einem Ende angesichts einer alles dominierenden, nicht enden wollenden Gegenwart. Wir begegnen auf der Forschungsreise zu den verschiedenen Erscheinungsformen des Gegenwartsschocks Drohnenpiloten, die eben noch Bomben in einem entfernten Kriegsgebiet abgeworfen haben und wenig später in ihrem Vorstadthäuschen am Abendbrottisch sitzen. Wir erfahren, wie sich der Aktienhandel mit ultraschnellen Algorithmen sogar auf die Architektur der Gebäude in Manhattan auswirkt und was die Digitalisierung des Börsengeschäfts für die menschlichen Händler bedeutet. Wir lernen »Preppers« kennen, die sich für den Weltuntergang bevorraten und gleichzeitig den Klimawandel für eine Verschwörungstheorie halten.3 Und bei all diesen Themen geht es um die Frage, wie wir mit den Veränderungen umgehen sollen, wo wir doch gar keine Zeit mehr haben, um über all das einmal gründlich nachzudenken.
Ich schlage vor, dass wir intervenieren – und zwar genau jetzt, in diesem Moment. Wenn sich alles unkontrollierbar beschleunigt, ist manchmal Geduld das Einzige, was hilft. Drückt auf Pause.
Wir haben Zeit.
1 | Narrativer Kollaps
Ich hatte mich auf das 21. Jahrhundert gefreut. In den 1990ern ging das den meisten so: Unser Blick ging nach vorn. Alles schien sich zu beschleunigen, die Rechengeschwindigkeit der Computer genauso wie das Wachstum der Märkte. Auf allen PowerPoint-Folien sah man die gleiche steile Aufwärtskurve, ob es nun um die Höhe des zu erwartenden Profits, die Anzahl der Computernutzer oder den CO2-Ausstoß ging – das Wachstum war exponentiell.
1965 hatte Intel-Mitgründer Gordon Moore das mooresche Gesetz formuliert, eine Faustregel für den technologischen Fortschritt, die besagte, dass sich die Rechnerleistung alle zwei Jahre verdoppeln würde. Aber nun schien sich auch alles andere im Handumdrehen zu verdoppeln: der Aktienindex, die Arztrechnung, die Internetgeschwindigkeit, die Anzahl der Kabelfernsehsender. Wir hatten uns nicht nur an einzelne Veränderungen zu gewöhnen, sondern an die wachsende Geschwindigkeit, mit der die Veränderungen auf uns zukamen. Wir erlitten, wie es der Zukunftsforscher Alvin Toffler nannte, einen Zukunftsschock.
Daraufhin traten wir die Flucht nach vorn an. Jeder und alles richtete sich auf die Zukunft aus. Nicht, weil wir uns auf etwas Bestimmtes freuten, sondern weil unser Blick ganz allgemein in die Zukunft ging. Trendforscher und »Cool Hunter«, die einen exklusiven Ausblick auf das nächste große Ding versprachen, gehörten zu den bestbezahlten Beratern überhaupt. Optimistische Bücher über Die Zukunft des … füllten die Regale der Buchläden und wurden später von Titeln à la Das Ende der … abgelöst. Worum es jeweils ging, spielte eigentlich keine Rolle; es zählte nur, dass sie eine Zukunft hatten oder – und das war fast noch beruhigender – dass sie eben keine hatten.
Wir alle waren Zukunftsforscher, angetrieben von neuen Technologien, neuen Theorien, neuen Geschäftsmodellen und Denkansätzen, die nicht einfach nur mehr versprachen, sondern etwas völlig anderes: eine Verschiebung mit unbekannter Stoßrichtung und von noch nie da gewesenem Ausmaß. Mit jedem Jahr, das verging, zog es uns stärker zu einer Art »chaotischem Attraktor« hin, und je näher wir kamen, desto schneller schien die Zeit abzulaufen. Schließlich befanden wir uns in den letzten Jahren des letzten Jahrzehnts des letzten Jahrhunderts vor der Jahrtausendwende. Der unaufhaltsame, vom Internet verstärkte Boom der 1990er-Jahre war von genau diesem Blick nach vorne geprägt, von der Sehnsucht nach dem erlösenden Abschluss, dem ultimativen Wechsel ins nächste Jahrtausend.
Pedanten zählten das Jahr 2000 noch zum 20. Jahrhundert, doch uns galt es als Beginn eines neuen Zeitalters. Wir fieberten der Veränderung entgegen wie gläubige Millenaristen der Wiederkunft Christi. Die meisten erwarteten den Umbruch allerdings eher in der säkularen Gestalt des millenium bug: Computersysteme, die das Jahr in zwei Ziffern codierten, drohten am Übergang zur doppelten Null zu scheitern. Aufzüge würden stecken bleiben, Flugzeuge vom Himmel fallen, Kernkraftwerke eine Kernschmelze erleben – es wäre das Ende der Welt, wie wir sie kannten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























