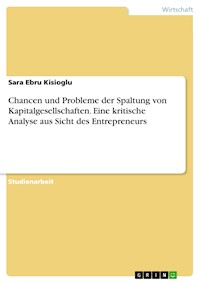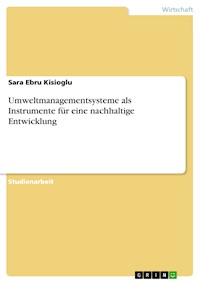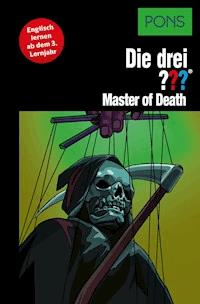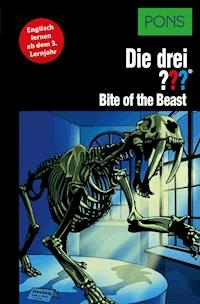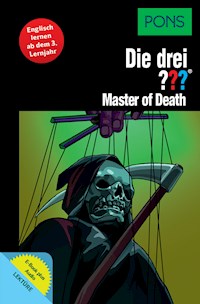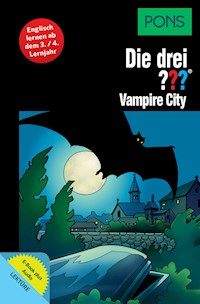29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medienökonomie, -management, Note: 1,3, Bergische Universität Wuppertal (Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Verlage sind Wirtschaftsunternehmen und versuchen mit ihren Produkten die Bedürfnisse der Unterhaltung oder der Information zu decken. Die Herstellung von Printprodukten ist ein komplexer Prozess, bei welchem verschiedene Informations- und Materialströme im Fertigungsprozess zusammenfließen. Die Printprodukte erreichen den Käufer über verschiedene Vertriebswege. Wenn man die Entwicklung ausgehend von der Erfindung des Buchdrucks 1450 bis hin zur Schwelle des Multimedia-Zeitalters im Jahr 2000 betrachtet, so kann man eine zunehmende Dynamik in den letzten Jahrzehnten erkennen. Mehr als 400 Jahre liegen zwischen der Erfindung des Buchdrucks und dem ersten Telefon. Hingegen brauchte es für die Weiterentwicklung der Technologie vom Radio zum Fernsehen nur 34 Jahre. Diese Technologien decken parallel zum Printprodukt einen weiteren Teil der von Verlagen befriedigten Kundenbedürfnisse ab. Rundfunknachrichten informieren und Hörspiele sowie Musik unterhalten den Kunden. Das Senden von Nachrichten um den Globus sowie die universelle Verfügbarkeit von Informationen ist, bedingt durch das Internet, gegenwärtig für viele selbstverständlich geworden. Der Trend geht dahin, dass die Entwicklungszyklen kürzer und daher innovative Produkte schneller auf den Markt gebracht werden, wobei die Entwicklungsdynamik immer weiter zunimmt. Auch in anderen Branchen kann man die Folgen der Innovationsschübe nachzeichnen: So dient die Kutsche nicht mehr als Fortbewegungsmittel und wurde völlig vom Automobil abgelöst. Ebenso hat die Schreibmaschine ausgedient und der Computer ihren Platz übernommen. Im Gegensatz dazu koexistieren die ’neuen’ Medien Rundfunk und Fernsehen und das ’alte’ Printmedium Buch, sie ergänzen einander oder überschneiden sich in ihrer Wirkung.1 Die Weiterentwicklung des Computers und immer weitere neue Anwendungsmöglichkeiten haben eine Synthese dieser drei Medien ermöglicht: Multimedia. Buchverlage, auf die in dieser Arbeit exemplarisch abgestellt wird, stehen vor Herausforderungen, die in erster Linie durch Innovationen hervorgerufen werden. Diese Veränderungen betreffen nicht nur die Marktseite im Verlag, sondern auch die Ressourcenseite.2 Innovationen und neue Markttrends verändern somit die Strukturen von Printunternehmen. Die Veränderung der Geschäftsfeldplanungen können unter den Stichworten Multimedia, Internet, Crossmedia, eBusiness u. a. subsumiert werden. 1 Vgl. Strumpe (1998), S. 63 ff. 2 Vgl. Kogeler/Müffelmann (1999), S. 220 ff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Zielsetzung der Arbeit
2 Innovationen
2.1 Definition von Innovation
2.2 Kriterien zur Differenzierung von Innovationen
2.2.1 Auslöser für Innovationen
2.2.2 Differenzierung nach dem Neuheitsgrad
2.2.3 Differenzierung nach dem Veränderungsumfang
2.3 Innovationsziel
2.3.1 Das „Magische Zieldreieck“
2.3.2 Qualität und Kundennutzen
2.3.3 Kostensenkung
2.3.4 Zeitverkürzung
2.4 Gegenstand von Innovationen
2.4.1 Produktinnovation
2.4.2 Prozessinnovation
2.4.3 Soziale und organisatorische Innovation
2.5 Innovationsprozess
2.6 Innovationsmanagement
3 Verlagswesen
3.1 Definitorische Eingrenzung des Verlagswesens und der Aufgaben eines Verlags
3.2 Verlagstypen
3.2.1 Special Interest Verlag
3.2.2 Zielgruppen-Verlag
3.2.3 Publikumsverlag
3.3 Charakteristika des Buches und des Buchmarktes
3.3.1 Definition und Erscheinungsformen des Mediums Buch
3.3.2 Der Buchmarkt
3.3.3 Kostenstruktur im Buchmarkt
3.4 Klassische Wertschöpfungskette im Buchverlag
3.4.1 Information
3.4.2 Herstellung
3.4.3 Absatz
4 Print unter Druck
4.1 Innovationen im Buchverlag
4.1.1 Produktinnovation
4.1.2 Prozessinnovation
4.1.2.2.2 Book on Demand (BoD)
4.2 Veränderungen der Wertschöpfungskette im innovativen Buchverlag
4.2.1 Information
4.2.2 Herstellung
4.2.3 Absatz
5 Schlussbetrachtung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1-1: Von Gutenberg zu Bits und Bytes (eigene Darstellung in Anlehnung an Kogeler/ Müffelmann (1999), S.222)
Abbildung 2-2: Magisches Zieldreieck (eigene Darstellung in Anlehnung an Pleschak/ Sabisch (1996), S. 9)
Abbildung 3-3: Klassische Verlagsprodukte (eigene Darstellung in Anlehnung an Strumpe (1998), S. 70)
Abbildung 3-4: Produktformen im Buchbereich (eigene Darstellung in Anlehnung an Wirtz (2001), S. 184)
Abbildung 3-5: Entwicklung Buchmarkt Deutschland (eigene Darstellung in Anlehnung an Bahlmann (2002), S. 13.)
Abbildung 3-6: Beispiel der Kostenstruktur für Bücher (typisches S/W- Buch mit Festeinband, Auflage 5000, 380 Seiten, Umschlag, A5) (eigene Darstellung in Anlehnung an Hübler (2000), S. 197)
Abbildung 3-7: Klassische Wertschöpfungskette (eigene Darstellung)
Abbildung 3-8: Wertschöpfungsstufe Informationsbeschaffung im Buchverlag (eigene Darstellung)
Abbildung 3-9: Wertschöpfungsstufe Lektorat (eigene Darstellung)
Abbildung 3-10: Herstellungsabteilung als Schaltzentrale zwischen internen und externen Partnern im Produktionsprozess (eigene Darstellung in Anlehnung an Heinold (2001), S. 117)
Abbildung 3-11: Wertschöpfungsstufe Herstellung (eigene Darstellung)
Abbildung 3-12: Wertschöpfungsstufe Werbung (eigene Darstellung)
Abbildung 3-13: Wertschöpfungsstufe Distribution (eigene Darstellung)
Abbildung 3-14: Vertriebskanäle von Büchern (eigene Darstellung in Anlehnung an Schönstedt (1991), S. 180)
Abbildung 3-15: Akteure der indirekten einstufigen und zweistufigen Buchdistribution (eigene Darstellung in Anlehnung an Heinold (2001), S. 119.)
Abbildung 4-16: Printmedien im Umfeld von Informations- und Kommunikationsindustrie (eigene Darstellung in Anlehnung an Hübler (2000), S.193.)
Abbildung 4-17:Multimedia Produkte (eigene Darstellung in Anlehnung an Strumpe, S. 72.)
Abbildung 4-18: Komponenten zur Erstellung eines digitalen Dokuments als Grundlage zur Produktion von Printmedien und/oder elektronischen Medien (eigene Darstellung in Anlehnung an Kipphan (2000), S. 1050.)
Abbildung 4-19: XML als universelles Textformat (eigene Darstellung in Anlehnung an Schumann/Hess (2002), S. 126.
Abbildung 4-20: Zusammenhang des "on- Demand"-Vertriebes
Abkürzungsverzeichnis
1 Zielsetzung der Arbeit
Verlage sind Wirtschaftsunternehmen und versuchen mit ihren Produkten die Bedürfnisse der Unterhaltung oder der Information zu decken. Die Herstellung von Printprodukten ist ein komplexer Prozess, bei welchem verschiedene Informations- und Materialströme im Fertigungsprozess zusammenfließen. Die Printprodukte erreichen den Käufer über verschiedene Vertriebswege.
Wenn man die Entwicklung ausgehend von der Erfindung des Buchdrucks 1450 bis hin zur Schwelle des Multimedia-Zeitalters im Jahr 2000 betrachtet, so kann man eine zunehmende Dynamik in den letzten Jahrzehnten erkennen.
Abbildung 1-1: Von Gutenberg zu Bits und Bytes (eigene Darstellung in Anlehnung an Kogeler/ Müffelmann (1999), S.222)
Mehr als 400 Jahre liegen zwischen der Erfindung des Buchdrucks und dem ersten Telefon. Hingegen brauchte es für die Weiterentwicklung der Technologie vom Radio zum Fernsehen nur 34 Jahre. Diese Technologien decken parallel zum Printprodukt einen weiteren Teil der von Verlagen befriedigten Kundenbedürfnisse ab. Rundfunknachrichten informieren und Hörspiele sowie Musik unterhalten den Kunden.
Das Senden von Nachrichten um den Globus sowie die universelle Verfügbarkeit von Informationen ist, bedingt durch das Internet, gegenwärtig für viele selbstverständlich geworden. Der Trend geht dahin, dass die Entwicklungszyklen kürzer und daher innovative Produkte schneller auf den Markt gebracht werden, wobei die Entwicklungsdynamik immer weiter zunimmt. Auch in anderen Branchen kann man die Folgen der Innovationsschübe nachzeichnen: So dient die Kutsche nicht mehr als Fortbewegungsmittel und wurde völlig vom Automobil abgelöst. Ebenso hat die Schreibmaschine ausgedient und der Computer ihren Platz übernommen. Im Gegensatz dazu koexistieren die ’neuen’ Medien Rundfunk und Fernsehen und das ’alte’ Printmedium Buch, sie ergänzen einander oder überschneiden sich in ihrer Wirkung.[1] Die Weiterentwicklung des Computers und immer weitere neue Anwendungsmöglichkeiten haben eine Synthese dieser drei Medien ermöglicht: Multimedia.