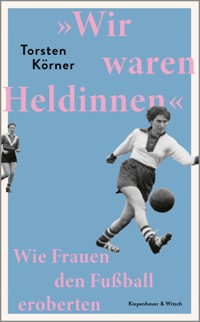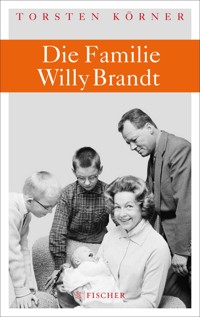9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum wir ohne den Tod nicht leben können! Torsten Körner beschließt in der Blüte seines Lebens bewusst auf die Suche nach dem Tod zu machen. Ungewöhnlich an diesem Buch ist die Perspektive: Der Autor sucht den Tod nicht nur da, wo ihn alle vermuten, sondern zum Beispiel auf einer Modenschau, am Set eines Pornofilms, während eines Marathonlaufs, in einer Apotheke oder in einem Fitnessstudio. Natürlich besucht er auch die klassischen Sterbeorte wie Krankenhäuser, Hospize, Altersheime, Pathologien et cetera und schildert, was er dort erlebt. Jeder stirbt einen anderen Tod. Und in diesem Sinne ist das Buch von Torsten Körner ein höchst subjektives Abenteuer und zugleich eine Erfahrungsreise, die allen etwas schenkt: Nachdenklichkeit. Darüber hinaus ist es ein Füllhorn von Geschichten und Porträts, eine Wundertüte des Lebens!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Torsten Körner
Probeliegen
Geschichten vom Tod
Über dieses Buch
Warum wir ohne den Tod nicht leben können!Torsten Körner beschließt in der Blüte seines Lebens bewusst auf die Suche nach dem Tod zu machen. Ungewöhnlich an diesem Buch ist die Perspektive: Der Autor sucht den Tod nicht nur da, wo ihn alle vermuten, sondern zum Beispiel auf einer Modenschau, am Set eines Pornofilms, während eines Marathonlaufs, in einer Apotheke oder in einem Fitnessstudio. Natürlich besucht er auch die klassischen Sterbeorte wie Krankenhäuser, Hospize, Altersheime, Pathologien et cetera und schildert, was er dort erlebt.Jeder stirbt einen anderen Tod. Und in diesem Sinne ist das Buch von Torsten Körner ein höchst subjektives Abenteuer und zugleich eine Erfahrungsreise, die allen etwas schenkt: Nachdenklichkeit. Darüber hinaus ist es ein Füllhorn von Geschichten und Porträts, eine Wundertüte des Lebens!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Torsten Körner, geboren 1965 in Oldenburg, studierte Theaterwissenschaft und Germanistik. Nach dem Studium promovierte er mit einerArbeit über Heinz Rühmanns Filme der fünfziger Jahre und arbeitet seither als freiberuflicher Autor und Journalist. Der dreifache Vater schreibt Medien- und Fernsehkritiken und ist seit vielen Jahren Juror des angesehenen Grimme-Preises. Unter anderem schrieb er die hochgelobtenSpiegel-Bestseller-Biographien über Heinz Rühmann, Franz Beckenbauer und Götz George. 2010 ist er mit dem Bert-Donnepp-Preis, dem Deutschen Preis für Medienpublizistik, ausgezeichnet worden.
Impressum
Coverabbildung: Walter B. McKenzie/Getty Images © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401705-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Als ich starb
Von einem, der auszog, das Sterben zu finden
Ein Strahl Hoffnung
Das unsterbliche Kind
Käthe
Meine Nachbarn, die Toten
Der erste Tote
Morbus Pop
Es wird ein Wetter sein
Vom Sterben der Dinge
Obduktion
Unser Leichenschauhaus
Ein sehr großer schwarzer Vogel
Allerseelen
Totentanz
Meine Selbstmörder
Totengräber (1)
Kleine Tode
Antiseptischer Ritter
Heimkehr
Wie würde uns die Erde nennen?
Finovo
Textiler Lebenslauf
Pest und Coca-Cola
Grabsteinromane
Clint Eastwood aus der Unterwelt
Interview mit einer Leiche
Totengräber (2)
Doch alle Lust will Ewigkeit
Schädelstätten
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Wohnung aufgeben
Im Beinhaus
Steine sprechen
Langes Leben
Es werden Kriege kommen
Geisterstunde
Hospiz: Der erste Tag
Hospiz: Der zweite Tag
Ich bin froh, dass er weg, dass er tot ist
Finsternis bedeckt mein Herz
Sehr geehrter Herr Baumgart,
Was man mir in den Sarg legen soll
Sterbenslauf
Probeliegen
Literatur
Danksagung
Als ich starb
Der Tag, an dem ich starb, war ein schöner Tag.
Morgens hatte ich eine Runde im Park gedreht. Das trockene Herbstlaub knackte unter jedem Schritt. Der Boden war weich, die Sonne löste die letzten Nebel auf. Ich lief durch einen wunderbar heiteren Herbstfilm, einen Werbespot für Gelungenes Leben. Mütter blickten entzückt in ihre Kinderwagen und lallten weltvergessen dem Nachwuchs zu, ein Obdachloser balancierte gutgelaunt eine Bierflasche auf dem Kopf, ein 1-Euro-Jobber harkte Blätter zusammen und wackelte dabei mit den Hüften (den MP-3-Player am Gürtel), eine Schulklasse trat eine Wanderung an, lachend, schubsend, rufend, grölend, unbekümmert. Der schicksalsergebene Lehrer hatte jede Hoffnung auf Ordnung aufgegeben und trottete wie ein großes Kind hinter ihnen her. Ein Fuchs machte sich ohne Eile auf den Heimweg.
Ich hatte keine Pläne für den Tag, zumindest keine großen. Ich würde ein bisschen an unserer Zukunft basteln, vielleicht ein paar Ideen lostreten; ansonsten musste ich nachmittags die Kinder vom Kindergarten abholen, und abends würde ich dann einen alten Freund, den ich lange nicht gesehen hatte, auf ein Bier treffen. Meine Sorgen waren überschaubar und altvertraut, nichts, was mir Angst machte, würde heute um die Ecke biegen, kein Schrecken in Sicht.
Im Felsenkeller, dieser hartnäckigsten aller Raucherkneipen, die man früher nur unter akuter Erstickungsgefahr betreten konnte, galt inzwischen das Rauchverbot. Wenn man eintrat, prallte man gleich gegen die krummen Rücken der Stammtrinker, die immer am Tresen saßen, weil der Zapfhahn in ihrer unmittelbaren Reich- und Sichtweite lag. Mein Freund war noch nicht da; ich zwinkerte der somnambulen Wirtin zu, empfing ein kaum merkliches Nicken als Gegenleistung und steuerte ohne weiteren Zwischenfall nach hinten, wo sich eine Reihe von runden Zweiertischen befand. Ich hatte kaum Platz genommen, als sich eine junge Frau neben mir niederließ, ohne auf eine Einladung zu warten, ohne mich zu fragen. Sie sah auffällig und nichtssagend zugleich aus. Sie trug einen jener mausgrauen Geschäftsanzüge, die die Auszubildenden einer Bank im dritten Lehrjahr tragen. Zu dieser Berufsuniform passte jedoch nicht die lange weiße Haarsträhne, die von ihrem ansonsten pechschwarzen Haar abstach und viel länger war als der Rest. Ebenso wenig fügten sich der silberne Ring in ihrem Nasenflügel und ein auffälliger Schlagring an ihrer rechten Hand in das Bild einer biederen Angestellten. Obwohl sie bestimmt schon fünfundzwanzig Jahre alt war, zeigten sich auf ihrer Stirn ein paar Pickel, so als sei sie gerade in die Pubertät gekommen. Ich hatte sie hier noch nie gesehen und war bereit, sie mit einer geschmeidigen Floskel von meinem Tisch zu vertreiben. Ich war nicht neugierig auf ihre Geschichte.
»Ich erwarte jemanden!«
Sie verzog keine Miene.
»Vielleicht können Sie mich aufklären …?«
»Ich muss Sie bitten mitzukommen. Machen Sie es mir nicht schwer! Sie sind so gut wie tot.«
Sie entzündete eine Zigarette, sog den Rauch gierig ein, ohne ihn wieder preiszugeben. Er blieb verschwunden.
»Ist das ein Scherz? Wo ist die Kamera? Wohin soll ich winken?«
»Es tut mir leid, aber Sie sind gerade gestorben und ich habe nun einmal Dienst. Ich bin Volontärin in der Abteilung ›Plötzliches und unvermutetes Ableben‹, und ich habe heute noch einige andere Kandidaten zu überführen. Ihnen ist ein Gefäß nahe des Herzens geplatzt, bitte verschonen Sie mich mit detaillierten Nachfragen, ich bin keine Medizinerin. Wenn Sie es wünschen, können Sie dazu in der Abteilung ›Ursachen und Gründe‹ ein kostenloses Gutachten in Auftrag geben.«
»Ich dachte immer, der Tod wäre …?«
»Ein Mann? Ein Skelett? Ein Schädel? Vergessen Sie’s, Folklore, Klischees und ortsgebundene Bilder. Andere Länder, andere Tode. Wenn ich Sie jetzt bitten darf? Bin spät dran!«
»Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um zu einem späteren Zeitpunkt von Ihnen …?«
»Alles, was Sie waren, haben Sie selbst bestimmt. Alles, was Sie jetzt sind, gehört nicht mehr Ihnen.«
»Ich muss aber noch …«
»Nein, Sie dürfen gehen!«
Erst jetzt merkte ich, dass mein Kopf auf der Tischplatte lag, allerdings schien das hier niemand zu stören. Es sah aus, als ob ich schliefe. Um mich herum nahm das Leben seinen Lauf. Die Wirtin steuerte auf mich zu, jemand umarmte eine Frau, am Nebentisch wurden kraftvoll Karten auf den Tisch geschmettert, ein Raucher sog gierig an einer unangezündeten Zigarette, der Koch schob ein dampfendes Sauerkraut über die Durchreiche, Gläser wurden aneinandergeschlagen, Gelächter. Und ich starb. War schon tot. Abgeholt. Von einer Volontärin. Vielleicht sollte ich mir doch erst einmal ihren Ausweis zeigen lassen? Vielleicht war’s ein Irrtum?
Auf dem Weg nach draußen kam mir mein Freund entgegen. Er blickte suchend in den Raum. Ich hätte ihm gerne noch mal auf die Schulter geschlagen. Ich streifte seinen Arm. Er merkte nichts.
Dann schrie der Wecker.
Ich lebte.
Noch.
Von einem, der auszog, das Sterben zu finden
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich von Träumen erschrecken lassen, aber dieser fiel auf fruchtbaren Boden. Ich bin jetzt dreiundvierzig Jahre alt. Stehe ich nicht mitten im Leben? Warum sollte ich mich mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigen? Liegt mein Tod nicht in weiter Ferne? Wer sich mitten im Leben glaubt und damit in Sicherheit, vertraut einer fadenscheinigen Floskel. Jeder ist dem Tod jederzeit nah, wir wissen nur nicht, welche Gestalt er annimmt, wann er kommt und warum gerade jetzt. Ich habe noch nie einen Toten gesehen, habe noch nie jemanden beim Sterben begleitet und bin dem Tod meistens dort ausgewichen, wo ich mit ihm hätte in Berührung kommen können. Das Thema Sterben und Tod hat mich zwar immer angezogen und interessiert, aber die direkte Begegnung habe ich gescheut oder verpasst. Ich erinnere mich, dass ich mich während des Studiums bei der studentischen Jobvermittlung Heinzelmännchen als Leichenwäscher bewarb, doch der Job war offenbar wegen des vergleichsweise hohen Stundenlohns von vierzehn Mark begehrt und bereits vergeben.
Ich bin ein ängstlicher Mensch. Vielleicht liegt es an der Schule. Ich habe die Schule gehasst, blieb sitzen und kam mir vor wie ein Greis, als ich das Abitur ablegte. Zu spät. Dieses »Zu-Spät« sitzt mir seither im Nacken. Ich gehe durchs Leben, als hätte ich immerzu einen großen Haufen unerledigter Hausaufgaben im Gepäck, als drohe mir eine mächtige Deadline: »Kommst du nicht rechtzeitig ins Ziel, erfüllst du die Aufgaben nicht; hältst du den Termin nicht ein, dann stirbst du.« Vielleicht kann ich diese Empfindung überwinden? Ich warte nicht mehr, bis mich der Tod holt, bis mich eine schlechtgekleidete Volontärin überführt und mein Leben für beendet erklärt. Vielleicht hat mein Sterben schon begonnen, und ich habe bloß nichts davon bemerkt? Vielleicht wird um mich herum gestorben, ohne dass ich davon bisher Notiz genommen habe?
Ich will die Augen aufmachen, das Sterben suchen, dem Tod entgegengehen. Meinen Tod werde ich hoffentlich nicht finden, aber das Licht, das vom Sterben auf mein Leben fällt, will ich nutzen, um besser zu sehen, um meine Ängste besser dimensionieren zu können. Jeder, der nur ein klein wenig die Augen öffnet, findet den Tod überall. Jetzt, wo ich dies schreibe, blickt er mich an. Ich wohne im vierten Stock. Auf der anderen Seite der Straße stand auf gleicher Höhe stets ein Mann, der zu mir herüberblickte. Er war pensioniert, aber noch nicht alt. Er hatte viel Zeit. Als wir uns einmal auf der Straße trafen, gab er mir zu verstehen, dass es nicht einfach sei, die Zeit ohne Arbeit zu füllen. Er blickte oft zu mir herüber. Fast täglich. Dann aber sah ich ihn lange Zeit nicht. Nur seine Frau bewegte sich hinter den Gardinen und saß abends allein am Tisch. Einige Wochen später traf ich den Mann auf der Straße, besser, wir gingen aneinander vorbei und grüßten uns höflich. Er war ganz mager geworden, sein Gesicht war schmal, die Haut rosig. Er sah gut aus, aber doch todkrank. Ich wagte nicht, ihn anzusprechen, sein Körper erzählte alles. Er war bald tot. Leberkrebs. Wir kannten uns nicht gut, aber ich hätte mich dennoch gerne von ihm verabschiedet. Er war ein Nachbar. Jetzt fehlt er meinem Tag. Als ich gerade vom Schreiben aufblickte, dachte ich, er stünde wieder an seinem Platz. Aber es war wohl nur die Sonne, die sich spiegelte oder der Schatten seiner Frau.
Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, hat mich als Kind sehr beeindruckt. Der Junge war dumm, hieß es da, aber furchtlos. Ein vermeintliches Gespenst stieß er im stockfinsteren Kirchturm die Treppe hinunter, er nahm Gehenkte vom Galgen ab, um sie am Lagerfeuer zu wärmen, er kegelte mit Totenschädeln und versuchte, einen eiskalten Leichnam zu wärmen, indem er ihn zu sich ins Bett legte und den Toten an sich rieb. Doch vor nichts gruselte es ihm. »Ach, wenn mir doch nur gruselte!«, seufzte er. Weil er durch seine Furchtlosigkeit ein Schloss von Gespenstern befreite, gab man ihm die Königstochter zur Frau. Sie lehrte ihn schließlich das Gruseln, indem sie des Nachts einen Eimer mit kalten, zappelnden Fischen über ihn ausschütten ließ. Jetzt wusste er, was es heißt, sich zu gruseln.
So will auch ich ausziehen, ein bisschen dumm, aber neugierig, furchtlos hoffentlich und zärtlich zu den Toten. Ist es blöd oder barmherzig, einen Gehenkten ans Lagerfeuer zu setzen? Ich will das Sterben und den Tod suchen, will überallhin gehen, wo diese beiden zu finden sind, und will nicht wegschauen, wenn es ans Sterben geht. Ich will die Geschichten vom Tod erzählen, die mir begegnen, und von den Menschen, die ihr Leben lassen müssen. Ich möchte mich selbst und meinen Körper befragen: »Wo beginnt das, was man Sterben nennt?« Ich will Hospize besuchen, Bestattungsunternehmen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, ich will dorthin gehen, wo die meisten Menschen heutzutage sterben. Aber ich will das Sterben auch dort suchen, wo man glaubt, man sei sicher vor ihm, dort, wo man dagegen ankämpft oder vor ihm flieht. Vielleicht finde ich das letzte Bye-Bye auch im Fitnessstudio, im Bio-Supermarkt oder bei den Dreharbeiten eines Pornofilms? Ich will mir nicht diktieren lassen, wo ich den Tod zu suchen habe, denn dann hätte er schon gewonnen. Ja, ich werde auch über Friedhöfe spazieren, aber möglicherweise ist der Besuch eines Sonnenstudios, einer Modenschau oder einer Talkshow ebenso ergiebig. Ich will nichts auslassen, denn mit dem Tod kommt man überall hin. Und ich will dem Tod zuhören, denn der Tod ist der älteste Erzähler der Menschheit. Seine Geschichten handeln verlässlich davon, wie es uns geht und wer wir sind.
Dem Tod zuhören, heißt Leben lernen.
Rainer Maria Rilke hat in seinem Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge« bereits 1910 das moderne Sterben und den modernen Tod skeptisch und desillusioniert beschrieben. Mit Blick auf ein großstädtisches Krankenhaus urteilt sein Held Malte: »Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei so enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer gibt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die es sich doch leisten könnten, ausführlich zu sterben, fangen an, nachlässig zu werden; der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile noch, und er wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles. Man kommt, man findet ein Leben, fertig, man hat es nur anzuziehen. Man will gehen oder man ist dazu gezwungen: nun, keine Anstrengung: Voilà votre mort, monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt; man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat (denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, dass die verschiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Menschen; und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun).«
Dieser Bewusstlosigkeit und Konformität des Sterbens, diesem gesichtslosen Verschwinden, diesem nummerierten Abstreichen, dieser nüchternen Bilanzierung und leidenschaftslosen Ausradierung möchte ich begegnen. Können wir noch einen eigenen Tod sterben? Haben sich die alles einebnenden Tendenzen, die Rilke so hellsichtig beschreibt, seither nicht verstärkt? Haben wir eine Chance, unseren Tod mit unserem Leben sprechen zu lassen? Und was kann uns das Sterben der anderen für unser Leben und unseren Tod lehren? Ich fürchte jedoch schon jetzt, noch bevor meine Reise beginnt, dass dieses Buch keine Ratschläge zutage fördert, mit denen man sich wappnen kann. Jeder stirbt für sich allein. Das hier wird kein Trostbuch oder Trauerratgeber. Dennoch will ich die Hoffnung nicht aufgeben, etwas zu lernen, was mein Leben eigener macht.
Was der Tod wirklich ist, ist uns unzugänglich, weil er, wenn überhaupt, nur im Licht eines Blitzes erfasst werden kann, das das Letzte ist und zugleich die Finsternis. »Und doch«, schreibt Michel de Montaigne in seinen Essais, »glaube ich, können wir uns irgendwie mit dem Tod vertraut machen und ihn sozusagen probieren. Wir können ihn zwar nicht ganz und vollständig erfahren, aber doch so weit, dass diese Erfahrung nicht nutzlos ist, weil sie uns Kraft und Halt gibt: Wenn wir auch nicht wirklich hinkommen können, so können wir doch in die Nähe gelangen; wir können Erkundungsfahrten unternehmen; und wenn wir auch nicht bis zum Geheimnis des Todes vordringen, so ist es uns doch möglich, die Wege, die dahin führen, zu sehen und uns mit ihnen schon vertraut zu machen.«
Zuerst einmal gehe ich zum Arzt. Wissen Sie noch, wie das ist, wenn Ihnen der Arzt das kalte Ohr seines Stethoskops gegen die Brust drückt?
Bitte jetzt nicht atmen!
Danke! Und jetzt wieder normal weiteratmen.
Ein Strahl Hoffnung
Wenn Sie ein Herz in den Schnee pissen, sind Sie vermutlich jung, und das ganze Leben liegt noch vor Ihnen. Aus der dampfenden Mitte dieser winterlichen Liebeserklärung steigt eine Hoffnung auf, die an kein Ende zu kommen scheint. Genauso ungestüm und lebendig dürften Sie sich fühlen, wenn Sie mit Ihrem besten Freund auf dem Schulklo oder im Wald um die Wette pinkeln, um die Leistungskraft Ihres kleinen Feuerlöschers auszuprobieren. Der Strahl steigt hell, das Leben ist schön.
Aber als ich kürzlich meinen Arzt aufsuchte, musste ich mir eingestehen, dass diese Zeiten längst vorbei sind. Es war das erste Mal, dass mein Hausarzt jünger war als ich. Früher waren die Ärzte, zu denen ich ging, ältere Herren mit Glatze oder silbernem Haarkranz, mit beeindruckend buschigen Augenbrauen, weißkittlige Herrscher im Reich des Körpers und seiner Defekte; dieser hier hatte zwar auch wenig Haare auf dem Kopf, hatte aber eindeutig einige Jahre nach mir die große Bühne betreten.
»Dann erzählen Sie mal. Was kann ich für Sie tun, Herr Körner?«
Mein Arzt sah mich erwartungsvoll an, freundlich, das Gesicht zeigte ein zuversichtliches, aufnahmebereites, dienstleistungswilliges, gut ausgebildetes, ungeduldig-anspornendes Warten. Legen Sie los! Sie sind nicht der Einzige, den der Schuh drückt! Frei weg von der Leber! Raus mit der Sprache, meine Brötchen wollen auch gebacken und meine Angestellten bezahlt sein. Er malte Fragezeichen in die Luft. Lächelte.
»Ich möchte mich gerne einmal auf Herz und Nieren untersuchen lassen. Ich war lange nicht beim Arzt und will demnächst einen Marathon mitlaufen. Außerdem – vielleicht können Sie mir da gleich was verschreiben – muss ich unglaublich oft pinkeln, und meine Frau sagt auch, lass dich mal untersuchen. In unserem Alter (ich blinzle ihm verschwörerisch zu) heißt es doch, man müsse auch oder gerade an die Prostata denken.«
»Was für Beschwerden haben Sie denn beim Wasserlassen, Herr Körner?«
»Mein Strahl ist grundsätzlich nicht so ein munter ins Becken springender, gelöster, zuversichtlicher und zielstrebiger Strahl, sondern er stockt, stottert geradezu, er muss immer neuen Anlauf nehmen und tröpfelt dann kümmerlich aus, ohne sich zu einem klaren Ende durchringen zu können. Er scheint sich auch in einem sensiblen Dialog mit seiner Umwelt zu befinden, denn er reagiert auf Stress und Belastung. Und er setzt selten Ausrufezeichen! Und manchmal kommt es mir vor, als lasse ich sehr viel mehr Wasser, als ich Flüssigkeit zu mir genommen habe. Das habe ich besonders bei meinem ersten Marathon im letzten Jahr als störend empfunden. Ich musste vor dem Lauf mindestens zehnmal in die Büsche. Andere Männer und ihr Strahl scheinen sich grundsätzlich einiger zu sein, sie ziehen an einem Strang, ich meine, sie kommen, sie urinieren, als ob sie mit einer Axt ein Stück Holz spalten, und dann gehen sie wieder …«
Mein Arzt lacht und unterbricht mich.
»Sie haben sich ja doch den einen der anderen Gedanken gemacht, Herr Körner?!«
»Gibt es auch nervöse Blasen? Ich habe das Gefühl, dass meine Blase unmittelbar meine Stimmungen widerspiegelt.«
Er nickt.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Körner, wir werden uns das mal mit dem Ultraschall anschauen, da kann man ziemlich gut sehen, ob da irgendetwas nicht stimmt oder unnormal vergrößert ist. Zunächst aber darf ich Sie zur Blutabnahme bitten, und dann machen Sie gleich ein EKG.«
Die Arzthelferin, die mir das Blut abnahm, machte ihre Sache gut. Meine Venen sind schlecht zu sehen, und ich habe es oft erlebt, dass die Arzthelferinnen drei- oder viermal zustechen mussten, ehe sie fündig wurden. Diese hier fand gleich die richtige Stelle. Dann maß sie meinen Blutdruck und befestigte die Kontakte für das EKG auf meiner Brust.
»Kürzlich hatte ich einen Patienten, den musste ich erst rasieren, damit die Plättchen hielten. Der war so behaart, nichts hielt!«
Ich war froh, nicht allzu stark behaart zu sein. Ich schloss die Augen und wartete. Dann wurde ich zum Doktor gebeten. Er rieb meinen Bauch und meine Brust mit Gel ein und drang mit dem Schallkopf in mein Inneres vor.
»Wenn Sie Ihren Kopf drehen, können Sie zuschauen.« Ich bemühte mich, seinen Erläuterungen zu folgen, doch die Organe, die er erkannte, waren für mich körnige, undeutliche, unruhige Schatten. »Das sieht doch alles sehr gut aus, Herr Körner. Soweit ich jetzt sehen kann, ist alles in Ordnung. Die Prostata ist nicht vergrößert, alles ganz normal.«
»Ich weiß, dass das keine seriöse Frage ist, aber können Sie mir sagen, wie alt ich werde?«
Er stutzte kurz.
»Sie kennen die durchschnittliche Lebenserwartung des Mannes?«
»Etwa dreiundachtzig Jahre?«
Er lachte. »Die durchschnittliche Lebenserwartung des Mannes beträgt etwa sechsundsiebzig Jahre. Das traue ich Ihnen, so wie ich Sie jetzt sehe, zu.«
Ich war ein bisschen enttäuscht, so sehr im Durchschnitt zu liegen. »Nicht mehr? Und dann?«
Dumme Frage!
»Na, dann ist irgendwann der Ofen aus!«
Ich werde diesen Ausdruck nie vergessen. Es war nicht unbedingt eine feinfühlige oder originelle Metapher, die mein Arzt da benutzt hatte, aber sie war wünschenswert klar und eindeutig. Ofen aus! Feuer aus! Alles aus!
Ich bat meinen Arzt, mir einen kleinen Bericht über seine Untersuchungen zu schreiben. Als Gedächtnisstütze. Um etwas in der Hand zu haben. Um meine Gesundheit auf Papier nach Hause tragen zu können.
Zuerst kam die Rechnung.
Zwei Wochen später folgte der knappe Bericht, aber erst, nachdem ich wiederholt die Arzthelferin gebeten hatte, den Herrn Doktor daran zu erinnern.
Sehr geehrter Herr Körner,
ich freue mich, Sie als neuen Patienten in unserer Praxis begrüßen zu dürfen! Heute möchte ich Ihnen zusammenfassend über die durchgeführten Untersuchungen berichten.
Ihre Diagnosen lauten: Erfreulicherweise konnte ich keine Diagnosen erheben!
Sie stellten sich zu einer eingehenden Vorsorgeuntersuchung in unserer Praxis vor. Sie rauchen nicht und treiben viel Sport (Marathonlauf).
Die körperliche Untersuchung war altersentsprechend normal. Gleiches gilt für die Ultraschalluntersuchungen des Bauches, des Halses und des Herzens. Besonders erfreulich: Die Gefäßinnenhaut Ihrer Halsschlagadern ist mit 0,4 mm nicht verdickt. Sie weisen somit kein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall auf!
Da Sie unter vermehrtem Harndrang beim Joggen leiden, verordnete ich Ihnen probehalber Vesicur. Dies sollten Sie bei Bedarf einnehmen.
Die Laborwerte, die Sie in der Anlage finden, waren ohne krankhafte Besonderheiten.
Zusammenfassend sind Sie bei hervorragender Gesundheit!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und verbleibe mit den besten Wünschen
Mein Arzt ist ein Mann mit Gefühl und Witz. Man beachte, an welchen Stellen er die Ausrufezeichen gesetzt hat! Ich werde mich nun selbst untersuchen und befragen müssen. Die Reise geht nach hinten los.
Das unsterbliche Kind
Über Kinder, kleine Kinder, hat der Tod keine Macht. Ihre Welt ist ganz und gar heil, selbst wenn ein großes Unglück sie trifft: Puppe vergessen, Mutter verschwunden, winterkaltes Händchen, Himbeereis in den Sand gefallen. Solche Tränensturzbäche bringen wir, die Erwachsenen, die Wissenden, kaum noch zustande. Das Unwissen um die Welt, um den Tod hüllt das Kind ein wie ein warmer Mantel, es ist umsponnen von Scherben, Bruchstücken, Splittern, die ihm alles, die ihm ein Kosmos sind, weil sich alles fügt und verbindet. Wo wir nur Trümmer sehen, abgerissene Fäden, sieht das Kind noch ein Ganzes. Das Kind braucht keinen Himmel, weil es ihn in sich trägt. In seiner Hand, seiner Jackentasche oder der Falte seines Pullovers. Kinder können die Zeit verzaubern, weil sie die Uhr noch nicht lesen können. Die Zeit beißt sich an ihnen die Zähne aus. Wo aber beginnen Kinder zu sterben? Wo gewinnt der Tod seine Macht über sie?
Hat die Geschichte ohne mein Wissen angefangen? Schon mein Vorname trägt einen Tod in sich. In dem Dorf, in dem ich aufwuchs, waren meine Eltern Zugezogene. Sie waren Flüchtlinge aus der Deutschen Demokratischen Republik, die in der Bundesrepublik Deutschland niemanden kannten und keine Verwandten besaßen. Sie freundeten sich deshalb mit einer Familie an, die ebenfalls fremd und zugezogen war. Das Ehepaar Karl hatte drei Söhne und eine Tochter. Herr Karl war Kfz-Meister, betrieb eine kleine Tankstelle und eine Autowerkstatt. Ich erinnere ihn als großen, immer freundlichen Mann mit ölverschmierten Händen, der stets nach Benzin roch, viel rauchte, graublaue Overalls trug und Kinder sehr mochte. Ihr jüngster Sohn hieß Torsten. Meinen Eltern gefiel der nordische Name so gut, dass sie die Nachbarn fragten, ob sie etwas dagegen hätten, wenn auch ich auf diesen Namen getauft würde. Karls waren einverstanden, freuten sich. Nur der katholische Pfarrer, der mich taufen sollte, freute sich nicht. Er weigerte sich, diesen ganz und gar heidnischen und unchristlichen Namen ins Taufregister einzutragen. Nur unter Protest fand er sich schließlich dazu bereit und kündigte zugleich an, er werde mir bei der Taufe eigenmächtig einen christlichen, einen statthaften Namen verleihen, ihn sozusagen in die Luft sprechen, einen ordentlichen Namen, der mich begleiten sollte.
In der Nacht, in der bei meiner Mutter die Wehen einsetzten, war Hilfe vonnöten. Die nächste größere Stadt war vierzig Kilometer entfernt, und meine Eltern besaßen kein Auto. Der erste Nachbar, bei dem meine Eltern anklopften, öffnete nicht, wie verabredet, die Tür. Deshalb klingelte mein Vater bei Karls, wo ihm sofort aufgemacht wurde. Herr Karl unterhielt zugleich einen Abschleppdienst, weshalb er spätnachts oft zu Unfällen gerufen wurde. Und so fuhr er meine Eltern nach Oldenburg, wo ich geboren wurde.
Kaum zwei Monate darauf passierte etwas Furchtbares. Torsten, mein Namenspatron, wachte morgens auf und hatte plötzlich schneeweiße Beine, die über und über mit roten Punkten bedeckt waren, so als ob ihn jemand mit einer heißen Nadel gestochen hätte. Seine Mutter suchte mit ihm, ihrem zweijährigen Jungen, sofort den Hausarzt auf und erhielt noch am selben Tag die niederschmetternde Diagnose, dass ihr Sohn an Leukämie erkrankt sei. Es gab keine Rettung. Während ich heranwuchs, starb der ältere Torsten in nächster Nähe. Ich habe kein verlässliches Bild von ihm, denn als er starb, war ich kaum zwei Jahre alt, aber das häufige Reden über ihn, das familiäre Erinnern an ihn, macht ihn mir zu einer präsenten Kindheitsfigur, zu einer Schattengestalt, die ich gleichsam im Augenwinkel erinnere. Ich kann kein Bild von ihm haben und habe doch eines. Eines, das sich entzieht, sobald man anfängt, es zu beschreiben.
Torsten starb im Alter von vier Jahren. Am Tag seines Todes informierte die behandelnde Ärztin die Eltern und gab ihnen zu verstehen, dass es mit ihrem Sohn »zu Ende« ginge. Frau Karl rief daraufhin ihre Eltern in Hamburg an, die sich sofort auf den Weg machten, um sich von ihrem Enkelkind zu verabschieden. Wusste der Junge, dass der Wunsch nach einem Eis sein letzter Wunsch sein sollte? Schließlich saßen alle an seinem Bett, die Eltern und die Großeltern, und sahen ihn an. Der schlafende Junge wachte noch einmal auf, hob das bleiche Köpfchen, blickte in die Runde, lächelte und schloss die Augen.
In meiner eigenen Familie erlebte ich als Kind zunächst keinen Trauerfall. Die erste Trauer galt Tieren. Die Kaninchen, die geschlachtet wurden. Die zum Ausbluten aufgehängt wurden. Am Tag zuvor hatte ich sie noch mit Gras und Mohrrüben gefüttert, und jetzt hingen die felllosen, unheimlich roten Körper im Schuppen. Ein Nachbar, geübt in solchen Dingen, hatte ihnen mit einem Knüppel das Genick gebrochen. »Geh da nicht hin! Schau dir das nicht an!«
Dann eine Maus! Eine Spitzmaus, die ich im Wald jagte, unter Kiefern und Tannen. Ich sehe noch den Nadelteppich, der unter den Bäumen liegt. Ich falle, stürze und erdrücke das Tierchen unabsichtlich mit dem Knie. Die reglose Maus. Ich stupse sie vorsichtig mit einem Ast an. Rührt sich nicht mehr … Bekommt ein Grab unter den Bäumen und wird nicht vergessen, ein Leben lang!
Dann der erste Mord. Stichlinge werden aus einem trüben Graben gefangen. Die kleinen stacheligen Fische werden mit dem Marmeladenglas oder dem Kescher herausgeholt, dann viviseziert, mit dem Stöckchen, dem Fuß, dem Glas, einer Scherbe. Wie die zappeln, immer noch leben, bis sie ganz und gar zerstückelt und ohne Leben sind. Kriegen auch kein Grab, bleiben liegen auf dem Asphalt und sind schon am nächsten Tag kaum noch zu finden. Man merkt schon – auch als Kind – hier geht alles durcheinander. Entdeckerfreuden gepaart mit der Lust am Quälen, Gewissensbisse und Empathie, Trauer und das Gefühl, etwas ganz Besonderes getan zu haben, etwas, was man nicht tun soll und deshalb geheim halten muss. Kann man aber doch stolz drauf sein, denn man hat das Kind, das man ist, verändert, auch wenn man noch nicht weiß, wie und wohin. Etwas kommt in Gang.
»Meinst du, die Fische merken was?«
»Klar, die haben doch Augen, aber Regenwürmer nich’.«
»Und wo ist das Herz?«
»Muss da auch irgendwo sein!«
»Ich finde es nicht!«
Der Tod von Tieren ist häufig der erste Anlass für Kinder, nach dem Tod zu fragen. Wohin gehen sie? Sind sie jetzt woanders? Kommen sie nicht mehr wieder? Erwachsene, die stets glauben, dass Kinder Trost nötig haben, wenn sie dem Tod begegnen, erfinden dann Katzen-, Hunde- oder Spatzenhimmel und wollen keinesfalls den Gedanken zulassen, dass es einen totalen Abschied, ein totales Ende, eine völlige Auflösung und spurlose Auslöschung geben könne. Eltern überführen die Tierseele in halbdurchlässige Sphären, die für die Kinder nicht zugänglich sind, die aber von den Tieren verlassen werden können, damit diese Zeugen unseres Weiterlebens werden können oder wie Schutzengel das Kind begleiten. Wer tröstet da eigentlich wen? Erfinden wir, die Erwachsenen, diese narkotisierenden Geschichten nicht für uns selbst? Für manchen Erwachsenen ist der Tierhimmel der letzte Himmel, den er bauen mag, den er sich selbst als Himmelsbaumeister zutraut. Ich baue mir keine Himmel und pflege auch keinen intimen Umgang mit Gott, ich lasse ihn aber vor den Augen meiner Kinder als mythische Macht unangetastet und erwecke ihn von Zeit zu Zeit aus kulturellen Überlegungen zum Leben. Sollen sie ihn doch selbst zertrümmern, wenn sie irgendwann einmal die Lust dazu haben. Umso mehr überraschen mich bisweilen ihre engagierten Dialoge, in denen Gott unvermittelt und quicklebendig auftaucht. Der folgende Wortwechsel entspann sich kürzlich zwischen meinem Sohn (sechs Jahre) und meiner ältesten Tochter (vier Jahre) aus heiterem Himmel. Meine Frau und ich hatten zuvor über den Tod eines entfernten Bekannten gesprochen.
Meine Tochter (verwundert): »Erst wird man geboren, dann wartet man, und dann ist man tot. Gott ist ein bisschen der Beste.«
Er (mit Nachdruck): »Jesus ist der Beste!«
Sie: »Weil Jesus kann nach dem Sterben wieder aufstehen.«
Er (belehrend): »Gott kann sowieso nicht sterben!«
Sie (triumphierend): »So wie Pippi Langstrumpf, die kann auch nicht sterben, weil sie die Stärkste ist.«
Er (herablassend): »Aber die gibt es ja gar nicht, deswegen kann sie auch nicht sterben!«
Sie (schlussfolgernd): »Doch die gibt’s, sonst müssten Herr Nilson und Kleiner Onkel doch verhungern.«
Wenn ich diese Dialoge höre, weiß ich, dass das Kind, das ich war, auch über den Tod nachdenken und sprechen konnte, ohne in seine unmittelbare Nähe geraten zu sein, ohne Angst zu haben, den Tod in mein Leben einzuladen, nur weil ich ihn beim Namen genannt oder verspottet hatte. Kinder haben keine angeborene Scheu vor dem Tod, die wird ihnen erst durch uns anerzogen und nahegebracht. Die Verleugnung des Todes halten wir für ein Zeichen von Vitalität, und fast abergläubisch versuchen wir, dieses Thema von unseren Kindern fernzuhalten, als könnten allein die Symbole, Metaphern, die ganze Nomenklatur des Todes unsere Kinder und uns selbst wie eine ansteckende Krankheit befallen.
Die Woche nach dem Tod meiner Großmutter war sehr schön. So schön, dass ich diese Tage bis heute als angenehme, als glückliche Zeit erinnere. Meine Großeltern mütterlicherseits lebten in Leipzig; nach der Flucht meiner Eltern 1960 wurde mein Großvater verhaftet, weil man ihn verdächtigte, ein Mitwisser gewesen zu sein und den Republikflüchtlingen geholfen zu haben. Daraufhin konnten meine Eltern einige Jahre nicht in die DDR einreisen, dennoch brach der Kontakt zu den Großeltern nie ab. Mit dem Besuch Willy Brandts 1970 in Erfurt begannen sich die deutsch-deutschen Beziehungen zu entspannen, Reiseerleichterungen traten in Kraft, und meine Eltern wagten sich wieder in ihre alte Heimat. Zumindest für einige Tage. Ich habe meine Großmutter in Leipzig immer sehr gemocht.
Als sie 1976 starb, war ich zehn Jahre alt. Ich erinnere mich an die Nacht, in der das Telefon klingelte und meine Mutter so seltsam schluchzte.
Einige Tage nach ihrem Tod, sie starb mit zweiundsechzig Jahren in einem Leipziger Krankenhaus, fuhren meine Eltern mit meinem älteren Bruder nach Leipzig, um sich von ihr zu verabschieden und an der Trauerfeier teilzunehmen. Mir, dem Kleinen, wollte man den Anblick der toten Großmutter nicht zumuten. Ich wurde deshalb für einige Tage in der Obhut von Familie Karl zurückgelassen, die inzwischen gute Freunde meiner Eltern geworden waren. Die Tage waren schön, weil sie anders waren. Erst viele Jahre später – und ich weiß nicht, wann das anfing – habe ich den Verlust meiner Großmutter wirklich gespürt, angenommen, habe ich gemerkt, dass da eine Leerstelle ist, die nie aufgefüllt werden kann.
Vielleicht lassen sich Kinder in diesem Alter noch nicht so sehr vom Tod erschrecken, weil sie das Unwiderrufliche nicht akzeptieren, weil sie das Verschwinden gar nicht als ein finales Verschwinden fassen können oder wollen. Schließlich sind jüngere Kinder gewiefte Schamanen, die allen Dingen und Tieren eine Seele zuweisen, für die ein Stöckchen ebenso eine Seele und einen Geist besitzt wie ein Hund, ein Teddy oder ein Gummibärchen. Gegenüber Gummibären verspürte ich manchmal eine gewisse Beißhemmung, weil der Gummibär doch Schmerz empfinden müsste, oder? Er besaß doch eine Gestalt, so putzige Beinchen, Ärmchen, ein Köpfchen, also musste er doch auch ein Innenleben haben? Ich weiß nicht mehr, ob diese Überlegungen auch nur einem Gummibären eine Schon- und Galgenfrist einbrachte, aber das Hineinversetzen in das Ding, das Gummitier, dieser Wechsel der Perspektive, diese Preisgabe meines Ichs und Annahme einer Gummi-Identität, bringt mir das Kind, das ich war, und seine Kräfte sehr nahe. Wie unglücklich war ich, wenn ich mit meinen Eltern im Wald spazieren ging, etwas fand, sagen wir eine wertvolle Batterie, ein Bonbonpapier voller Geheimbotschaften, eine alte Seeräuberdose oder einen sprechenden Kiesel, und ich diese dann, diese Rätseldinge, im Wald zurücklassen musste! Warum wollen Eltern das grundsätzlich nicht verstehen, warum zwingen sie uns, so untreu und gleichgültig gegenüber den Dingen zu werden? Vielleicht fangen wir an zu sterben, wenn wir den Glauben an unsere animistischen Kräfte verlieren, wenn wir keine Geborgenheit mehr finden zwischen den Dingen, weil wir ihnen keine Geborgenheit mehr schenken können.
Wenn ich in die Vergangenheit schaue und mich frage, wann ich das erste Mal an meine eigene angeborene Sterblichkeit dachte und sie fürchtete, will mir nichts einfallen, vorerst noch nicht. Dagegen fällt es mir leicht, das Auftauchen des ersten Selbstmordgedankens in meiner Biographie zu lokalisieren. Ich ging in die dritte Klasse der Grundschule, ich war also acht oder neun Jahre alt. Ich fuhr morgens allein mit dem Rad zur Schule, der Autoverkehr jener Jahre war noch überschaubar, erst recht auf dem Land. Und ich höre den Satz, den Gedanken noch ganz deutlich, so als hätte ich ihn erst gestern ausgesprochen: »Wenn du eine Brille bekommst, dann bringst du dich um!« Ich wusste damals nicht einmal, wie das geht, sich umbringen, aber der offenkundigen Angst vor einer Brille musste ich mit einer gewissen verbalen Radikalität begegnen.
Was ich hier noch auskramen möchte, ist die Geschichte von Max und Moritz, die mir, wie ich vermute, das erste Mal ein Empfinden der Unumkehrbarkeit des Todes vermittelte. Max und Moritz sind, in heutiger Terminologie, Intensivtäter, die ein ganzes Dorf durch ihre Streiche terrorisieren. Sie erdrosseln arglose Hühnchen und stehlen der trauernden Witwe Bolte das gebratene Geflügel aus der Pfanne, sie lassen den Schneider Böck hinterlistig ins kalte, reißende Wasser plumpsen, sie füllen die Pfeife ihres Lehrers mit Schwarzpulver, stecken Maikäfer in das Bett ihres Onkels Fritz, gefräßig stehlen sie die Brezeln des Bäckers und schlitzen endlich die Getreidesäcke des Bauern auf. Der ist es auch, der sie packt, in einen Sack steckt und die zappelnden Burschen zum Müller trägt, wo sie, auf Nimmerwiedersehen, in einen Trichter der Mühle geworfen werden. »Rickeracke! Rickeracke! Geht die Mühle mit Geknacke.« Und jetzt ist es aus mit ihnen! Aus! Aus! Aus! Es gibt kein Zurück. Da liegen sie, geschrotet, in Stücken.
Das ist aber noch nicht das grausige Ende. Wilhelm Busch, der Autor, lässt dann auch noch die Schrotkörner, die am Boden liegend die Konturen der Jungen nachbilden, von zwei Gänsen verzehren. »Doch sogleich verzehret sie / Meister Müllers Federvieh.« Und da wurde mein kindlicher Animismus in seine Schranken gewiesen, denn die Jungen wurden nicht nur zermahlen, sondern auch noch gefressen und verdaut. An dieser Stelle wurde mir immer bange, denn hier spürte ich schon als Kind, dass ich an eine Grenze geriet und es mir nicht gelingen würde, Max und Moritz wiederzubeleben, es sei denn, die Geschichte ginge wieder von vorne los. Die würde aber immer wieder mit dem Tod der Kinder enden. Kein Ausweg. Mich erstaunte vor allem, dass das ganze Dorf keine Trauer zeigte, sondern sogar froh war, die Bösewichte so entsorgt zu wissen. Ich weiß noch, dass ich immer nach Auswegen gesucht habe: Warum sind sie nicht geflohen? Warum hat der Bauer kein Mitleid mit ihnen gehabt? Vielleicht kann man die geschroteten Kinder wieder zusammenkleben? Doch Wilhelm Busch scheint genau gewusst zu haben, wie man solche Kinderhoffnungen überlistet.
Die Gänse speisen die Toten in eine bildlose Unterwelt ein, denn im Magen einer Gans existieren nun mal keine Geschichten.
Käthe
Als Käthe starb, bin ich davongelaufen, weil ich ihr Sterben fürchtete. Wo und wann beginnt eigentlich unsere Geschichte? Warum musste ich mich überhaupt in das Leben dieses fremden Menschen einmischen?
Genaugenommen nahm unsere Geschichte im Jahr 1987 ihren Anfang, als ich meinen Zivildienst in einem Altenzentrum ableistete. In den zwanzig langen Monaten betreute ich alte Menschen. Ich habe in diesem Abschnitt meines Lebens die Überzeugung gewonnen, dass man sich jenseits des eigenen Berufes ehrenamtlich für Menschen engagieren sollte. Man bereichert das eigene Leben, wenn man den beruflich und familiär definierten Aufgabenkreis verlässt, um fremde Menschen zu unterstützen. Das hat, finde ich, erst einmal wenig mit Nächstenliebe, sondern eher etwas mit Selbstachtung zu tun. Man kann durch ehrenamtliche Tätigkeiten den Begriff der Selbstbereicherung auch einmal aus seinem negativen Assoziationsfeld lösen und ihn positiv wenden.
Nachdem ich mein Studium beendet hatte, fühlte ich eine soziale Austrocknung, eine Art kommunikative und soziale Eindimensionalität. Alles war Zweck, zielgerichtet, alles war zukunftsorientiert. Das Leben schien wieder einmal auf eine Art Qualifizierungsmaßnahme zusammengeschrumpft zu sein. In meinem neuen Viertel stieß ich auf eine Sozialstation, die ihr Büro gleich in meiner Nähe unterhielt. Ich fragte, ob ich jemandem helfen könne, ob es jemanden gäbe, der isoliert sei, jemanden, der sich über einen Kontakt freuen würde? Die Leiterin bat mich um etwas Zeit, man würde überlegen, wer in Frage käme. Nach einiger Zeit erhielt ich die Einladung, eine Ausflugsfahrt in den Botanischen Garten mitzumachen. Ich sollte die Betreuung einer alten Dame übernehmen, die im Rollstuhl saß. Das war Käthe. Wir verstanden uns auf Anhieb. Sie war zweiundachtzig Jahre alt. Käthe besaß Humor, sie war, trotz ihrer vielen Gebrechen, fast immer fröhlich, zuversichtlich. Wir freundeten uns an und verabredeten, dass ich sie einmal in der Woche besuche. Nach etwa einem Jahr vertraute sie mir einen Hausschlüssel an, so dass ich jetzt jederzeit Zugang zu ihrer Wohnung hatte.
Käthe war infolge von Diabetes mellitus der rechte Unterschenkel amputiert worden, außerdem litt sie an Parkinson. Sie war, so drückte es einmal eine ihrer Pflegerinnen aus, »multimorbide«. Durch die Parkinson-Krankheit waren Käthes Bewegungen sehr verlangsamt, manchmal wirkten sie wie eingefroren. Sie aß dann wie in Zeitlupe, die Gabel schien in der Luft stillzustehen, dann nahm sie einen neuen Anlauf, sie sammelte alle Kräfte, konzentrierte ihren Willen auf einen Punkt und brachte die Gabel dem schon geöffneten Mund wieder ein Stückchen näher. Ihr Essen war immer kalt, wenn sie endlich fertig war, obwohl ich es ihr während der Mahlzeit manches Mal in der Mikrowelle erwärmte.
An manchen Tagen waren ihre Augen durch die zahlreichen Medikamente so lichtempfindlich, dass sie sie kaum öffnen konnte. Sie sah mich, wenn ich sie begrüßte, kurz an und schloss die Augen wieder. Ihre Haltung im Rollstuhl – und sie saß immer, auch zu Hause, im Rollstuhl – war völlig instabil, immer rutschte sie zur rechten Seite weg, so dass man sie hochziehen und geradezu justieren musste. Dazu war es nötig, hinter den Rollstuhl zu treten, die Arme unter ihren Achseln durchzustecken, auf ihrer Brust zu verschränken und sie schließlich so hochzuhieven. Diese Übung war, sofern man sie nicht gekonnt ausführte, für den Rücken äußerst belastend, denn obwohl Käthe eine kleine Person war, war sie durch ihre Immobilität, ihre Unfähigkeit mitzuarbeiten und durch ihr Übergewicht ziemlich schwer.
Käthes Verfassung war sehr unterschiedlich und stark von ihrer Tagesform abhängig. Manchmal war sie sehr wach, gesprächig und aufmerksam, an anderen Tagen fiel ihr das Sprechen schwer, das Zuhören schien sie auch zu überfordern, und sie saß wie ein Häufchen Elend in ihrem Rollstuhl. Aber Käthe hatte stets ein Ziel, und das lautete: »Ich gebe meine Wohnung nie auf.« Sie mochte über Schmerzen klagen – die hatte sie zweifelsohne reichlich –, aber ich habe sie nie jammern hören, es war nicht ihre Art. Sie wollte nicht ins Altersheim, auch wenn die Betreuung und Pflege in ihrer eigenen Wohnung sehr viel teurer war. Drei- bis viermal am Tag kamen verschiedene Pflegekräfte der Sozialstation zu ihr. Sie wurde morgens aus dem Bett gehoben, angekleidet, in den Rollstuhl gesetzt und mit Frühstück versorgt. Dann kam jemand gegen Mittag, bereitete ihr eine warme Mahlzeit, gab ihr Medikamente und ließ sie dann wieder allein. Am späten Nachmittag oder am frühen Abend wurde ihr ein Abendbrot serviert, ehe man sie schließlich auszog und ins Bett brachte. Am nächsten Tag ging alles wieder von vorne los. Etwa alle zwei Wochen nahm sie an einem Ausflug teil, der meistens in den Botanischen Garten, in den Zoo, in einen Park oder auf einen der Berliner Seen oder Kanäle führte.
Ihre Wohnung im ersten Stock besaß vier Zimmer, Küche, Bad und drei Balkone. Diese Wohnung seit Jahrzehnten gehalten zu haben, bedeutete ihr viel, sie gehörte zu ihrem Selbstverständnis. Sie war einmal verheiratet gewesen und hatte aus dieser Ehe zwei Kinder, aber irgendwann hatte sie sich scheiden lassen und die Kinder allein großgezogen. Ihr Mann muss sie sehr verletzt, oft betrogen und vielleicht geschlagen haben, sie wollte nicht so recht mit der Sprache heraus, obwohl sie oft von dieser Zeit erzählte. Sehr viel lieber und noch häufiger erzählte sie von ihren Eltern und ihrer Kindheit in Steglitz. Wenn es ihr richtig gutging, schickte sie mich nach hinten, wo sich im Flur ein in die Wand eingelassener Schrank befand. Hier waren Fotoalben, Briefe und Dokumente gelagert. Wir blätterten in Fotoalben, und sie beschwor noch einmal die alten Zeiten. In den dreißiger Jahren hatte sie eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin gemacht, sie liebte Pflanzen, vor allem Blumen, und schwärmte von ihrem Großvater, der ihr im Grunewald die Natur nahegebracht hatte. Sie wünschte sich hin und wieder, dass wir einen Ausflug dorthin machen, wo sie mit ihrem Großvater Pilze gesammelt hatte. Dann setzte uns der Bus in der Nähe des Waldes ab, ich schob den Rollstuhl so gut es ging über Stock und Stein, und musste doch bald kapitulieren, wenn der Weg zu uneben wurde, wenn es bergauf oder bergab ging oder sich der Stuhl im Sand festfuhr. Sie war dann traurig, weil sie alles an damals erinnerte, aber doch alles anders und für sie schwer erreichbar war. Dennoch liebte sie diese Ausflüge, sehnte sie geradezu herbei, als könne noch einmal der Großvater zwischen den Bäumen hervortreten und sie an die Hand nehmen.
Ebenso sehr ging sie gerne einkaufen, am liebsten nach Steglitz zu Karstadt oder Wertheim. Sie hatte Enkel und Urenkel und die wollte sie, wenn Geburtstage anstanden, mit Geschenken bedenken. Sie war wählerisch, ließ sich vieles zeigen und studierte die Waren eingehend, bevor sie etwas kaufte. Ich mochte diese Kaufhausbesuche nicht, weil Käthes Langsamkeit nicht immer auf Verständnis stieß bei den Verkäufern oder anderen Kunden, und es gleichzeitig schwer war, Käthes Erwartungen zu befriedigen. Schämte ich mich für ihre Gebrechlichkeit? War mir ihre offenkundige Hinfälligkeit in diesem bunten Warentempel unangenehm? Oder war es nur die Anstrengung, den Rollstuhl durch enge Gänge zu manövrieren, ihren Dolmetscher zu spielen und die rasende Zeit, die mir im Nacken saß? Je enger unsere Beziehung wurde, desto schwieriger wurde es für mich, diese Termine in meinem Alltag unterzubringen. Ab und zu nahm ich die Kinder zu ihr mit. Sie mochte die Kinder, nahm sie, wenn sie sich kräftig genug fühlte, auf den Arm und vergaß nie, sie zu ihren Geburtstagen zu beschenken. Allerdings fingen die Kinder irgendwann an, sie zu fürchten, weil die Wohnung so dunkel war, weil Käthe so reglos im Rollstuhl saß und für ihre Ohren so komisch sprach. Außerdem langweilten sie sich, weil sie nicht herumtoben konnten.
Im Laufe der Jahre ließen Käthes Kräfte nach. Trotzdem wollte sie auf keinen Fall ihre Wohnung verlassen. Mitunter verlor sie den Realitätssinn. Dann lud sie mich und meine Familie zum Heiligabend ein und wollte uns bekochen. Sie, der es schwerfiel, alleine ein Glas zu halten, wollte einen großen Braten in den Ofen schieben und dazu verschiedene Gemüse und Kartoffeln zubereiten. Sie hätte sich nicht einmal ein Ei in die Bratpfanne schlagen können, dennoch plante sie ein großes Festessen mit mehreren Gängen. Ebenso abenteuerlich waren ihre Pläne, ihre Wohnung umzugestalten. Sie wollte schwere Kleiderschränke umsetzen und meinte, wir könnten das zusammen schon schaffen. Dabei saß sie fast den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch, sah Fernsehen und erreichte die anderen Zimmer nur, wenn sie dort jemand hinschob. Manchmal, wenn es an ihrer Tür klingelte, versuchte sie an guten Tagen, selbst dorthin zu fahren und zu öffnen, doch es konnte passieren, dass sie ihre Kräfte überschätzte: Ehe sie zur Tür kam, war der Besucher längst wieder weg, und für den Rückweg war sie zu schwach. Dann saß sie da mitten im Flur in ihrem Rollstuhl, schief und zur Seite gerutscht, und musste mitunter stundenlang warten, ehe der nächste Pfleger kam und sie aus ihrer misslichen Lage befreite.
Wenn ich sie am Sonntag besuchte, sahen wir fast immer zusammen Fernsehen. Das war unser Ritual. Da bei Käthe der Fernseher ohnehin fast ununterbrochen lief, konnte man sich zwanglos dazugesellen. Wir kommentierten, was wir sahen, oder plauderten ein wenig dabei. Sie liebte Reisereportagen, Natur- und Tierfilme, schreckte aber auch vor billigen Agenten- oder Monsterfilmen nicht zurück. Wir sahen alte amerikanische Serien wie »Bezaubernde Jeannie«, »Die Addams Family« oder »Verliebt in eine Hexe«. Da sie nicht gut hörte, dröhnte der Fernseher in der entsprechenden Lautstärke. Ich konnte gut verstehen, dass der Fernseher ihr bester Kamerad war. Er war immer da. Im Gegensatz zu den Pflegekräften, die nach zwanzig Minuten zum nächsten Bedürftigen eilen mussten und fast immer abgehetzt waren, im Gegensatz zu mir, der sich einmal in der Woche für zwei Stunden blicken ließ, oder im Gegensatz zu ihren Verwandten, die sie besuchten. Es gibt viele alte Menschen, die viel isolierter als Käthe sind, dennoch verbrachte sie unendlich viel Zeit allein. Und da wurde eben der Fernseher ihr zuverlässiger, treuer Begleiter, ihr Tor zur Außenwelt. Auch im Schlafzimmer stand ein Gerät, das sie einschaltete, sobald sie am frühen Abend ins Bett gebracht worden war.
Im Sommer schob ich Käthe manchmal auf ihren Balkon, wo wir Schach spielten. Da sie kaum an die Sonne kam, musste man ihr Gesicht und die Arme gründlich eincremen oder sie in den Schatten setzen, sonst bekam sie ganz schnell einen Sonnenbrand. Sie ließ es sich nicht nehmen, ihre Blumen zu beschneiden und verwelkte Blüten abzupflücken. Sie tat alles, um so etwas wie Autonomie zu bewahren, auch wenn sie vollkommen abhängig war und nicht einmal allein zur Toilette gehen konnte. So wurde der Schreibtisch ihre kleine Welt, ein Kosmos, an dem alles seinen festen Platz hatte und einnehmen musste. Das Telefon, Postkarten, Fernsehzeitschriften, Scheren, Stifte, Lupen, Klebestifte, Brieföffner, Spiegelchen, Schmierpapiere, Servietten, Medikamente, verschiedene Greifwerkzeuge und Teleskopstöckchen, mit denen sie ihr kleines Reich dirigierte. Wenn man in diese Ordnung eingriff oder sie durch Unachtsamkeit oder Flüchtigkeit störte, wurde sie ungehalten, sie dirigierte einen dann so lange, bis das Ding wieder seinen angestammten Platz gefunden hatte und für sie erreichbar war.
Ich besuchte Käthe viereinhalb Jahre lang. Ich konnte ihr sicherlich nicht immer alles geben, was sie sich von mir wünschte, aber ich habe versucht, sie zu begleiten. Ich brachte ihr Blumen mit oder Weinbrandbohnen. Wenn ich eintrat und sie fragte: »Na, Käthe, was gibt’s Neues?«, entgegnete sie gewitzt: »Was soll’s Neues geben? Das Alte ist noch nicht alle!«
Eines Tages, als ich sie wieder einmal am Sonntag besuchen wollte, war sie nicht da. Die Wohnung war leer, alle Lichter aus. Mir wurde mulmig. Ich rief auf der Sozialstation an und erfuhr, dass sie im Krankenhaus lag, ihr Zustand hatte sich verschlechtert.
Nach einer Woche war sie wieder da und lebte ihr Leben. Sie gab so schnell nicht auf. Sie beklagte sich, dass ich sie nicht im Krankenhaus besucht hatte, und dann sahen wir wieder fern. Doch sie wurde über Monate und Monate immer schwächer. Noch einmal musste sie ins Krankenhaus: Sie bekam unvermittelt starkes Nasenbluten, der ganze Schreibtisch war voller Blut, und sie war zu schwach, jemanden anzurufen. Ihr Kopf hing kraftlos herab und sank auf den Tisch. So vergingen einige Stunden, ehe eine Nachbarin, die auch einen Schlüssel hatte, sie fand. Doch Käthe kehrte wieder zurück.
Wieder ging eine Woche zu Ende, und ich machte mich mit schlechtem Gewissen auf den Weg zu Käthe, weil ich unsere Verabredung zuletzt zweimal hatte ausfallen lassen müssen. Wirklich? Musstest du? Ging es nicht anders? Wenn mit ihr alles in Ordnung war, dann sah ich schon von außen das helle Neonlicht, das immer eingeschaltet war. Das hieß, dass sie an ihrem Schreibtisch saß und Fernsehen schaute. Heute jedoch war das Licht aus. Ich öffnete die Tür und fand Käthe noch im Schlafzimmer. Sie lag in einem extra herbeigeschafften Bett, das offenbar besser geeignet war, um sie darin zu versorgen und zu pflegen. Ich hatte sie drei Wochen nicht gesehen. Sie schlief. Mir schien es so, als ob sie starb. Ihr Kopf war nach hinten gebogen, wirkte überdehnt. Sie trug kein Gebiss, und dadurch wirkte das ohnehin abgemagerte Gesicht noch ausgezehrter, die Knochen traten stark hervor, ihre Gesichtszüge verschwanden hinter dem Schädel, der jetzt aus dem Fleisch hervortrat und von Tod sprach. Ich hielt diesen Anblick nicht lange aus. Sie atmete schwer, ihr Brustkorb hob und senkte sich, als ob eine große Last auf ihm liege. Ihr Mund stand offen, ihre Lippen waren rissig. Ich hatte Angst, dass sie plötzlich erwachte, dass sie mich anblicken und nicht erkennen würde. Ich dachte, sie wäre jetzt eine ganz andere, die mich mit bitterer Stimme fragen würde, wo ich denn in der letzten Woche gewesen sei. Ich wagte nicht, sie zu berühren.
Ein paar Tage später wiederholte ich meinen Besuch, aber auch diesmal schlief sie und registrierte mich nicht. Als ich aus dem Haus trat, traf ich eine ihrer Pflegerinnen. Ja, es ginge ihr sehr schlecht, sagte sie, sie vermied es aber auffällig, vom Sterben zu sprechen. Ich ging dann nicht wieder hin. Wagte es nicht. Ich fuhr nur vorbei. Es war jetzt immer dunkel. So vergingen einige Wochen. Da erreichte mich eines Tages ein Anruf. Es war ihr Sohn. Ich war nicht zu Hause, und so hinterließ er eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. »Ich weiß nicht«, sagte er, »ob ich jetzt richtig bin, aber ich glaube, Sie waren ein bisschen mit meiner Mutter befreundet. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass meine Mutter gestorben ist. Der Termin für die Beerdigung steht noch nicht fest.« Das war’s. Ich versuchte nicht herauszufinden, wann die Beerdigung stattfinden würde.
Einige Wochen später traf ich beim Einkaufen in meinem Viertel Käthes Lieblingspflegerin, die sich auch die meiste Zeit um sie gekümmert hatte. Sie erzählte mir, dass Käthe schließlich zu Hause gestorben sei. Und Käthe hatte Glück: Als sie starb, war sie nicht allein, sondern ihre Pflegerin hielt ihre Hand.
Ich will nicht mehr vor dem Sterben davonrennen. Vor dem Tod. Auch deshalb will ich dieses Buch schreiben.
»Was gibt’s Neues, Käthe?«
Meine Nachbarn, die Toten
Es hat die ganze Nacht geregnet. Schwere Tropfen, die laut auf das Zink der Fenstersimse schlugen. Es ist Ende Oktober. Zerstörte Regenschirme in den Abfalleimern, ein verlorener Handschuh steckt auf der Spitze eines Zaunes. Die dreigezackten Platanenblätter liegen in großen, feuchten Haufen auf Straßen und Bürgersteigen. Auch Farben können sterben, denke ich, alles geht unter in einem braunen Brei. Die Formen lösen sich auf, die Blätter verklumpen. Gibt man nicht Acht, stürzt man leicht. Ein Leichenwagen fährt durch unsere schmale Straße, ich winke dem Fahrer zu.
Allerseelen steht vor der Tür, das Fest, an dem wir der Toten gedenken. Ich bin nicht nach Mexiko geflogen, was ich für kurze Zeit erwogen hatte. In Mexiko wird Allerseelen als »Dia de Muertos« gefeiert, laut, fröhlich, bunt, ausgelassen. Man lädt die Toten zu sich ein, besucht sie auf den Friedhöfen, feiert Feste mit ihnen und betrachtet sie so, als säßen sie unter uns. Jürgen, ein alter Freund, der eine Mexikanerin geheiratet hat, lebt inzwischen in Mexiko City und lud mich ein, ihn an diesen Feiertagen zu besuchen. Er erzählte mir von den Schaufenstern, die dann mit Totenschädeln und Gerippen geschmückt werden, von den Süßigkeiten für Kinder, die die Form von Knochen, Schädeln oder Skeletten haben, von kleinen Särgen aus Marzipan und Brot und Brötchen in Knochenform. Damit die Toten ihren Weg vom Friedhof in ihre Häuser finden, markieren die Familien den Weg mit Blütenblättern. Man errichtet zu Hause Altäre, die man mit Blumen, Kerzen und Heiligenbildchen schmückt, man kredenzt Tequila, stellt die Lieblingsspeisen des Toten bereit und vergisst auch Zigaretten nicht, sofern der Tote ein leidenschaftlicher Raucher war.
Doch einmal ganz davon abgesehen, dass ich ein leidenschaftlicher Stubenhocker bin und der Auffassung anhänge, dass sich das meiste Unglück vermeiden ließe, wenn die Menschen daheimblieben, waren es zuerst inhaltliche Überlegungen, die mich den Flug nach Mexiko absagen ließen.
Wenn wir, wie es immer so schön heißt, den Tod aus unserem Alltag verdrängen, dann will ich ihn doch auch dort suchen: In meinem Alltag, meinem Leben, in meiner Umgebung, meinem Viertel und in meiner Stadt. Natürlich werde ich Ausflüge machen müssen und Reisen unternehmen, aber in erster Linie will ich das Sterben in meiner nächsten Nähe entdecken und es vor allem aus meinem Blickwinkel betrachten. Ich will, bei all den Geschichten, denen ich begegnen werde, meine Individualität verteidigen, den subjektiven Faktor hochhalten, denn ansonsten hätte ich das Gefühl, dem Sterben und dem Tod auszuweichen, sie als Phänomene einer nüchternen Untersuchung zu beschreiben. Ich glaube nicht, dass ich mit diesem Beharren auf dem Ich, mit dieser Verteidigung meines Blicks, mich von der kollektiven Geschichte des Sterbens lösen, einen besonders originären Tod erzwingen oder Freund Hein zähmen kann. Jeder Tod stellt uns vor ein Rätsel, und jedes Sterben stellt ein perfides Wunder dar, auch wenn das Individuum in den Myriaden des Untergangs völlig versinkt, auch wenn das Töten im vergangenen Jahrhundert geradezu industrialisiert wurde und auch wenn nur eins gewiss ist: Wir müssen sterben. (Ein Satz, der in dreihundert Jahren vielleicht dröhnendes Gelächter auslöst, weil der Tod bezwungen ist.) Dennoch werde ich bei der Suche nach meinem »Gegenstand« an meinem Erleben festhalten, denn ich habe nur dieses Leben zu verteidigen und habe nur meinen Tod zu sterben. Und wenn auch sonst alles in Zweifel zu ziehen ist, alles unsicher und ungeklärt, meinen Tod wird mir niemand streitig machen (oder vielleicht doch?), und ich muss mit niemandem um ihn konkurrieren.
Ich winkte den Leichenwagen, die durch unsere engen Straßen fuhren, erst seit kurzer Zeit zu. Die schwarzen Wagen nahmen immer dieselben Wege und verschwanden plötzlich in einer unscheinbaren Toreinfahrt mitten zwischen den Altbauten. Kaum jemand hätte hier ein Bestattungsunternehmen vermutet. Im Hinterhof eines dicht bebauten Wohnviertels. Die Toten waren meine unmittelbaren Nachbarn, kaum hundert Meter von mir und meiner Familie gingen sie ein und aus. Kamen an. Lagen. Warteten. Zogen in Särge um. Wurden wieder weggefahren. Morgens sah man die schwarz gekleideten Männer auf dem Bürgersteig zusammenstehen, reden, rauchen. Zweimal in der Woche kam ein großer Lastwagen und lieferte Särge an. Die Straße war dann gesperrt, die bis zur Decke ineinandergestapelten Särge wurden ausgeladen und in den Hinterhof gefahren. Wenn sie am Nachmittag geliefert wurden, kam es hin und wieder vor, dass ich mit den Kindern vorbeikam. Als mein Sohn das erste Mal die Särge bewusst wahrnahm, blieb er stehen und beobachtete das Ausladen.
»Was machen die da?«
»Die Männer laden Särge aus!«
»Was sind das, Särge?«
»Wenn ein Mensch gestorben ist, legt man ihn in einen Sarg aus Holz, und dann wird er in dem Sarg beerdigt.«
»Damit er nicht friert?«
»Die Toten schlafen so fest, die frieren nicht.«
»Und wenn die aufwachen? Frieren die dann oder steigen die wieder aus?«
»Nein, Tote schlafen für immer, und der Sarg ist ihr Bett in der Erde.«
»Kann ich auch so ein Bett haben? Mit Deckel?«
Ich wusste also weder etwas über Tote noch über Särge. Ich konnte meinem Sohn keine vernünftige Erklärung anbieten. Ich musste an diesen Dialog zurückdenken, als ich das erste Mal durch die Toreinfahrt schritt, in der die Leichenwagen Tag für Tag eintauchten. Ich hatte mir vorgenommen, diese Welt zu erkunden. Ich wollte hier ein Praktikum machen. Den Toten begegnen. Das erste Mal einen Sarg tragen. Ich hatte mich vorher nicht angemeldet und wusste nicht, was mich erwartete.
Der Hof war leer. Sehr lang, sehr tief. Ein gieriger Schlauch, von Mauern umstellt. Links eine große Garage mit hohen, hölzernen Torflügeln. Rechts davon drei normale Garageneinfahrten. Dazwischen verengte sich der Hof noch einmal. Ich ging langsamer. Gab es kein Schild, keine Klingel? Wohin? Immer noch kein Mensch. Am Ende des Hofes führte eine Metalltreppe nach oben. Das Büro? Am Fuß der Treppe stand ein weiteres Tor offen, Särge stapelten sich. Ich blickte kurz hinein, ein Mann, schwarze Hose, weißes Hemd, stand mit dem Rücken zu mir, fegte den Raum aus. Wandte sich nicht um. Ich stieg nach oben. Mir war mulmig zumute. Ich war über mich selbst und das mulmige Gefühl überrascht. Vielleicht doch ein anderes Buch schreiben? Als ich oben eintrat, kamen mir zwei Sargträger entgegen. Wir gingen grußlos aneinander vorbei. Endlich das Büro.
»Guten Tag, ist der Chef zu sprechen?«
»Wie können wir Ihnen denn weiterhelfen?«
»Ich würde gerne den Chef sprechen? Ist er da?«
Der Mann hinter dem Tresen wendete den Kopf nach hinten, wo sich ein Mann mit Lesebrille über eine Akte beugte.
»Herr Eibe, da möchte Sie jemand sprechen!«
Der Chef. Kam mir entgegen. Wir standen im Flur. Die Sargträger drückten sich an uns vorbei. Tach und Tach! Ich stammelte etwas von Buchprojekt und Praktikum. Der Chef war geistesgegenwärtig genug, mich in sein Büro zu bitten. Ein Tisch, vier Stühle. Der Raum war klein, spartanisch eingerichtet. Als ich mich setzte, bot mir Herr Eibe einen Espresso an. Erst jetzt fiel mir die Espressomaschine in seinem Rücken auf. Der Raum lag im Halbdunkel, durch die Jalousien fiel trübes Licht.
Herr Eibe war gar nicht überrascht. Ich wäre da nicht der Erste, und ein Fotograf wäre auch schon mal da gewesen. Kein Problem, machen wir. Ich fühlte mich willkommen. Wurde aufgeklärt. Informiert. Mein erster Irrtum wurde korrigiert. Nein, nein, die Kurt Eibe KG, ein Familienbetrieb, der seit 1910 in dritter Generation geführt wurde, war kein Bestattungsunternehmen, sondern war vom Großvater als Lastfuhrwesen erworben worden. Daraus entstand 1928 das »Luxus-Braut- und Beerdigungsfuhrwesen«. Ich staunte über die geschäftliche Engführung von Bräuten und Beerdigungen. Irgendwann im Laufe der Firmengeschichte schienen die Bräute verschwunden zu sein. Aus Angst vor dem Tod? Heute war die Firma ein Bestattungsfuhrwesen, das die meisten Dienstleistungen, die der klassische Bestatter in seinem Büro an die Kunden verkauft, ausführte: Überführungen, Trägerdienste, Kondolenzdiener, Feierbetreuungen, Sarglagerhaltung, Behördenservice, Räume für Aufbewahrung und Abschiedsräume.