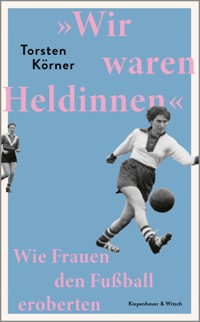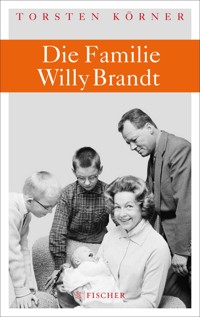8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Speisewagen - Ein Ort der überraschenden Begegnungen Torsten Körner reiste ein Jahr lang im Speisewagen durch das Land. Er beobachtete und sprach mit fremden Menschen, die mit ihm und anderen Reisenden ihre (Lebens-) Geschichten teilten. Egal, ob die Studentin, der Handwerker, die Rentnerin oder der Physikprofessor: Alle teilten sie ihr Schicksal, ihre Probleme, ihr Glück mit den Mitreisenden - wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. Dieses besondere Gesellschaftsporträt zeigt das wahre Gesicht der Bundesrepublik, jenseits aller Klassen- und Altersgrenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Torsten Körner
Geschichten aus dem Speisewagen
Unterwegs in Deutschland
Sachbuch
Über dieses Buch
Im Speisewagen der Bahn bereist Torsten Körner ein Jahr lang das Land, beobachtet und spricht mit Reisenden, die ihm und anderen ihre (Lebens-) Geschichten anvertrauen. Für wenige Stunden legen sie die Anonymität des Reisenden ab und geben Intimes aus ihrem Leben preis. Egal, ob Studentin, Handwerker, Rentnerin oder Professor: Sie alle erzählen nicht nur von ihrem Lebensglück, sondern teilen ihre Geheimnisse und Ängste mit völlig unbekannten Menschen. Von diesen besonderen Begegnungen erzählt Körners einzigartiges Gesellschaftsporträt, das das verborgene Gesicht der Bundesrepublik jenseits aller Klassen- und Altersgrenzen widerspiegelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hildendesign, München
Coverfoto: Pete Turner / Getty Images
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400719-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Stephan
Wie ich mich in den Speisewagen verliebte
Jagdfieber
Unter der Zirkuskuppel
Federvieh
Gestrandet
Gespenster
Ein Fenster aus Zeit
Westerland
Zu spät
Aus dem Fenster blicken
Mitteilungsdrang
Bella Italia
Die Stewards
Eigentlich nichts passiert
Augenblicksgeschichten
An die Grenze
Altes Scheusal
Lange Schatten
Darf ich dich anrufen?
Kinder an der Macht
Staub aufwirbeln
Bitte verlassen Sie diesen Raum
Fernweh
Heimspiel
Kleine Speisen
Gas geben, reicht nicht
Verstehen Sie mich?
Große Jungs
Hürdenläufer
Pechsträhne
Nachtschicht
Stille Nacht
Rettet den Speisewagen!
Danksagung
Für Stephan
Wie ich mich in den Speisewagen verliebte
Autos sind was für Solisten. Im Flugzeug schweigen Sardinen vor sich hin. In der Bahn jedoch findet man Platz (meistens), Geschichten und Menschen. Natürlich regt man sich über die Bahn gerne mal auf, über Verspätungen, überfüllte Züge, aber das zeigt nur, welche Bedeutung sie hat, welchen Stellenwert sie in unserem Leben einnimmt. Sie ist mehr als ein Verkehrsmittel, sie ist eine Existenzform. Mich hat die Bahn bisweilen aufgeregt, aber das Bahnfahren hat mich fast immer angeregt. Wenn man ehrlich ist, regt man sich ja nicht so sehr über die Bahn auf, sondern über die Menschen, die mit ihr unterwegs sind, ihre Manieren, ihre Eigenarten, ihr Verhalten. Und dieses Unterwegssein mit Fremden habe ich immer als Abenteuer erlebt, als Eintauchen in eine Fremde, die lästig und unbequem sein konnte, aber viel häufiger spannend, abwechslungsreich, interessant und bereichernd.
Ich gebe zu – es ist allerdings viele Jahre her –, dass ich, wenn ich in den Zug einstieg, so lange durch die Waggons wanderte, bis ich mich neben, vor oder hinter ein anziehendes Mädchen setzen konnte. Dann versuchte ich herauszufinden, was sie las, ob sie meine Blicke erwiderte und ob sie Lust auf ein Gespräch hatte. Manches Mal, wenn mir ein Mädchen gegenübersaß, das mir gefiel, fand ich nicht das richtige Wort. Rückblickend würde ich sagen, man denkt viel zu lange über das richtige erste Wort, den richtigen ersten Satz nach. Die Strecke ist wichtig, nicht der Start.
Ich entwarf im Kopf kleine Dialog-Dramen, bei denen sich ein Satz harmonisch in den anderen fügte, komödiantische Satzwechsel, die immer damit endeten, dass man Adressen austauschte, sich unendlich sympathisch fand, sich unsterblich ineinander verliebte und ewige Treue schwor. Meistens kam es anders.
Einmal jedoch waren keine Worte im Spiel. Es war im Winter 1989, die Mauer war gerade gefallen. Ich studierte seit einigen Monaten in Berlin und fuhr – da ich noch keine eigene Wohnung hatte – am Wochenende manches Mal zurück in mein Dorf nach Norddeutschland. Am späten Sonntagnachmittag ging es dann zurück nach Berlin. Der Bahnhof in Ocholt besaß einen Fahrkartenschalter, wo hinter dickem Glas ein Mann in blauer Uniform ruhte, vier Gleise, zwei Bahnsteige, einige altersschwache Bänke und einen Betonwürfel zum Unterstellen. Eine Reihe von riesigen windschiefen Pappeln neigte sich fragwürdig über die Gleise. Damals gab es noch einen durchgehenden Zug, der von Norddeich/Mole bis nach Berlin fuhr, ein Regionalzug, der an fast jeder Milchkanne hielt.
Als ich in Ocholt zustieg, war der Zug überfüllt, viele Reisende standen in den Gängen und hatten aufgegeben, einen Sitzplatz zu suchen. Ich hatte Glück. In einem Abteil für sechs Personen – die Polster waren ockerfarben, braun und orange gestreift – fand ich am Fenster einen freien Sitz. Mir gegenüber saß eine junge Frau, die aber immer noch einige Jahre älter als ich gewesen sein mochte. Sie hatte langes aschblondes Haar, ein schmales Gesicht und war hochgewachsen. Als ich mich ihr gegenübersetzte, lächelte sie. Es brauchte keine Worte. Es war eng im Abteil. Neben ihr saß ein älterer Mann, der mehrere Jacken übereinander trug und keineswegs gewillt war, auch nur eine einzige abzulegen. Er saß wie eine aufgequollene Riesenbohne in seinem Sitz. Neben mir wiederum saß eine fidele Großmutter, die allen Butterkekse anbot und die Bilder ihrer zahlreichen Enkelkinder kreisen ließ. Sie führte derart viel Gepäck mit sich, dass nicht alles oben auf der Gepäckablage Platz gefunden hatte, und so war meine Beinfreiheit durch eine ihrer wulstigen Taschen eingeschränkt. Daher wurden vier Beine, unsere, die sonst sorgsam Distanz gewahrt hätten, geradezu zusammengezwungen. Sie kamen ins Gespräch, Schienbein und Wade, Knöchel und Knöchel, Knie und Unterschenkel. Unsere Beine flossen immer mehr ineinander und das stetige Vibrieren des Zuges tat ein Übriges. Draußen war es jetzt dunkel, fast alle anderen schliefen, selbst der fidelen Großmutter waren irgendwann die Augen zugefallen. Nur in der äußersten, gegenüberliegenden Ecke hatte sich ein Mann hinter seiner Zeitung verschanzt und das Licht über seinem Kopf angeknipst. In dieser schummrig-schläfrigen Höhle achtete niemand auf uns und niemand merkte, wie unsere Beine immer vertraulicher kommunizierten. Wenn der Zug hielt, Bad Zwischenahn, Oldenburg, Hude, Delmenhorst, Bremen, Verden, zogen wir das Fenster herunter, standen auf, stellten uns nebeneinander, und jetzt waren es unsere Arme, die sich berührten. Sobald der Zug anfuhr, sanken wir zurück und wieder fanden sich unsere Beine. So ging es bis Berlin. Wir stiegen aus, kein Wort. Als wir auf dem Vorplatz vom Bahnhof Zoo standen, setzten wir unsere Taschen ab und fingen an, uns zu küssen. Wir küssten uns lange. Schließlich löste sie sich, winkte ein Taxi heran.
»Ich muss dann mal los!«, sagte sie.
»Ich auch! Andere Richtung!«, antwortete ich.
Das mit den Mädchen hat sich im Laufe der Jahre erledigt, obwohl ich nichts dagegen habe, neben einer gut aussehenden Frau zu sitzen. Wichtiger ist mir jedoch dieser angenehme Schwebezustand, in den mich das Bahnreisen immer noch und immer wieder versetzen kann. Man fährt ab und los und löst sich für eine gewisse Zeit von seinen vertrauten Bindungen. Auch wenn ich nur von Berlin nach Hamburg fahre – die Fahrt dauert nicht einmal zwei Stunden –, habe ich das Gefühl, ich reise. Kaum bin ich in Hamburg angekommen, habe ich Lust weiterzufahren. Ich komme gar nicht so gerne an, viel lieber bin ich unterwegs. Ich sitze gerne im rasenden Dazwischen, die Landschaft und mein Leben ziehen wie ein Film an mir vorüber. Das Drinnen und Draußen verbindet sich zu einem Bild, das so lebendig und voller Tiefe ist, dass ich glaube, ich könnte hineinspringen, darin umherwandern und die merkwürdigsten Abenteuer erleben. Ein unerklärliches Heimweh erfasst mich, Heimweh nach der Fremde, eine Sehnsucht, mich an völlig unbekannten Orten einzurichten oder in ein völlig fremdes Leben einzutreten. Ich möchte fremd-gehen, fremd-fahren, nicht in einem engen geschlechtlichen, sondern in einem weiten biographischen Sinne, in die Fremde gehen, mich fremd finden, mich in der Fremde wiederfinden oder gewinnbringend verlieren. Das ist Erotik ohne Sex.
Wir überqueren einen Bahnübergang, Autos warten hinter den heruntergelassenen Schranken, und für einen winzigen Augenblick blickt man in ein vollkommen unbekanntes Gesicht, das einen aber magnetisch anzieht, das lockt, das eifersüchtig macht auf dieses Leben, das ein anderer führt, ganz ohne dich. Und schon ist man weiter, Kilometer um Kilometer, und muss sich damit abfinden, dass man dieses Gesicht niemals wiedersehen wird. Einmal im Leben, ich werde es tun, die Notbremse ziehen, auf freiem Feld aussteigen und dem fremden Gesicht hinterherlaufen und – es natürlich nicht finden. Ich, das ist immer auch ein anderer, der gerade unterwegs ist wie ich, aber nie bei mir ankommt.
Je häufiger ich mit der Bahn fuhr – und mein Beruf als Autor brachte es mit sich, dass ich sehr viel mit der Bahn unterwegs war –, desto mehr fing ich an, den Speisewagen als meinen Ort zu betrachten. Sicher, manches Mal war er ein Zufluchts- und Ausweichort, weil man nirgendwo anders mehr Platz fand. Im Speisewagen hingegen war fast immer was frei und der Zwang, etwas konsumieren zu müssen, hielt sich in Grenzen. Mit zwei Bechern Tee oder zwei Flaschen Bier konnte man schon mal vier oder fünf Stunden unbehelligt auf seinem Platz verweilen. Im Gegensatz zum engeren Abteil oder zum Großraumwagen bieten die Panoramafenster des Speisewagens zudem einen kinoartigen Blick auf die Landschaft, das Land selbst bekommt ein Gesicht und man wird auf einmal vertraut mit Gegenden, die gar nicht zu uns gehören, die aber doch Heimat sind oder werden, wenn wir sie durchqueren und im Zeitraffer mit uns verknüpfen. Und während draußen die Landschaft wie ein Film am Reisenden vorüberzieht, bietet sich ihm im Speisewagen ein Schauspiel, denn der Speisewagen ist nichts anderes als eine Bühne, auf der wir uns bewegen, spielen, darstellen und ganz nebenbei auch noch essen. Es gibt Reisende, die sich in einen Winkel setzen, und man sieht es an ihrer Körperhaltung oder an der Art und Weise, wie sie ihre Ich-Utensilien um sich herum verteilen (Tasche, Handy, Zeitung), dass sie ganz für sich und bitte ungestört sein wollen. Die Mehrzahl der Reisenden aber hat nichts gegen ein Gespräch einzuwenden, zumal schon die Anordnung der Sitze im Speisewagen darauf angelegt ist, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. An den Zweiertischen muss man geradezu miteinander reden; es ist in diesem kleinen intimen Raum tatsächlich anstrengender, sich anzuschweigen, als ein wenig miteinander zu plaudern.
Was mir im Speisewagen immer wieder gefiel, war die Begegnung von ganz unterschiedlichen Menschen und Biographien. Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten, die sich im Alltag sonst nie begegnen würden, die nie miteinander sprechen würden, weil ihre Leben einfach räumlich nicht aneinander stoßen, kommen ins Gespräch, obwohl und gerade weil sie so unterschiedlich sind. Die Münchner, sagt man, haben ihre Biergärten, in denen soziale Gegensätze ausgeglichen werden, die Kölner finden in ihren Brauhäusern zusammen, und das Land hat den Speisewagen, vielleicht einen der letzten Orte, wo sich Arbeitslose und Manager zuprosten. Der Speisewagen ist eine Art Restaurant, ein Bistro, er ist aber auch eine Kontaktbörse, ein Flirt-Pool, ein rasender Stammtisch, ein Landschaftskino, mitunter ein Beichtstuhl, ein mentales Entlastungsstübchen, ein Halt im Haltlosen. Draußen fließt die Landschaft vorbei und selbst Menschen, die gegen poetische Schwingungen ganz unempfindlich sind, geraten mitunter in nachdenklichere Stimmungen. Im Speisewagen schüttet mancher sein Herz einem Fremden aus, obwohl er zu Hause als maulfaul und verschlossen gilt. Man spricht zum großen Nimmerwiedersehen, man labt sich am Fremdsein des Gegenübers. Der Fremde hört zu, nickt wohltuend und steigt nach zwei Stunden Gespräch aus. Er verliert sich in einer fremden Stadt, einem unbekannten Leben und Wirkungskreis. Und er trägt von da an ein Stück von mir in die Fremde.
Vor vielen Jahren fuhr ich einmal mit der Bahn nach Italien, die Fahrt ging über München. Ich war am frühen Abend in den Zug gestiegen und freute mich auf die bis dahin längste Bahnfahrt meines Lebens. Ich ging in den Speisewagen, um ein Bier zu trinken. Am Nebentisch saß ein Mann, der augenscheinlich schon betrunken war. Gerade als ich mich gesetzt hatte, stand ein Mann auf, der bis dahin mit dem Betrunkenen am Tisch gesessen hatte. Ob die Männer bereits sehr lange oder erst seit kurzer Zeit zusammengesessen hatten, war für mich nicht auszumachen. Der Betrunkene starrte dem Mann, der so abrupt aufgesprungen war, nach und rief ihm hinterher »Und Ihre Frau wird Sie auch betrügen, da können Sie Gift drauf nehmen!« Der Steward – früher nur »Kellner« genannt – kam und bat den Mann, sich zu mäßigen. Der Betrunkene bestellte noch ein Bier. Er sackte jetzt in sich zusammen und ich hatte Gelegenheit, ihn ungestört zu betrachten. Er war etwa fünfzig Jahre alt, hatte dichte schwarze Haare und trug einen dunklen Anzug. Auf den Knien lag eine schwarze Aktentasche, deren Leder schon recht abgeschabt war. Der Mann wirkte gepflegt, aber insgesamt ebenfalls etwas abgetragen, abgelebt. Die Haut war dünn und fahl. Das Gesicht war schmal und die Schultern hingen schlaff nach vorn. Er sah aus wie eine vielfach gestempelte, hin und her und in die Irre geschickte, stark ausgeblichene Briefmarke. Er knetete seine Hände ohne Unterlass, so als ob er sie waschen würde. Dann fummelte er an seinem Ehering herum. Er zog ihn ab und dann gleich wieder an. Das ging eine ganze Weile so. Schließlich streifte er den Ring endgültig ab, ließ ihn liegen, rief »Stimmt so!«, erhob sich und torkelte davon. Der Steward kam, schüttelte den Kopf und fragte die anderen Gäste, wohin der Betrunkene gegangen sei. Den Rest der Geschichte kenne ich nicht, der Mann blieb für mich verschwunden, und ich weiß nicht mehr, ob ich noch sitzen blieb, mich in den Gang stellte und rauchte (das ging damals noch) oder ob ich versuchte, zu schlafen.
Nun kann man im Speisewagen aber nicht nur jemanden kennenlernen, miteinander sprechen oder essen, nein, man kann sich hier – in Gesellschaft – auch viel besser einsam, isoliert, ausgestoßen oder verlassen fühlen. Wer unter Liebeskummer leidet, an Heim- oder Fernweh, wer an seinem Leben, so wie es ist, zweifelt und an sich selbst Anstoß nimmt, findet im Speisewagen Linderung durch ein Vollbad an Melancholie. Ich trinke tagsüber in der Regel keinen Alkohol, aber im Speisewagen mache ich davon gelegentlich eine Ausnahme, denn es genügt schon ein Glas, um den Rausch des Unterwegs- und Verlorenseins zu verstärken. Und wenn man ohnehin angeschlagen ist – Gibt es mich eigentlich noch? Was will ich? Wer liebt mich? Wohin geht meine Reise? Ist wenigstens die Katze treu? –, verbinden sich der Flatterblick auf die Landschaft, die schaukelnde Geschwindigkeit, der Schwebezustand des Reisens und die kleine Dosis Alkohol zu einem grandiosen existentiellen Schwindel, der einem auf eine äußerst angenehme Art und Weise den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ich erinnere mich an eine Frau, die im Speisewagen allein an ihrem Tisch saß, eine Flasche Bier stand vor ihr, eine Schachtel Zigaretten lag daneben. Aber sie trank und rauchte nicht. Sie hatte den Kopf an die Scheibe gelehnt und weinte. Schnee deckte die Landschaft zu, es war kurz vor Weihnachten. Obwohl der Speisewagen sehr voll war, setzte sich niemand zu ihr, dabei war ihr Weinen keineswegs auffällig. Sie schluchzte nicht, sie schüttelte sich nicht, gab keinen Laut. Saß ganz still, fast entspannt. Nur die Tränen liefen. Selbst der Steward hielt sich zurück, sie anzusprechen. Irgendwann stand sie auf, ließ ein Fünfmarkstück auf dem Tisch liegen. Die Flasche Bier war noch voll.
Die offizielle Bezeichnung für Mitarbeiter in der Bordgastronomie ist übrigens »Restaurant-Steward«. Dabei wird im offiziellen Sprachgebrauch – etwa in Stellenausschreibungen der Bahn – nicht zwischen »Steward« und »Stewardess« unterschieden. Um jedoch der Alltagssprache näher zu sein – kein Gast im Speisewagen würde »Steward, zahlen bitte!« rufen – und um aufdringliche Assoziationen an Flugreisen (»Stewardess«) zu vermeiden, werden in diesem Buch wahlweise auch angestammte Begriffe wie »Kellner« oder »Kellnerin« verwendet, ohne damit irgendeine Wertung vorzunehmen. Allerdings trifft auch das Wort »Kellner« das Wesen der »Mitarbeiter in der Bordgastronomie« nicht ganz, denn es teilt nichts von Bewegung und Reise mit. In unserem Vorstellungsraum gehört der Kellner zu einem bestimmten Ort und Lokal, in der Bahn jedoch ist er oder sie im Unterwegs zu Haus und bedient auf der Strecke.
Ich habe mich schon als Schüler und Student immer in den Speisewagen gesetzt, vorausgesetzt, ich hatte Geld und ein Platz war frei. Er hat mich selten enttäuscht, er war Flucht- und Fundort, er war Zeitmaschine und Geduldsspiel, Museum verflogener Hoffnungen, Labor für kommende Träume und biographische Bastelwerkstatt. Wenn ich auf all diese Fahrten und Erlebnisse heute zurückblicke, ärgere ich mich, dass ich sie nicht festgehalten habe, all die Menschen, die ich traf, die Geschichten, die man sich anhörte oder sah, die Stimmungen oder Atmosphären, die sich breitmachten und den Speisewagen beherrschten. Geschichten aus dem Alltag und die Geschichte des Alltags. Wie viele Romane, wie viele Kultur- und Gefühlsgeschichten habe ich verpasst, welche Geheimnisse versäumt? Was für Einsichten und Ausblicke habe ich fahrlässig verschenkt? Jeder Mensch lebt viele Romane! Geblieben sind mir Fragmente, Impressionen, einige Gesichter, ein paar Fetzen Biographie.
Lässt sich das rückgängig machen? Wohl kaum! Aber vielleicht kann man es noch einmal anfangen, anders beginnen und all die Geschichten bergen, die sich sonst im Schienenmeer verlieren würden. Ich habe mir eine Netzkarte gekauft, mit der ich ein Jahr lang in jeden Zug steigen und jederzeit innerhalb Deutschlands losfahren kann. Ich will gar nicht wissen, wo ich ankomme, ich werde die Fahrpläne nicht studieren, sondern die Begegnungen. Ich werde mich in den Speisewagen setzen und alles probieren. Speisen, Gespräche, Menschen, Blicke, Worte, Bilder, Energien, Zeichen jedweder Art, Geschwindigkeiten, ich werde mich einmischen, zuhören, belauschen, beobachten. Ich schreibe das auf.
Und lege mein Ohr auf das Gleis der Geschichten und fahre jetzt jeden Tag fremd. Einsteigen, bitte!
Jagdfieber
»Ich muss Sie jetzt leider verjagen!« Das ist also der erste Satz, mit dem man mich empfängt! Ein zu Herzen gehender, erfrischender Auftakt. So sollte jede Reise beginnen. »Ich muss Sie jetzt leider verjagen! Das sind unsere Plätze!« Sie hat es noch einmal gesagt, und wie zur Bekräftigung baut sich jetzt eine halbe Hockey-Mannschaft pubertierender Jungen hinter ihr auf. Sie ist eine hochgewachsene, gut aussehende blonde Frau, Typ Hamburger Kaufmannsgattin, die weiß, was sie für ihr Geld erwarten darf. Sie hat jetzt einen ganz strengen Zug um den Mund, als hätte ich ihre Handtasche stehlen wollen.
»Verjagen müssen Sie mich nicht, es reicht, wenn Sie mich bitten!«, antworte ich und stehe auf. Wir befinden uns in der 1. Klasse im Großraumwagen des ICE von Berlin nach Hamburg. Die Platzreservierungen wurden nicht ausgewiesen. Es ist ein Irrtum zu glauben, in der 1. Klasse ginge man zivilisierter miteinander um. Dabei hatte die Fahrt gut begonnen.
Auf dem Bahnsteig hatte ich Henning getroffen, einen jungen Mann, der vor fünfzehn Jahren in einem Tutorium gesessen hat, das ich geleitet hatte. In dieser kleinen Arbeitsgruppe wiesen wir älteren Studenten die jüngeren Semester in das Thema »Experimentelle Literatur« ein und erarbeiteten mit ihnen gemeinsam Referate. Der Professor des Seminars war ein kleiner, untersetzter Mann mit eisgrauem Bart, der, wenn die Studenten zu lange nichts sagten, seine Tasche auf das Pult schmetterte und ausrief: »Wenn Sie schweigen, kann ich das auch!« Dann ging er.
Henning war erstaunt, dass ich seinen Namen noch wusste. Ich staunte auch, aber Henning war ein angenehmer Mensch, keiner, den man vergessen musste. Er war inzwischen verheiratet, arbeitete als Buchhändler in einem Berlin Kulturkaufhaus und spielte in seiner Freizeit in einer Heavy-Metal-Band. Er lud mich zu einem seiner Konzerte ein. Wir verabschiedeten uns herzlich.
Ich habe mich inzwischen eingerichtet, die Hockey-mannschaft auch, ihre Kellen liegen im Gepäckfach. Einige spielen Karten, einer sieht auf einem Laptop einen Spielfilm, einer liest, ein anderer schreibt SMS, einer zerbeißt krachend Chips. Von meinem Platz aus kann ich in den Vorraum des Großraumwagens sehen, dort, wo die Toiletten sind und die Werbeplakate hängen. Vor den Abteilen der 1. Klasse hängen Werbeplakate für Mittel gegen Harnbeschwerden. Gibt es da einen Zusammenhang? Leiden einkommensstarke Führungskräfte eher an Prostata-Beschwerden? Werden überhaupt unterschiedliche Plakate vor der 1. und 2. Klasse geklebt? Das Plakat zeigt einen drahtigen Mittfünfziger, der unwiderstehlich lächelt. »Auch unterwegs weniger Müssen müssen!« Toll! Da hat aber ein Werbetexter schelmisch um die Ecke gedacht. Weniger Müssen müssen! Das wollen wir ja eigentlich alle, ob wir es jetzt an der Blase haben oder nicht.
Ich gehe in den Speisewagen. Besteck klappert. Es ist halb drei. Der Speisewagen ist gut gefüllt. Einige Reisende haben dicke Bücher vor sich auf den Tisch gelegt, versunken in phantastische Reiche. Einer löffelt Suppe, einer hat Kopfhörer im Ohr. Ich setze mich an einen Zweiertisch, an dem ein Mann sitzt, Mitte vierzig. Dunkle längere Haare. Dunkler Teint, braune Augen, schmale lange Finger. Wir grüßen uns kurz, er nickt einladend. Mein Blick fällt auf ein anderes Werbeplakat am Eingang zum Speisewagen. Da wird für einen Elektrorasierer von Braun geworben. »Sieger erkennt man an ihrer Ausstrahlung!« Dazu das amtliche Siegel in Rot »Testsieger (1,6)«. Ich rasiere mich nass, fahre mit der Hand über mein Kinn und frage mich, was ich ausstrahle. Ob sich mein Nachbar elektrisch rasiert? Vielleicht ist es wirklich so einfach im Leben? Sieger elektrisch, Verlierer nass! Mein Gegenüber liest, sporadisch, es sieht so aus, als ob er die Sätze wie eine Medizin zu sich nimmt, immer nur kleine Dosen, zwei, drei Sätze, mehr nicht. Dann schaut er wieder auf und sieht zum Fenster hinaus. Das Buch stammt von einem Autor namens Suzuki, es heißt »Die große Befreiung« und ist, so verkündet es zumindest der Untertitel, eine Einführung in den Zen-Buddhismus. Wovon will sich der Mann befreien? Aber bevor ich den Mann etwas fragen kann, schließt er die Augen und lehnt seinen Kopf an die Scheibe. Zuvor hat er sich türkisfarbene Stöpsel in die Ohren gesteckt und dann einen ebenfalls türkisfarbenen Schal über den Kopf gelegt und wie ein Kissen zwischen sich und die Scheibe geschoben. Wie lange wird diese fragile Konstruktion halten?
Die Landschaft draußen ist winterlich kahl. Die Bäume sehen verdrossen aus, eine dünne Schneeschicht liegt über den Feldern. Wohin man auch blickt, überall Hochsitze. Deutschland scheint ein Volk von Jägern zu sein, Stillsitzer und Auflauernde überall. Es gibt gedrungene Hochsitze, Ein- oder Zweisitzer, es gibt hohe schmale Hochsitze, solche, die allein stehen, andere lehnen sich an einen Baum, manchmal stehen sich zwei auf einem Feld gegenüber. Manche sind nach vorne offen, andere sind zu allen Seiten geschlossen, offenbar gibt es eine Tür. Man kann die Hochsitze, an denen man vorbeirast, kaum zählen. Jetzt sehe ich sogar einen mobilen Hochsitz auf Anhänger mit vier Rädern. Nur ab und zu entdeckt man ein stilles Reh, das vor der Übermacht der Hochsitze kapituliert und sich in sein Schicksal ergibt. Da, ein Fuchs! Er läuft über ein Feld mit tiefen Ackerfurchen, rauf und runter geht es, er sieht aus wie ein Ruderboot in schwerer See. Auf keinem der Hochsitze ist ein Mensch zu sehen. Nur vor einem umgestürzten Hochsitz steht ein Mann mit seinem Hund, die Hände auf den Rücken gelegt und betrachtet den Schaden. Alles da draußen ist grau, braun, fleckig weiß. Wohltuend gelb leuchtet ausnahmsweise ein Hinweisschild, es gibt hier offenbar in der Nähe einen Ort, der heißt »Kummer«.
Der Mann mir gegenüber schlägt jetzt wieder die Augen auf, lange hat er diese Position nicht beibehalten können. Er trinkt grünen Tee.
»Können Sie den Tee empfehlen?«
»Ja«, erwidert er, »der schmeckt wirklich angenehm!«
»Entschuldigen Sie meine Neugier, sind Sie Musiker?«
Er ist verblüfft, ich verschweige, dass ich ein Notenblatt gesehen habe, das aus seiner Tasche geragt war.
»Ja, wie kommen Sie darauf?«
»Ich weiß nicht genau, Sie tragen so einen Musikerschal« – er sieht seinen Schal verwundert an –, »und die Farben Ihrer Ohrstöpsel sind die gleichen wie die Ihres Schals. Außerdem lesen Sie ein Buch über Zen-Philosophie. Sie sind auf Harmonien aus, oder?«
»Ich bin Pianist!«
»Und was für Musik spielen Sie so?«
»Ich bin klassisch ausgebildeter Pianist! Ich unterrichte in Berlin und pendle zwischen Hamburg und Berlin. Und was machen Sie?«
»Ich bin Journalist. Zurzeit schreibe ich am liebsten in der Bahn, da kann ich mich am besten konzentrieren. Klingt komisch, oder!«
Das scheint ihn jedoch kein bisschen zu verblüffen.
»Nein, gar nicht. Ich saß mal im Flugzeug neben Wim Wenders, der mir erzählte, er könne am besten im Flugzeug arbeiten und die meisten Drehbücher hätte er während langer Flugreisen geschrieben.«
»Vielleicht sind seine Filme im Lauf der Zeit deshalb so langatmig geworden!«
Er geht auf den Witz nicht ein. Vielleicht schätzt er gerade die meditativen Filme des Regisseurs Wim Wenders?
Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir fahren schon durch Hamburg-Billbrook. Gleich kommen wir am Hauptbahnhof an. Jetzt hätte ich wegen der lebhaften Unterhaltung fast die Zeche geprellt, der Steward zupft mich am Ärmel.
Der Winter hat sich eingerichtet. Dauerfrost. Schneegestöber. Ich bin auf dem Weg nach Köln. Sitze in der 1. Klasse im Großraumwagen. Früher hatte ich immer gedacht, die 1. Klasse sei etwas für Genuss-Reisende, sie stünde für Behaglichkeit, Komfort, entspanntes und ausgeruhtes Reisen, für lange Strecken und Urlaubsbeginn. Mittlerweile habe ich einen anderen Eindruck gewonnen. Zumindest tagsüber ist die 1. Klasse ein mobiles Büro für alle möglichen Geschäftsleute, die hier telefonieren, Termine verabreden, Konflikte schlichten, Konzepte entwerfen, Gutachten erstellen, Mitarbeiter delegieren, Akten ordern, Treffen nacharbeiten, Chancen sondieren. Man ist kaum sicher vor dieser geschäftig lautstarken Betriebsamkeit. Zu dieser Tageszeit scheint die Mehrzahl der Reisenden aus uniformierten Männern zu bestehen, die alle mit den gleichen habituellen Accessoires ihrer Kaste ausgestattet sind. Sie bevorzugen dunkle Anzüge, jüngere Männer wagen auch einmal hellere Farben oder dezente Muster. Sie telefonieren mit flachen Handys, handhaben Organizer, Mini-Computer, sie klappen ihre Laptops auf, sie sind digital vernetzt. Um mich herum wird so wild und entschlossen telefoniert, dass ich mich selbst nicht verstehe – dabei sage ich gar nichts.
Man wird ständig mit Sätzen konfrontiert, hinter denen weitläufige Geschichten stecken, ganze Biographien, die man aber nicht zu fassen bekommt, weil man nur Bruchstücke des Gesprächs mitbekommt, die Gegenseite nicht hört und man all die Sub- und Kontexte nicht kennt, die die Dialoge erst verständlich machen. Im Speisewagen schaufelt ein Mann Löffel um Löffel Zucker in seinen Kaffee. Die Ohren sind fleischig, die Haare grau und so dicht, als ob er einen Helm trüge. Während er telefoniert, malt er mit dem Kugelschreiber Arabesken auf seinen Notizblock. Ein Satz bleibt bei mir hängen: »Für mich wäre es wichtig, die Wettkampfzeiten von der Kleinen zu wissen!« Ist er ein Trainer, ein Journalist oder ein Physiotherapeut?
Ein anderer Satz, ein anderer Mann, Schnauzbart, Ohrring, lichtes Haar und Jeans: »Wir müssen endlich zu vorzeigbaren Ergebnissen kommen!«
Ein dritter Mann isst Gulaschsuppe und telefoniert dabei (obwohl die Piktogramme unmissverständlich darauf hinweisen, dass hier Ruhe erwünscht ist). Der Mann ist Anfang vierzig, Jeanshose, Camper-Schuhe, Kapuzenpullover, offenbar ein Kreativer, er strebt modisch und habituell Jugendlichkeit an. Sein Mac-Book steht aufgeklappt vor ihm. Er sagt anklagend, fast verzweifelnd: »Aber warum kommunizieren Sie das dann nicht? Wir arbeiten jetzt zwei Jahre zusammen und dann so was! Mein Akku ist gleich alle, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen … Hallo? … Hallo?« Er stampft mit dem Fuß auf.
Und was hat die Frau zu verbergen, die kurz vor Düsseldorf ins Handy haucht: »Wir kommen jetzt gleich in Hamburg an, Du, ich muss Schluss machen!«
Geradezu poetisch wird ein Mann im konservativen nadelgestreiften Anzug mit Einstecktuch: »Wenn wir den Trottel noch mit ins Boot nehmen müssen, dann brauchen wir neue Segel. Und am besten noch einen Motor!« Und nach einer Pause: »Ein Schiff brauchen wir für so viel Dummheit, ein ganz großes Schiff!«
Das Handy ist nicht nur Medium und Message, es ist der Lebensgefährte. Es ist die fünfte Extremität, die die Schwangeren bald auf ihren Ultraschallbildern zu sehen bekommen.
Gestern, das Personal im Speisewagen kam aus Sachsen. Die Servierkräfte heute kommen unüberhörbar ebenfalls aus Sachsen. Ich muss unwillkürlich an das bekannte Couplet von Otto Reutter denken: »’n Sachse is immer dabei.« Vielleicht werden Sachsen im Speisewagen bevorzugt eingestellt, weil sie ein so lustiges Idiom sprechen und ihre gute Laune gewinnbringend in den Dienst der Bahn stellen? Sachsen reden offenbar gerne mit sich selbst, meine Sächsin tut es. Sie hat immer einen Spruch auf den Lippen, der in erster Linie ihrem Kollegen gilt, sich aber von Fall zu Fall auch an die Gäste richtet. Das ist kostenlose Comedy. Einem Gast, der zahlen will, ruft sie zu, so dass alle es hören können: »Sie möchten sich also finanziell verändern?« Gelächter.
»Das haben Sie aber cool gesagt«, antwortet der Gast. Der Mann mit den fleischigen Ohren ruft: »Ich möchte mich Ihrer Einladung anschließen!« Und eine Weizenbier trinkende Mittfünfzigerin posaunt: »Ich möchte mich nicht nur finanziell verändern, das darf mein Mann aber nicht wissen!« Gelächter.
Die Strecke von Berlin nach Köln hatte mir gefallen. Auf dem Rückweg war ich zu müde, um noch Gespräche und Begegnungen zu suchen. Ich verkroch mich in einen stillen Winkel und schlief. Als ich erwachte, der Nacken ganz steif, saß mir gegenüber ein älteres Ehepaar, das ebenfalls schlief. Ihr Kopf war an seine Schulter gerutscht, beider Münder standen leicht offen. Wenn Zugreisende in den Schlaf gleiten – und sie schlafen noch nicht tief – und ein Rest ihres Bewusstseins kontrolliert noch die physiognomischen Regungen, dann wählen sie ein Einschlafgesicht aus, eine, wie sie meinen, nicht zu beanstandende Miene, ein befestigtes Gesicht, das unangreifbar ist. Wenn sie dann aber in tiefere Schlafregionen sinken, friert dieser Ausdruck in der oberen Gesichtshälfte ein und man denkt, man könne ihn wie eine Gipsmaske abnehmen. Die untere Hälfte des Gesichtes hingegen verrutscht und dementiert den oberen Ausdruck. Erst wenn sie längere Zeit schlafen, setzt ihnen der Schlaf ein anderes Gesicht auf, löst die Kunstgesichter ab, die Züge entspannen sich und nicht selten kommt das Kind zum Vorschein, das der Schlafende einst gewesen ist. Ich beschloss, die Fahrt nach Köln gleich am nächsten Tag noch einmal zu wiederholen. Den Reiz in der Wiederholung suchen.
Von Berlin nach Köln. Im Speisewagen ist nichts los. Ich habe Zeit, die Karte genauer zu betrachten. Für jeden Monat hat die Bahn einen deutschen Spitzenkoch gebeten, vier Gerichte in Bio-Qualität zu kreieren. Der Spitzenkoch in diesem Monat heißt Oliver Heilmeyer, er kann einen Michelin-Stern, siebzehn Gault-Millau-Punkte und somit drei Hauben vorweisen. Er lacht. Bleckt die Zähne. Weiße steife Haube, weißer Kittel. Das Lachen eines Haifisches. Es heißt, Spitzenköche seien in der Küche gefährlich wie Raubtiere. Diesem glaubt man es. Eines seiner Gerichte heißt »Gefüllte Kalbfleischröllchen mit Rucola an Kartoffel-Kürbis-Stampf«. Zu jedem Gericht wird dem Kunden ein lyrisches Text-Biskuit serviert, das ihm das Raffinement des Gerichtes nahebringen soll. Die Kalbfleischröllchen werden so besungen: »Sanft in eigenem Saft gegart, erhalten die zarten Kalbf leischröllchen durch ihre raffinierte Füllung mit Serranoschinken und Rucola-Salat ihr besonderes Aroma. Dem Stampf aus Kartoffeln und Muskatkürbis verleiht Kürbiskernöl zusätzlichen Pfiff. Die beigemischten Kürbis- und Pinienkerne sorgen für eine besondere Note.«
Sanft. Zart. Raffiniert. Zusätzlicher Pfiff. Besondere Note. Klingt irgendwie nach Porno. Immerhin Qualitätsporno. Es ist das Bio-Jahr im Speisewagen. Die Qualitätsoffensive geht weiter. Vor einigen Jahren, erinnere ich mich, wollte die Bahn die Speisewagen noch abschaffen, sie seien einfach zu unrentabel, hieß es. Die Verluste, die die Speisewagen einfuhren, sollen bei etwa dreißig Millionen Euro jährlich gelegen haben. Nur fünf Prozent der Bahnkunden, wurde gemeldet, nutzen die Bordgastronomie, und nur ein Prozent nahm ein Hauptgericht zu sich. Andererseits wünschte etwa die Hälfte aller Kunden, dass die Speisewagen erhalten blieben. Ein Proteststurm erhob sich, Verbraucherverbände liefen Sturm, im ICE 793 von Berlin nach Frankfurt am Main wurde ein Speisewagen besetzt und demonstrativ ein »eat in« veranstaltet. Das öffentliche Aufbegehren zeigte Wirkung, die Bahn verabschiedete sich vom Abschied des Speisewagens, rüstete 54 ICE-3-Züge, die zunächst ohne Speisewagen auf die Strecke geschickt wurden, nach und versuchte fortan, das gastronomische Angebot zu verbessern.
»Wir haben«, gab ein Bahnmanager zu, »die emotionale Bedeutung des Speisewagens für unsere Kunden unterschätzt.« Das stimmt. Allein das Wissen, dass ein Zug einen Speisewagen besitzt, schafft für den Reisenden eine andere Atmosphäre. Der Speisewagen ist ein Ausweg aus dem Einweg, er mag betriebswirtschaftlich defizitär sein, dafür unterfüttert er den gesamten Zug mit einer Genuss-Option.
Der Speisewagen ist immer noch fast leer, nur eine ältere Frau, Typ gesellige Großmutter, sitzt allein, und drei kichernde Mädchen haben sich am Nebentisch eingerichtet. Sie mögen dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein. Sie tragen enge Jeans und zu kurze T-Shirts. Hüftfleisch quillt. Es ist Februar. Die drei sind total aufgeregt, sie haben offenbar kaum Geld und beratschlagen, was sie zu dritt bestellen, um sitzen bleiben zu können. Jetzt kommt eine zackige Kellnerin an i hren Tisch.
»Was darf's denn sein, bitte schön?«
»Wir hätten gerne einen halben Liter Pepsi light!«
Die Pepsi kostet drei Euro.
Das Mädchen betont den »halben Liter«, um die ungeheure Menge Flüssigkeit zu betonen.
Die Kellnerin blickt indigniert: »Eine Pepsi? Für drei Mann?«
Die Mutigste: »Ja!?«
»Das geht nicht!«
»Nicht!?«
»Nein, das geht nicht!«
Die Mädchen trollen sich und stoßen sich dabei kichernd in die Seite.
Die Kellnerin kommt jetzt zu mir. Baut sich auf. Zupackend freundlich. Ich bestelle Tee und frage sie, ob sie aus Sachsen kommt. Nein, sagt sie. Sie komme aus dem Vogtland. Aber, sagt sie, das Vogtland gibt es ja nun nicht mehr. Was ist passiert? Ich muss mich da schlaumachen. Ich dachte immer, das Vogtland gehöre zu Sachsen. Ist die Kellnerin vielleicht eine heimliche Separatistin? Mag sie die Sachsen nicht oder ist sie es müde, für eine Sächsin gehalten zu werden? Ist das Vogtland abgebrannt oder nach der Wende wegreformiert worden? Ich notiere mir: Bald einmal ins Vogtland fahren.
Mein Tee kommt. Die Kellnerin hat eine kleine, weiße Narbe über der Oberlippe.
In Dortmund muss ich umsteigen. Es fängt an zu nieseln. Vor den Mündern der Wartenden stapeln sich Atemwolken. Feucht und kalt. Alles schleicht. Die Menschen sind durch die Wintertextilien noch immer gelähmt, verborgen in Polster, die nicht nur gegen Kälte und Wind, sondern auch gegen Blicke und Wünsche isolieren sollen. Jeder schleppt seine Portion Leblosigkeit mit sich herum. Der ICE fährt ein. Der Zug ist leer. Ich setze mich sofort in den Speisewagen. Es ist ein sehr kleiner, intim wirkender Speisewagen, der allenfalls halb so groß ist wie ein normaler Speisewagen. Ich baue meinen Laptop auf, um die vorangegangenen Eindrücke festzuhalten. Der Steward kommt und bittet mich, den Laptop einzupacken, wenn der Speisewagen voller würde. Er hat recht. Ich bin völlig seiner Meinung. Der Speisewagen ist schließlich kein Büro. Ungeachtet dessen packt auch der andere Gast – neben mir der einzige – seinen Laptop aus. Er will ein Bier bestellen und sucht fieberhaft nach Geld. Er hat 2,50 Euro und ein Bier kostet 2,70 Euro. Er wird hektisch; als ich auf seine Not aufmerksam werde, rufe ich nach vorne, ob ich ihm einen Euro borgen soll. Er dreht sich um, erleichtert, lächelnd. Er kommt zu mir, bleibt im Gang stehen. Ein junger Mann, ausgesprochen gut und teuer gekleidet. Konservativ. Dreiteiliger Anzug, Krawatte. Dichtes, blondes Haar. In jedem Film könnte er einen edlen deutschen Wehrmachtsoffizier spielen. Mit Augenklappe und Widerstandskämpfer-Appeal.
»Mit dem« – er dreht seinen Kopf zum Steward – »bin ich jetzt mindestens fünfzigmal gefahren und er lässt immer die gleichen Sprüche vom Stapel.« Ich frage ihn, ob er Pendler ist. In diesem Augenblick kommt der Steward und sagt: »Ich gebe Ihnen das Bier aus!« Der junge Mann ist überrascht. Von Entgegenkommen umzingelt. Ich bitte ihn, sich zu setzen.
Er arbeitet bei einem oder dem größten deutschen Energieunternehmen und verkauft Stromkontingente an Großkunden. Er hat mit Millionensummen zu tun. Er lebt in Köln und arbeitet in Essen und fährt die Strecke jeden Tag zweimal. Morgens eine Stunde und neun Minuten hin, abends eine Stunde und neun Minuten zurück. Er ist erst dreißig und hat doch schon eine exponierte Stellung in seinem Unternehmen. Ich hatte ihn weitaus älter geschätzt, aber die konservative Kleidung und die tiefe Stimme nehmen ihm das Jungenhafte. Seine Frau ist noch jünger, sie studiert noch. Jetzt haben sie ein Kind und er würde sich freuen, wenn es mehr würden. Weil er so drahtig und sportlich aussieht, frage ich ihn, ob er mal Fußball gespielt hat. Klar, sagt er, er habe sogar recht hoch gespielt und ein Sportinternat besucht.
»Und, spielen Sie jetzt noch?«
Er verneint. Nur noch Privatspiele. Aber dafür habe ihn eine andere große Leidenschaft gepackt, die Jagd. Das ist mein Mann, denke ich, jetzt kann ich das mal mit den Hochsitzen für mich klären. Ja, sagt er – auf meine Frage, ob es in Deutschland viele Hochsitze gäbe –, in keinem anderen Land gibt es wohl so viele. Der deutsche Jäger sei halt sehr bequem, er sitze gerne und warte, unser Land sei wirklich mit Hochsitzen gepflastert und niemand könne sagen, wie viele es seien, denn dafür gäbe es keine Meldepflicht.
»Das Jagderlebnis wird für mich vor allem durch drei Dinge charakterisiert. Die Ruhe, das Adrenalin und die Hege des Wildes. Wir, die jüngeren Jäger, die ich kenne, sind nicht solche Dauersitzer. Das ist eine Frage der Generation. Es ist ein wunderbares Erlebnis, sich im Winter durch Schnee an das Wild anzupirschen. Gegen den Wind. Auf Socken, das kann man eine Viertelstunde machen, erst dann fängt man an zu frieren. Und bei Vollmond ist es taghell, das wissen die meisten gar nicht. Das ist ein großartiges Erlebnis. Mein Revier ist eher klein, zweihundert Hektar. Die meisten Reviere sind heutzutage nicht besonders groß, denn der Staat, der möglichst viel Geld mit den Revieren verdienen will, parzelliert die Gebiete in entsprechende Größen.«
Ich frage ihn, ob ich nicht mal mit zur Jagd kommen kann. Klar! Ich gebe ihm meine Karte. Ob er sich meldet? Seine Karte konnte er nicht finden. Ich biete ihm zum Abschied das »Du« an, schließlich bin ich dreizehn Jahre älter. Ich will es selbst kaum glauben, als ich mir die Differenz klarmache. Man fühlt sich immer jünger. Ich will ihn einladen, als der Steward kommt, doch der wehrt ab: »Das Bier geht aufs Haus!«
Ich übernachte in Köln und fahre am nächsten Morgen zurück. Es bleibt noch etwas Zeit für einen Gang in die Stadt. Ich spaziere über die Hohenzollernbrücke, die, wenn man nach Köln hineinfährt, genau auf den Dom zuläuft. Sie ist vier preußischen Herrschern gewidmet, deren Reiterstandbilder man auf beiden Seiten des Rheins findet. Die drei moosgrün schimmernden Stahlbögen erinnern an Augenbrauen oder auch an Fische. Rechts von mir reitet Kaiser Wilhelm II. in seine ruhmlose Zukunft. Manchmal hat man Mitleid mit der Unwissenheit der Denkmäler. Man sollte sie erlösen. Hat man Wilhelm II. passiert, findet man im Pflaster die folgende kryptische Information eingelassen: »Mai 1940 1000 Sinti und Roma«. Wir, die Schamschuld-Deutschen, wir, die nachgeborenen Büßer-Virtuosen, wissen die spärlichen Zeichen zu deuten. Im Mai 1940 wurden über diese Brücke, die im Krieg weitgehend unzerstört blieb, 1000 Sinti und Roma, die man damals noch Zigeuner nannte, mit Zügen ins Konzentrationslager deportiert und umgebracht. Der appellative Subtext lautet: Vergiss die Toten nicht, jeder deiner Schritte geht über blutbefleckten Boden.
Es ist diesig, feiner Regen weht ins Gesicht, die Spitzen des Doms sind im Hochnebel verborgen. Der Rhein sieht aus wie ein uralter Eintopf, eine braune Brühe, die alle deutsche Last auf sich genommen hat: Schätze, Schmutz, Schande und Größenwahn. Im winterlichen Sprühregen geschieht alles lautlos. Die Schiffe ziehen wie von Geisterhand bewegt dahin, man hört kein Tuckern, Brummen oder Schnurren der Motoren, die Besatzungen der Binnenschiffe sind hinter ihren Scheiben kaum zu erkennen. Die Bahngleise sind von dem Fußgängersteg durch einen grünen Drahtgitterzaun abgetrennt. An diesem Zaun sind Hunderte, ja Tausende Vorhängeschlösser angebracht. Liebes- und Ehepaare wollen so die Unverbrüchlichkeit ihres Bundes besiegeln und symbolisch bekräftigen. Viele, nicht alle, haben ihre Namen auf die Schlösser geschrieben. Tina und Manfred. Tom und Nike. Sabine und Klaus. Für immer. Ewig dein. Unzertrennlich. Ich stelle mir vor, dass die Paare die Schlüssel in den Rhein werfen. Wie lange wird dieser Zaun wohl stehen? Wie lange werden die Schlösser toleriert? Hinter dem Zaun finden sich viele Scherben von Sekt- und Bierflaschen.
Ich gehe bis zur Mitte der Brücke. Es tickt hier. Eine Bombe? Eine Zeitschaltuhr? Oder tickt hier das Herz eines Landes? Hat ein Land einen mentalen Mittelpunkt? Der Ort kommt mir sehr deutsch vor. Stahl, der gotische Dom, das moosige Grün der Brücke, die winterliche Melange aus braunen, grünen und ockerfarbenen Tönen, die gedämpfte Stimmung, der bedeutungsschwere, träge Fluss, preußische Standbilder, Erinnerungsmale. Die Radfahrer ziehen lautlos und zielstrebig an mir vorbei. Sie sind in Funktionskleidung gehüllt, immer mehr Menschen tragen jetzt Jack-Wolfskin- oder The-North-Face-Jacken. Überleben, widerstehen ist alles. Alles ist eine große Wildnis und wir sind mittendrin. Auf die Brücke hat einer gesprüht: »Nazis morden, der Staat schiebt ab, alle dasselbe Rassistenpack.«
Kurz vor Hamm. In Hamm steht eine große, aus gelben Ziegelsteinen gemauerte Moschee mit hohem Turm. Es sieht so aus, als liege sie in einer Art Gewerbegebiet. Ein Stückchen weiter liest man auf einem Fabrikgebäude: »Kaldewei – Europas Nr. 1 in Badewannen. « Einige Minuten bevor wir durch Bielefeld fahren, meldet der Schaffner die »Entgleisung einer Privateisenbahn«. Die Einfahrt verzögere sich dadurch aber nur unwesentlich. Und in Bielefeld wacht eine Burg hoch oben über der Stadt.
Langsam füllt sich der Speisewagen. Ein kleines Mädchen – sie mag sechs Jahre alt sein – kommt allein und setzt sich an einen Zweiertisch. Sie trägt einen grauen Kapuzenpullover. Sie hat eine Papiertüte mitgebracht, eine Bäckertüte. Sie legt die Tüte vor sich auf den Tisch, öffnet sie, schaut lange hinein und zieht dann ohne Hast einen Pfannkuchen heraus, einen Pfannkuchen mit Schokoladenüberzug, so wie es sie nur zur Karnevalszeit gibt. Sie isst den Kuchen langsam und mit großem Genuss. Sie leckt sich jeden Finger aufmerksam ab. Niemand kommt und stört sie, kein Steward weit und breit, kein Mindestverzehr. Als sie merkt, dass ich sie beobachte, verdreht sie die Augen.
Unter der Zirkuskuppel
»Sind Sie arbeitslos?«
Ich drehte mich zur Seite und sah den Mann an, der mich so unvermittelt angesprochen hatte. Er trägt eine schwere Hornbrille, man muss genau hinsehen, um sein Gesicht zu entdecken. Er sieht aus wie ein Hemd, das zu lange im Koffer gelegen hat.
»Nein«, erwiderte ich, »aber ich habe Zeit. Wie kommen Sie darauf?«
»Na, Sie stehen hier doch schon eine halbe Stunde, oder? Und ich hab auch ganz viel Zeit, viel zu viel Zeit.«
Ich stehe oben auf dem Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofs, der die Bahngleise und den Steindamm mit der Mönckebergstraße verbindet. Von hier aus blickt man zum Nordsteg, wo sich die Wandelhalle mit vielen Parfümerien, Boutiquen, Gourmet-Tempelchen und Blumenläden befindet. Die Nordseite ist die Luxusseite, die Südseite ist die Alltagsseite, wo Passanten den Bahnhof hastig durchqueren, wo die Reisenden atemlos zu ihren Zügen hinabsteigen, wo die Pendler zu den S-Bahnen hetzen, um in die Vororte oder ins Umland zu fahren. Die große Halle strahlt eine schmuddelige, gelassene Erhabenheit aus. Das schläfrige Auge unter dem Dach hat schon alles gesehen.
»Sind Sie gut versichert?«
»Sie wollen mir doch jetzt nicht etwa eine Versicherung andrehen? Hier im Bahnhof?«
»Nein, nein!« Er wehrt entrüstet ab. »Nein, das war nur berufliche Neugier. Ich war so lange im Außendienst, das ist nur ein Reflex. Aber so wie Sie reagieren die meisten Menschen. Heutzutage denken alle, sie werden betrogen. Ich habe nie jemanden betrogen.«
Er denkt nach, kratzt sich seinen Handrücken, nimmt die schwere Brille ab und hält sie prüfend gegen das Licht.
»Was sind Sie von Beruf?« Er sieht mich an.
Ich lüge. Ich will jetzt nicht der sein, der ich bin.
»Landschaftsarchitekt. Ich arbeite viel für Städte und Gemeinden.«
Mehr will er nicht wissen.
»Schöner Beruf. Bestimmt. Wenn man noch mal was anderes machen könnte … , aber dafür bin ich schon zu alt. Wir haben unser Häuschen draußen. Der Rasen ist kurz geschnitten, das Haus tipptopp, aber ich bin arbeitslos. Mein Chef hat gesagt, du bist wirklich ein alter Zirkusgaul. Wird Zeit, dass du nach Hause gehst. Da bin ich dann nach Hause gegangen. Und deshalb hab ich jetzt ganz viel Zeit.«
Wir blickten hinab auf die Gleise. Ich erinnerte mich daran, wie der Bahnhof vor einigen Jahren von einer geradezu biblischen Taubenplage heimgesucht wurde, kein Quadratmeter ohne Schiss, bevor man sich irgendwo hinstellte, musste man sich nach oben absichern. Überall gurrte und balzte es, Federn flogen von der Decke, das klatschende Knallen des Flügelschlags war allgegenwärtig. Das scheint, stelle ich erleichtert fest, vorbei zu sein. Ich habe mich neben einem Müllsammelpunkt postiert. In der halben Stunde, die ich dort stand, kamen drei Pfandflaschen-Sammler vorbei. Sie alle zogen einen schmuddeligen Trolley hinter sich her, in dem sie normalerweise ihre Schätze verstauten. Keiner jedoch wurde fündig. Ihr geübter Blick fuhr wie eine Hand in die Tonne, sie stocherten ein wenig herum, der eine nahm dazu ein Stöckchen, einer trug einen Handschuh, dann trotteten sie ohne Erfolg weiter. Jetzt näherte sich wieder einer. Mein Mann begrüßte ihn, sie gaben sich die Hand.
»Tach Rudi, du alter Fuchs. Wie sieht’s aus? Heute schon Beute gemacht?«
Der Flaschensammler zeigt auf seinen Trolley. »Bin zu spät dran heute, alles schon abgegrast.«
»Komm, hier haste meine.« Der Versicherungsvertreter gibt ihm eine leere Mineralwasserflasche, die er aus der Manteltasche zog.
»Jo, muss dann mal weiter. Man sieht sich.«
»Ja, Rudi, mach’s mal gut Rudi, bis die Tage.«
Der Versicherungsvertreter nickt dem abziehenden Flaschensammler hinterher.
»War ein guter Mann. Schiffsmakler, ganz alte Schule. Und dann? Die Frau hat der Krebs geholt, dann ist er ans Trinken gekommen und das ging nicht lange gut. Und ein paar Jahre später war er sein Haus los. Und jetzt sammelt er Flaschen. Da geht’s mir noch Gold. Ich hab’ mein Haus, meine Frau und zwei gesunde Kinder.«
»Und warum stehen Sie dann stundenlang hier im Hauptbahnhof herum?«
Ehe er antwortete, begrüßte er einen vorbeieilenden Mann. Sie reichten sich stumm die Hände, der andere zieht ab.
»Wissen Sie, für meine Nachbarn und meine Söhne will ich der Alte bleiben. Unsere Söhne sind zwar aus dem Haus, aber ich will nicht, dass sie das Gefühl haben, sie müssten uns unterstützen. Müssen sie auch nicht. Alles ist abbezahlt, meine Frau hat eine Stelle als Sekretärin in einem Gymnasium, es reicht. Und ich geh zur Arbeit. Immer noch Tag für Tag. Was meinen Sie, wie gut ich Hamburg inzwischen kenne. Aber am liebsten bin ich hier im Hauptbahnhof. Kenne hier schon meine Leute und die kennen mich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und das mach ich noch ein Jahr und dann geh ich offiziell in Rente.« Er reibt sich die Hände, als freue er sich schon jetzt auf diese Aussichten. »Aber wissen Sie was? Mir macht das Theater irgendwie Spaß. Und wenn ich mal einen meiner alten Kollegen treffe, dann sag ich zu denen, ›Na, was macht unser Direktor, knallt er immer noch mit der Peitsche?‹« Er lacht. »Na dann will ich mal los. Bin noch verabredet. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so einfach angesprochen habe. Alter Reflex. Also machen Sie es gut.«
Ich fühlte mich königlich ziellos. Ich verstehe den Mann. Ich hatte ihn zunächst bedauert, aber er strahlte eine tiefe Zufriedenheit aus. Irgendwie hat er sich freigemacht, obwohl er Theater spielte und eine alte Fassade aufrechterhielt. Wir sind alle immer auf dem Weg zum nächsten, zum allernächsten Zweck, vor lauter Zwecken fragt man nicht mehr nach dem Sinn des Lebens. Das ist ohnehin eine metaphysisch wie kommerziell verkommene Formel. Die dahineilenden Menschen auf dem Südsteg sehen aus wie Mittel, zweckgebunden, sich selbst zum Zweck machen, im Zweck Form und Befriedigung finden, ohne Zweck verzweifeln. Vollkommen zwecklose Menschen sind verloren, sehnen sich nach Zweckvermögen und brechen allenfalls aus ins Zweckvergnügen, um so gestärkt neuen Zwecken entgegenzueilen.
Plötzlich sehe ich über allen Köpfen dünne Fäden, noch dünner als Angelschnüre, aber absolut unzerreißbar. Das Wort fadenscheinig bekommt einen neuen Sinn. Ein Wunder, dass sich die Fäden nicht verheddern, einander ins Gehege kommen, sich verwickeln, irgendwo hängen bleiben. Und an jedem Faden, irgendwo im Unsichtbaren, zerrt und zieht der Endzweck eines jeden. Und ich stehe hier und habe für einen Augenblick den Faden über meinem Kopf vergessen. Ich schaue misstrauisch nach oben, dort hinauf in die Halle, wo zwischen den grauen Stahlbögen ein kleiner taubengrauer Fleck sitzt und nur sichtbar wird, weil er sich bewegt, kaum merklich. Und während ich den Kopf in den Nacken lege, löst sich da oben eine Detonation, etwas tritt aus der himmlischen Sphäre heraus, Beute der Schwerkraft nun, wird größer und weißer, kommt näher und näher, immer schneller und fällt – ich kann gerade noch zur Seite springen – und klatscht spritzend neben mich: Ein Taubenschiss.
Es wird Zeit. Der Zug nach Berlin steht schon bereit. Da, wo ich einsteigen muss, ganz am Ende des Bahnsteigs unter freiem Himmel, befindet sich die Raucherzone in diesem ansonsten rauchfreien Bahnhof. Es beginnt zu nieseln. Die Raucher stehen da, qualmen, den Blick unter Kapuzen, Hüten und Mützen zu Boden gesenkt. Die Raucherzone sieht so ähnlich aus wie die Coaching-Zone in der Fußball-Bundesliga. Ein Viereck, die Markierungen sind mit gelbem Farbband auf den Boden aufgebracht. In den achtziger Jahren erklärten sich viele Schulen, Gemeinden oder Jugendzentren zu atomwaffenfreien Zonen, symbolischer Widerstand gegen das atomare Wettrüsten. Heute widerstehen wir ein bisschen kleiner. Die Zigarette ist der Sprengkopf des neuen Jahrtausends. In diesem Viereck stehen höchst unterschiedliche Gestalten. Da die Raucherzone meist am Ende des Bahnsteigs liegt, dort wo oft die Wagen der 1. Klasse zu finden sind, stehen hier Yuppies und Manager mit zerlumpteren Gestalten Rücken an Rücken und saugen einträchtig an ihren Zigaretten.