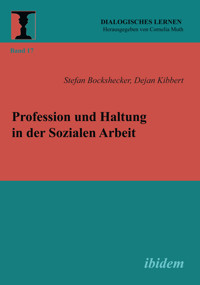
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Dialogisches Lernen
- Sprache: Deutsch
Die Dialogische Beratung nach Reinhard und Martina Fuhr setzt den Menschen als Ganzes voraus und erlaubt es, mit dieser Haltung einen kritischen Blick auf die Kategorisierung von Adressat_innen Sozialer Arbeit als Problemfälle zu werfen. In der Ausarbeitung Die Dialogische Beratung nach Fuhr als Möglichkeit der Dekonstruktion von Geschlecht von Dejan Kibbert werden Parallelen zur dialogischen Kommunikation in Beratungskontexten und der ethischen Dekonstruktion von Jacques Derrida gezogen und auf Gender-Ebene reflektiert. Die Begegnung im Dialog kann dazu führen, dass sich Menschen in ihrem So-Sein anerkannt fühlen und die gesellschaftlich-normierten Muster von Geschlecht und Rollen(erwartungen) entlarven und ablegen. Der Mensch als Ganzes ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung bei der Klärung der Frage, ob Sozialarbeiter_innen innerhalb ihrer Berufspraxis sie selbst sein dürfen. Ihre Verortung innerhalb gesellschaftlicher, institutioneller und persönlicher Anforderungen und Bedürfnisse ist dabei ebenso zu berücksichtigen wie das eigene Professionsverständnis und die vertretene (professionelle) Haltung. Das dialogische Menschenbild Martin Bubers kann auch innerhalb des Professionsdiskurses der Sozialen Arbeit einen wertvollen Beitrag leisten, um eine helfende Beziehung in der Begegnung mit dem Gegenüber zu ermöglichen. Stefan Bockshecker versucht in seiner Untersuchung Darf ich ICH sein? aus sozialarbeiterischer Perspektive eine Antwort auf diese Frage zu geben. Beide Studien greifen grundsätzliche Ideen und Prinzipien des Dialogphilosophen Martin Buber auf und bringen diese in einen sozialarbeiterischen Kontext. Sozialarbeiter_innen können in diesen Anknüpfungspunkte finden - sowohl für den Kontakt mit Menschen im Rahmen ihrer Berufspraxis als auch für ihre persönliche Auseinandersetzung mit Selbstbild und Haltung. Darüber hinaus werden gesellschaftliche und sozialpolitische Entwicklungen ebenso wie normierte Denkmuster analysiert und kritisch hinterfragt. Das vorliegende Buch stellt somit einen weiteren Beitrag in der aktuellen Diskussion um die Profession der Sozialen Arbeit dar, in dem die professionelle Haltung einen wesentlichen Bezugspunkt bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeberin
Der Dialog ist ohne ein Ich und ein Du unmöglich. Doch"Wer bin ich?"und"Wer bist Du?"sind Fragen mit unendlichen Antworten. Professionelle Beziehungsarbeiter_innen in Bildung und Sozialer Arbeit hingegen können ohne eine endliche Positionierung in Hinblick auf das eigene Selbst und das fremde Gegenüber nur diffus unterstützen. Die hier vorliegendenStudien, die am Fachbereich für Sozialwesen der Fachhochschule Bielefeld entstanden, sind der Versuch, dem genannten Problem auf vielfältige Weise nahe zu kommen:
Dejan Kibbert stellt für die Beratung dar, wen ein Sozialarbeiter ausschließt, wenn er in heteronormativer Haltung die Welt seines Gegenübers betrachtet und beurteilt. Dabei reflektiert der Autor mit Bezug auf Judith Butler und Jaques Derrida die anthropologische Frage, wer der Mensch ist, wenn er/sie professionell beraten will. Theoretisch siedelt Dejan Kibbert seine Fragestellung in den Bereichen der Humanistischen Pädagogik und Phänomenologie an. Damit erweitert er insbesondersden Diskurs um Gender-Fragen und füllt damit eine erhebliche Reflexionslücke in der Literatur zur Humanistischen Psychologie.
Stefan Bockshecker zeigt, wie in den gegenwärtigen ökonomischen Prozessen Menschen gezwungen werden, eine funktionale Identität zu entwickeln, um zu überleben. Für Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, bedeutet dies, zu technischen Lösungen zu greifen, die weder dem Ich noch dem Du gerecht werden können. Beide Seiten entfremden sich dabei vom Leben und damit vom Selbst. So ist Bocksheckers Fragestellung nach dem Sein-Dürfen eine radikale an die neoliberale Gesellschaft. Verneint letztere, weil das echte Ich stört und Scheinheiligkeit entlarvt, bejaht der Autor fast auffordernd: Ja, sei Du selbst! Ohne ein Ich kannst Du nicht wirklich Dein Gegenüber ansprechen! Hierbei bezieht sich der Autor auf die anthropologischen Reflexionen von Gernot Böhme.
Beide Reflexionsprozesse spiegeln essentielle Lebensfragen unserer Gegenwartsgesellschaft. Ich freue mich, mit der Herausgabedieses Buchesden Autoren einen öffentlichen Dialog-Raum zu ermöglichen!
Cornelia Muth
BerlinimApril2015
Teil1
Dejan Kibbert
Die Dialogische Beratung nach Fuhrals Möglichkeit der Dekonstruktionvon Geschlecht
1. Einleitung
In dieserStudiewird anhand der dialogischen Beratung nach ReinhardFuhr und Martina Gremmler-Fuhraufgezeigt, wie Beratung in sozialarbeiterischen Handlungsfeldern das dialogische Prinzip Martin Bubers vertritt.Beratung kommt in der Sozialen Arbeit in vielerlei Hinsicht zumTragen. Soziale Arbeit versteht sich als Menschenrechtsprofession und arbeitet an den Rändern der Ungleichheit. So sind Beratungssituationen für die Soziale Arbeit alltägliche Praxis und bieteneinen vertrauten Raum, in dem Bildung und pädagogische Hilfestellungen gestaltet werden.In der dialogischen Beratung nach Fuhr ist derFokus nicht bloßaufgetrennteLebenswelten von Klienten und Beraterngerichtet, sondernaufein paradoxes Verhältnis, in denen durch getrennte Welten Beziehung und Begegnung erst möglich gemacht werden.
Das Thema dieser Arbeit soll eine Möglichkeit aufzeigen,wiedurch dialogisches Handeln in der Beratung Geschlecht anders oder neu interpretiert werden kann.Die Persönlichkeitsentwicklung durchganzheitliche undtransformative Lernprozesse stehen unter dem Stern, in einer vertrauten,angstfreienund damit heilsamenBeratungsatmosphäre gesellschaftliche Wirklichkeiten zu hinterfragen und Glaubenssätze zu durchbrechen, um eine eigene(Geschlechts-)Identität jenseitsgesellschaftlicherDiskurse entwickeln zu können.So gehen Berater und Klienten gemeinsam auf Sinnsuche und entwickeln zwischen sich, nebenprozesshaftenProblemlösungen,neue Erkenntnisse und gestalten ganzheitliche Erfahrungen.
Männer- oderfrauenorientierte Beratungen betrachte ich unter dem poststrukturalistischen Gesichtspunkt als stigmatisierend, da von einemvermeintlichenWissenüber Frauen und Männer ausgegangenund unter einem typisierten zweigeschlechtlichen Rahmen beraten wird. Sind Frauen wirklich immer Opfer oder Männer immer die rationalen, starken Menschen? Wer sinddieMänner unddieFrauen, und gibt es nicht auch etwas außerhalb von weiblich und männlich?
DieDekonstruktionstheorie vonJacques Derridasoll bei der Beantwortung dieser Fragen helfen.Derrida bezieht sichaufSprache und ihre Wirkungenin Gesellschaft und Politik. Seine Theorie der Dekonstruktion soll in dieser Bachelorarbeit dazu dienen,Sprache nicht als einfaches Kommunikationsmittel zuverstehen, sondern die dahinterstehende Machtausübungvon Wissensdiskursen("Das ist männlich/weiblich...")nachzuvollziehen.
Zudem wird in dieser Arbeit Judith Butlers These unterstützt, dass Geschlecht durch Spracheund kulturelle Deutungenproduziert wird, und somit Lebensweisen außerhalb des kulturellen Verständnisses von Geschlecht ausgeschlossen werden.Homosexuelle, Intersexuelle oder transgender werdenvon der Mehrheitsgesellschaftals anderskrank, merkwürdig oder abwertendangesehen und unterliegen somit einer Ausgrenzung der Norm. Hieraus resultieren psychische Krankheiten sowie Abwertung des Selbst. Nicht nur dasAußerhalb der Norm ist von Stigmatisierungsprozessen betroffen. Heterosexuelle Menschen unterliegen einem stetigen Überprüfen, ob eine Normidentität erfüllt istoder nicht.Dies ist ein mühsamer Vorgang, in demnachkulturell vorgegebenenIdentitätsmustern gelebt wird.Butlergeht von Diskursen aus, in denen Sprache als Hierarchisierungsinstrument von bestimmten Geschlechtsidentitäten benutzt wird. Um dies nachzuvollziehen,geht Butler in ihrer Untersuchung"Das Unbehagen der Geschlechter"dekonstruktivvor und hinterfragt somitnaturwissenschaftliche Sichtweisenvon Geschlecht.
DieseStudiesoll die These stützen, dass durch dialogisches Handeln in Beratungssituationen, dekonstruktiv – im Sinne von Hinterfragen und Neuerschaffen von Wirklichkeiten – gearbeitet wird. Geschlechtsidentitäten sind auch sprachlich produzierte Wirklichkeitenund können somit in einer dialogischen Beratung"dekonstruiert"werden. Dadurch sind andere Identitäten vorstell- und lebbar. Sexuelle Orientierungen sind nicht mehr statisch, sondern können als wandelbar betrachtetund gestaltetwerden. Zwängeder Produktionvon typisiertenund traditionellenmännlichen und weiblichen Rollenbildernkönnenhinterfragt und entschärftwerden, um freier und bewusster leben zu können.Die dialogische Beratung nach Fuhr bietet somit dieMöglichkeit,in der Sozialen Arbeitauf der Ebene Geschlecht und Identität für mehr Interpretationsfreiheit und Gestaltungskraft der Persönlichkeits- und Identitätsbildung zu sorgen.
Um professionelles und dialogisches Handeln in Beratungssituationen der Sozialen Arbeit zu gewährleisten, sind Reflexionen der eigenen Biographie und Wahrnehmung unabdingbar.So werdenbiographisch verankerte Vorurteile von bspw. Geschlechterrollen oder Übertragungen im psychoanalytischen Sinne bewusst und können eingeklammert werden. Unter phänomenologischer Betrachtungsweise soll hier ein Grundverständnis von Menschenbildern undWahrnehmung gesetzt werden, um dialogische Beratung zu ermöglichen.
2. Phänomenologische Grundannahmen
Ohne ein Gewahrsein über die eigene Wahrnehmung von Dingen (innerhalb und außerhalb) und deren Deutungen bleiben Phänomeneweitestgehendgehaltlos.Dingemachen die Welt an sich aus.DieWelt, diesich zeigt mit vielfältigenAusdrucksformen und unendlichenFacetten. Diese Dinge inunsererWelt sind aber nicht einfach da, sondern
"...[n]ur durch das Bewusstsein ist Welt. Nur so werden Dinge beim Namen genannt und in der Mannigfaltigkeit ihrer Bezüge erkannt [...]. Die Welt braucht den Menschen und der Mensch braucht die Welt um zu sein."[1]
Doch was ist,wenn uns etwas"ins Auge sticht", phänomenologischgedacht,unser Bewusstseineine Intentionalitätmit einemGegenstand oder Menscheneingeht?[2]Dies bedeutet, dass unser Bewusstseindurch ein aus unserem jeweiligen Selbst entsprungenen subjektiven Gefühlauf Etwasgerichtet ist. Dieser Bewusstseinsakt geht im weiteren Verlauf mit ontologischen Deutungen einher. Wir versuchen Dingeeinzuordnen oder mit unseren Erfahrungen zu koppeln.Was irgendwievon dem uns Erwarteten und Gewohnten abweicht, ist das, was unsbewusstzum Phänomen wird.Wenn wir eine Person ein erstes Mal betrachten und nicht direkt deuten können,ob diese Person männlich oder weiblich ist, sind wir irritiert oder versuchen so lange die Intentionalität aufrecht zu erhalten,bis unslogischklar wird: Dasmusseine Frau/ einMannsein, oder noch weiter: Das isteine Frau / einMann.Hiermit gehen nun weitere Zuschreibungen einher, wieVerhaltensweisen oder sexuelle Orientierung.Wir vermuten, dass einem Phänomen eine Ordnung innewohnen muss. SomitweistdieserSinnesaktvon den Phänomenen auf die Strukturen.Die Wahrnahme istaus dieser Warteauseine gegenwärtige Sinn-Erfahrung, welche vorlogosliegt.
Ich möchteim folgendenAbschnitt die menschliche Wahrnahme und Interpretation unter der Leibphilosophie Merleau-Pontysintensivererläuternund imweiteren Verlauf aufganzheitlicheErkenntnisweisen eingehen, welche für die dialogische Beratungnach Fuhrwegweisend sind.
2.1. Die menschliche Wahrnehmungals leibliche Erfahrung
Wie bereits erläutertnimmt der Mensch lebensweltliche Dinge wahr und deutet diese, indem das menschliche Bewusstsein intentional gerichtet auf etwas ist. Doch wie kommen Deutungen vonsich uns erscheinenden Phänomenenzustande? Aus welchem Fundus heraus beziehen wir uns auf Begrifflichkeiten und Spracheund geben Dingen einen Sinn?
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), ein französischer Philosoph,hat sich an dermenschlichenalltäglichenLebenswelt orientiert. Er versteht Lebenswelt als kulturell geprägtes Gesamtspektrum menschlicher Erfahrungen. Dieses Spektrum ist ein Fundament unserer sinnlichen Wahrnehmung.Somit muss diese Basis auch immer im historischen Kontext gesehen werden, da sich Lebensweisen und–welten kontinuierlich ändern.[3]Ich verstehe dieses Sinnesfundament alssichpermanentändernden,kontemporär eingebundenenundkulturellgewaschenenFilter unserer Wahrnehmung.Somit heißt,ein Mann oder eine Frau zu sein,heute etwas anderes als vorbspw.ein paar Jahrzehnten. Zudem bedeutet dies,dass Menschen nie in der Lage sind,
"...unabhängig vom bereits daseienden, unbedachten, unreflektierten Leben zu einem letzten Bewusstsein von den Dingen zu gelangen. Unser Bewusstsein gründet immer auf einem Hintergrund, Untergrund, Milieu, auf einem 'lebensweltlichen Apriori', welches die uneinholbare Bedingung allen Denkens bildet."[4]
Hierbei wird deutlich, dassinMerleau-Pontys Denkvorgangdie Lebenswelta priorivonBewusstsein ist.Weiterlässt sich ausdieserErkenntnisentnehmen, dass der Mensch sich ihm zeigende Objekte, sich selbst und andere MenscheninderWelt nicht"rein"betrachten kann, da die Lebenswelt das Bewusstsein filtert.Somitnehmenwir einen Tisch als Tischwahr, da in unserer Lebenswelt der Nutzen, die Gegebenheit und Form eines Tischeskulturell eingelassen ist. Wir erkennen einen Tisch aufgrund der (meistens) vier Beine und der Platte.Es gibt kein"Davor",kein"Vordikursives".Wir müssen den Dingen nicht noch einen individuellen Namen geben.
Edmund Husserl (1859-1938), Mathematiker und der Gründer der Phänomenologie,ist jedoch
„...konsequent bei den Phänomenen geblieben und hatte ihreUrsprünge durch vorurteilsfreie, unbeteiligte Beobachtung bis in die letztenaufweisbaren Details verfolgt.“[5]
Husserl hat also versucht, die Phänomene bis hin zu dem reinen transzendentalen Sein außerhalb von kulturellen Deutungenzu erfahren und zu beleuchten.
Merleau-Ponty hatdiesen Denkansatz erweitert, indem er Phänomenologie als"Beschreibung aller Erfahrung, so wie sie ist"[6]versteht. Aus dem Anspruch an Objektivität ist ein Anspruch an"subjektiver Objektivität"geworden.Somit sind Vorurteile also Teil unseres Sinnesfundamentes und können von sich uns zeigendenPhänomenenin der naiven Betrachtung nicht abstrahiert werden.Wir sind demnach mit Vorannahmen, Erinnerungen, Gefühlen und allemanderenmenschlich Erfahrbarenim ständigen Kontakt mitderWelt.Somit istderLeib"unsere Verankerung in der Welt"[7].
Der Leib lässt sich als ein Gefühls- und Sinnwinkel verstehen,mit dem der Mensch lebensweltlichund auch historischzur Welt istund in Welt verankert ist. Wir können dementsprechend ausschließlich mit unseren Gefühlen, Biographien, Gedanken und körperlichen VerfassungenWelt beschreiben und erleben. Demnach umfasst der sinnliche Leib, der wir selbst sind,und das Sein-zur-Weltim Sinne Merleau-Pontys auch Vorurteilegegenüber Dingen in Welt.[8]Somit ist
"...[m]ein Verhältnis zur Welt [...] durch meine Leiblichkeit bestimmt. Welt eigne ich mir nicht intellektuell an, sondern zuerst und zugrunde liegend: Ich existiere leibhaft und durch leibliche Erfahrung."[9]
Folglich bildet die Einheit von Lebenswelt und Bewusstsein das lebendigleibliche Bewusstsein, welches nicht als Denkapparat,sondern als Erfahrungzu verstehen ist. Das leibliche Bewusstsein wendet sich zurWelt hin,ista priorivondieserWelt und bringt so Situationen hervor.DerLeib ist also ein gegenwärtigesZwischen undein Vermittler von Welt, welcher Vergangenheit und Zukunft schließt. Nur durch den Leib ist es dem Menschen möglich,Dinge in facettenreicher Weise wahrzunehmen.[10]Zudem sind der menschlicheLeib undunsere sich zeigendeWelt nach Merleau-Ponty als Kommunion zu verstehen. Somit ist Intentionalität ein ganzheitlicherund reizvollerKontakt.[11]Infolgedessen ist Intentionalitäteine Einheit, welchesowohlleiblich gebundenerMensch als auch Welt ist.
Umsichüberdieleiblichgebundenen, lebensweltlichen Vorannahmen einer Situation,einesGegenstandesoder eines anderen Menschenbewusst zu werden, mussder Menschbeisichselbstergründen,woher Gefühle und Gedanken stammen könnten.DerMenschmusssich selbst als Wesen erfassen.[12]Nur so können sich andere Menschen in Beratungssituationen zeigen wie sie sind und Vorurteile in den Hintergrund geraten.
Durch diese ReflexiondesSelbst, welche immer im Unreflektierten gründet,ist es möglich,inderWelt auch andere Dinge wahrzunehmen, welche im Vorfeld nicht bewusst waren.Der Mensch"leibt"somit eine"lieblichere"Intentionalität mit einemMenschenoderGegenstandund betrachtetnicht naivdieersten Gedanken als endgültige Wahrheit an.Der Mensch befasstsichund kommuniziertmitderWeltintensiverund gibtDingen einen neuartigenoderanderen Sinn.Unter diesem Gesichtpunkt sind Wahrheiten keine in sich stagnierenden Tatsachenmehr, sondern können permanent neu definiert werden.Somit bleiben dieWeltundderMensch in Bewegung, da jede Intentionalität einin sicheinzigartiger Vorgang ist.
Jedoch ist es wichtig, Dinge inunsererWelt zu benennen und zu konstruieren, da andernfalls unserlebensweltlicherLeibständig"von Anfang an"aufgebaut werden müsste, was in unserem Alltag hinderlich wäre, da automatisierte Vorgänge wie bspw. schnelles Treppensteigen nicht möglich wären.Jeder Sinnesakt würde unser Erster seinund alle Dinge müsstenimmerneu einverleibtwerden.Gewohnheit und Vertrautheit ist demnach kein Denkprozess,sondern im Leib eingelassen.Es ist demnachleiblich vorgesehen,sich auf vorherige Erkenntnisse und Erfahrungen zu stützen.[13]Wir setzten also leiblich gebundengewohnteGrundtatsachen voraus, welche jedoch hinterfragt werden können,um eine neue Sinnsuche zu beginnen.
Um multispektrale Sinngebung ereichen zu könnenund Dualismen kurzzeitigeinzuklammern,ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise unabdingbar.Diese steht für die dialogische Beratung nach Fuhrunter einer grundlegenden Erkenntnisweise.Diese besteht aus derMehrdeutigkeitund desSich-lösen-KönnensendgültigerSichtweisen.
2.2. Ambiguitätundganzheitliche Erkenntnisweise
Wie aus dem vorigen Abschnitt hervorgeht, ist Wahrnehmung immer als eine leiblich gebundeneSinn-Erfahrung mit Welt zu verstehen.Sie istnach Merleau-Ponty
"...die Erfahrung des Entspringens eines immanenten Sinnes aus einer Konstellation von Gegebenheiten".[14]
Da die Lebensweltim Leibeingelassen ist, kann eine Deutung oder Interpretation nie objektiv geschehen und steht immer unter subjektiv erlebtemZur-Welt-sein.So sind Menschen nicht einfach Menschen, sondern Deutungskörper von reich/arm, weiblich/männlich oder ausländisch/deutsch.Somit ist Intentionalität immereinesubjektivgerichtete. Im naivenZur-Welt-seinbedeutet dieseine triviale Betrachtung oder Erfahrung in Welt. Intentionalität spielt sich an der Oberfläche ab und der Mensch greift auf"Interpretations-Automatismen"zurückund
"...[d]as, was uns bewußt ist oder wessen wir uns mit einiger Anstrengung bewußt werden können, sind meistens die Interpretationen von Wahrnehmungen, die wir fälschlicherweise für die Wahrnehmungen selbst halten.[...] Wenn ich mir einer Wahrnehmung bewußt werde, habe ich die Freiheit, ihr eine gegenwärtig für mich stimmige Bedeutung zu geben. Dieser Prozeß einer Interpretation ist ein bewußter Akt des Bedeutung- oder Sinn-Gebens, als deren Urheber ich mich erleben kann."[15]
Folglich istes möglich,sich selbst in Wahrnehmungsprozessen zu erfahren, wennMenschsichseines lebendigen und teilnehmenden Selbst bewusst ist.Es geht hier um ein"Erfahrbarmachen"der Intentionalität.Aufgrund der leiblichgebundenenWahrnehmung ist es möglich,die Sinngebung als Sinn-Erfahrung zu bezeichnen. Siestellt demnach einen lebendigen und aktiven Akt der Deutungund Interpretationdar.Wenn Intentionalität als eine wechselwirksame Einheitsowohlvon leibgebundenen Menschen als auch Welt verstanden wird, bedeutet dies, dass bei einer Offenheit und Fixierung zur Welt Objekte aller Art in mehrdeutiger Weisein der Umwelterfahren werden können.
Wenn die Umwelt nur als die eine aktive Seite betrachtet wird und der Mensch als ein"unter den Bedingungen"beeinflusstesEtwasverstanden wird, erscheint es so, dass der Mensch passiv Situationen hilflos ausgeliefert ist. Wenn jedoch ein Bewusstsein darüber geschaffenwerden kann,dass Umwelt immer aktiv interpretiert wird und somit Einfluss auf die Gestaltung genommen werden kann, ermöglicht dies auch Verantwortung und Persönlichkeitsentwicklung:
"[J]e mehr mir bewußt wird, wie ich mein Umfeld interpretiere, meine Realität konstruiere, desto mehr erkenne ich auch, wer ich bin: Ich gebe mir die Möglichkeit, zu einer personalen Identität zu finden. Für das, was ich [...] entscheide und in Verhalten und Handeln umsetze, bin ich immer (mit-)verantwortlich."[16]
Diese Bewusstheit über die eigene aktive Mitgestaltung der Umwelt im interpretativen Kontext verlangtjedoch eine mehrdeutigeIntentionalität.
Die Ambiguität oder auch"uneins sein"[17]meint"ein Gemisch aus entgegengesetzten Dingen"[18].
"Diese Zwiespältigkeit [...], mit der Merleau-Ponty die herkömmliche Synthese der Oppositionen von These und Antithese im dialektischen Denkenaushebeln und gleichsam ersetzen will, lässt ihn nach einer eigenständigen Figur zur Beschreibung dieses dritten Zustands des Zwischen suchen [...]."[19]
Demnach versucht Merleau-Ponty Ontologien wie Schwarz-Weiß, Liebe-Hass oder Frau-Mannmit einer dritten Instanz zu ergänzen.Somit werden Extreme nicht mehr als dualistische"Richtig oder Falsch"–Wahrheiten erfahren, sondern als"Zwei von Vielen"oder als ein"Wechselspiel aus Zweien".Es gibt nicht nur Falsch oder Richtig.Ob eine Sacheals richtig oder falsch empfunden wird, hängt immer vom Betrachtungswinkel und subjektiven Erleben ab.DiesesZwischenmeint eine Beschreibung der Mannigfaltigkeit und somit ist nach Merleau-Ponty das
"...Ertragen und Erleben der Ambiguität Voraussetzung für ein wahrhaftiges, weil die Vielzahl der Bezüge ins Auge fassendes Denken."[20]
DiesesBekenntnis von Mehrdeutigkeitbeinhalteteine Zurückhaltung von voreiligen Rückschlüssenund beschreibt eineEpoché.Um diese Enthaltung oder auchdiesenHaltepunkt näher zu beleuchten, beschreibe ich im Folgenden einen ganzheitlich betrachtenden Ausgangspunkt für die Veränderung von Lebenssituationen nachMartina und ReinhardFuhr.
Mit Einbezugdes oben erläuterten Haltepunkteswird versucht,eine Akzeptanz von dem herzustellen,was ist, um aus diesem Zustand neue Möglichkeiten erwachsen zu lassen. Denn
"...Wandel vollzieht sich erst im Wechselspiel (nicht im Kampf!) zwischen dem Akzeptieren dessen, was ist (d.h. nicht verändern wollen) und dem Verändern-Wollen (d.h. nicht akzeptieren, was ist). Dies ist ein Wechselspiel von Polaritäten, die erst gemeinsam ein Ganzes ergeben."[21]
Es geht demnach um ein ganzheitliches Verständnisvon Veränderungsprozessenund"Sowohl-als-auch-Denken".BevorVeränderung fruchtbar werden kann,muss auch der momentane Zustand einer Lebenssituation mit einbezogen und akzeptiert werden. Wenn der Fokus ausschließlichdarauf liegt, den wünschenswerten Zustand zu erreichen,geht dies häufig mit Verzweiflung oder Stagnation einher.Erst derMiteinbezug und die Akzeptanz desIst-Zustandes als AusgangspunkteeinerLebenssituationermöglicheneine Entwicklung oder Veränderung.[22]
In diesem Kapitelwurdeein Fundament fürein erstes Verständnis vonGanzheit in derdialogischenBeratung nach Fuhrgeschaffen. Des Weiteren soll dieseerkenntnistheoretischeGrundlage basal für die Dekonstruktionsweisevon Geschlechtnach Jacques Derrida und Judith Butlerdienen, welche in dieser Arbeit unter dialogischer Betrachtungsweiseuntersuchtwird.
Im ersten Teil (2.1.) bezog ich mich auf die Phänomenologie von Maurice Merleau-Ponty, in welcher der Leib als unsere Verankerung in Welt verstanden wird.Merleau-Ponty geht davon aus, dasseinefundamentaleLebenswelt, welche indenLeib eingelassen ist, kulturell und biographischgeprägtist.Daraus resultiert, dass der Mensch leiblich gebunden ausschließlich subjektivzur Welt ist und esdemnachnicht möglicht ist,Gegenstände und Menschenin Welt, losgelöst von Leib, zu erfahrenbzw. wahrzunehmen, da der Mensch selbstderLeib ist.DerLeib ist ein Vermittler von Welt und somit ist Intentionalität als einelebendig-subjektive Erfahrungvon Welt zu denken, in der Dinge intensiver erlebt werden können, wenn ein Bewusstsein für unbeschränkte Deutungsfreiheit geschaffen wird.Somit ist Erkenntnis ein schöpferischer, lebendiger und heilender Prozess.Für die Soziale Arbeit heißt dies, dass in Beratungssituationen eine Möglichkeit besteht, sich dieser Lebendigkeit anzunehmen und einen Raum zu gestalten, in dem Deutungsfreiheit begrüßt wird. Sodann kann eine lebendige Beratungsatmosphäre entstehen, in der anderen Menschenoffenbegegnet wird undfeststehendeBinaritäten hinterfragt werden können.
Im zweiten Teil (2.2.)zeigteich aufgrund der thematisierten Ambiguität, inwieweit eine Reflexion vonDualismen dazu dienen kann, das naiveZur-Welt-seineinzuklammern,um Dinge in Welt mehrheitlichbetrachten zu können.Dieses Bekenntnis zur Mannigfaltigkeit von Dingenbraucht es meiner Meinung nach,umAmbivalenzen in Beratungssituationen, wie in dem Beispiel der Veränderung von Lebenssituationen, stehen lassen zu können. Dies bedeutet für diedialogische Beratung nach Fuhr eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Diese ist sowohlfür Beraterals auch für die Persönlichkeitsentwicklungvon Klientenunausweichlich.In der 1991 entwickelten dialogischen Beratung nach Martina und ReinhardFuhr wird nach dem Gestalt-Ansatz gearbeitet, welcherunter anderemganzheitliches Denken zum Thema hat.[23]Im folgenden Kapitel gebe ich Einblick in das dialogische Denken,Handelnund Fühlenin der beraterischen Praxisund stelleGestaltdenkenvor. Ichverfassesomitein Profil der dialogischen Beratung nach Fuhr und verknüpfe diesesim späteren Verlauf mit der dekonstruktivenDenkweisenach Jacques Derrida. In diesem Kontextzeigeicham Beispiel Geschlecht, wieeinZwischenraumim Dialog nach Martin Buber die Konstruktion bzw. Ontologie Frau-Mann durch die ganzheitliche Erfahrung verschwimmen lässt.Dies stellt die zu beratende Person als ganzheitlichesWesen dar,lässt stigmatisierendeGeschlechterzuschreibungen in den Hintergrundtretenund bietetsomit einen Raum andere Identitäten zu gestalten.In der dialogischen Begegnung stehtnicht die Frau oder der Mann im Fokus,sondern die Person als ganzheitliches"Du".
3. Die Dialogische Beratung nach Fuhr
"Die Beziehung zum Du ist unmittelbar. Zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen und keine Phantasie: und das Gedächtnis selber verwandelt sich, da es aus der Einzelung in die Ganzheit stürzt. Zwischen Ich und Du steht kein Zweck, keine Gier und keine Vorwegnahme [...]."[24]
Wie bereits mehrfach erwähnt, steht in der dialogischen Beratung nach Martina und ReinhardFuhr ganzheitliche Erkenntnis für einen schöpferischenund daher heilendenProzess. Es geht um eineprozessorientierteEntdeckungsreise im Gesprächmit Klienten[25], inderVielfältigkeit, kreative Möglichkeiten und Widersprüchlichkeit zurück ins Lebengerufenwerden.Neue und andersartige Perspektiven und Ansichten werdenentwickelt, welche zur Persönlichkeitsentwicklung beitragenkönnen.
"Eine der Aufgabendialogischer Beratung ist es, unangemessene oder unnötige Separationen im Bewußtsein des Menschen durchlässiger werden zu lassen, also Ganzheitlichkeit zu fördern."[26]
So gibt die dialogischeBegegnungMut,dieWechselbeziehung zwischen Menschund Umfeld kreativerund intuitiverzu gestalten.Somit wird aus derlebendigenErfahrung im Dialog dazu beigetragen,Formen des Selbstausdrucks, der (Geschlechts-)Identitätund der Lebensgestaltung zuentwerfen.Dies kann sowohl Bodenlosigkeit als auch Freiheit bedeuten. Zum einen kann es anfangs zu Verwirrungen oder gar Ängsten führen,sich mit diesem erweiterten Bewusstseinauseinander zu setzen. Zum anderenaber kannebendiese Erfahrung als Entledigung einer großen Last empfunden werden, da die erweiterte Wahrnehmung ein breiteres Spektrum an Handlungs- und Bedeutungsalternativen hervorbringt.[27]DasAnliegen von Klienten steht zwar im Fokus, dennochgestaltenBerater[28]ebenso wie Klienten den dialogischen Prozess mit.[29]
Klienten werden als erwachseneund mündigePersonen betrachtet, welche sich ihrer Handlungsweisen im weitesten Sinne bewusstsindoder ohne große Schwierigkeitenbewusst werden können. Dies schließt ein, dass davon ausgegangen wird, dass Klienten Verantwortung für viele der jeweiligen Lebenssituationen übernehmen können.Dialogische Beraterübernehmen demnach keine Verantwortung für Klienten, wohl aber für Handlungsweisen und eigene Einstellungen gegenüber Klienten.[30]
Somit hat die dialogische Beratung dahingehend ihre Grenzen, wenn Klienten über keinerlei Selbstwertschätzung verfügen. Klienten sindin diesem Stadium kaum für dialogische Prozesse erreichbar. Bevor Anforderungen der Bewusstseinserweiterung und des Erwachsenseins gestellt werden können, müssen hier primär tiefgreifendere therapeutische Settings in einem geschützten Raum greifen.[31]
DialogischeBeratung versteht sich nicht als Konkurrenz von Therapie, sondern als eine selbstständige Form von Unterstützung diverser Bewältigungen von Lebensaufgaben von Klienten. Diese Anliegen oder Probleme werden zusammen mit Klienten rekonstruiert und aus verschiedenen Perspektiven–wie lebensgeschichtlich, kulturell oder institutionell–rekonstruiert.[32]
Geradeweil die dialogische Beratung lebensnah und in direkter und authentischerBegegnungzumKlienten steht, werden keine festen Regeln oder Methoden nach demkausalen"Wenn dies passiert, dann handle so"-Prinzip beschrieben. Berater sind im Dialog mit ganzheitlicher Persönlichkeit in der Wechselbeziehung mit Klienten.Dennoch gibt es dialogische Prinzipien und Merkmale,dieeinen Dialog erkennbar machen.[33]Zudem wird nach dem Gestalt-Ansatz gearbeitet, welcher in diesem Kapitel noch ausgiebigbehandelt wird.
DiedialogischeHaltung,dieich in diesemTeilnäher erläutern werde,zeichnethieraus, dass diese sowohl in Beratungssituationen als auchimprivatenLebenPlatz findet.Es geht darum,dass BeraterKlientenalseineungeteilte, bewusstePerson[34]begegnenundihnen bedingungslose Wertschätzung, Vertrauen undeinen gleichwürdigen Umgang entgegenbringen.Dies
"...schließt die Bereitschaft ein, Empfindungen und Gefühle gegenüber dem anderen zuzulassen."[35]
Eine dialogische Haltungistimmer eine in sich persönliche Entwicklung und ein nieendender Prozess der Bewusstwerdung eigener Wahrnehmungen und Empfindungen.
So könnenin einemBeratungsgesprächauchGefühlewie empfundene Angst, Machtdynamikenoder Scham aufgedecktund interveniertwerden,was wiederumin einen Dialog mündenkann.[36]
Diese erweiterte Wahrnehmung beruht auf Gewahrsein, welches als
"...das unmittelbare Wahrnehmen und Erkennen von umfassenderen Zusammenhängen [...]"[37]
bezeichnet wird.Gewahrsein setzt sich nach Perls, Hefferline und Goodman aus Kontakt, Sinneswahrnehmung, Erregung und Gestaltbildung zusammen. Kontakt wird als Fokus auf etwas verstanden. Dieser ist auch oh





























