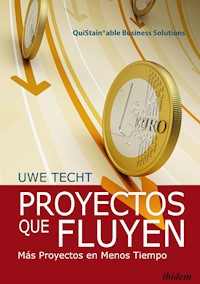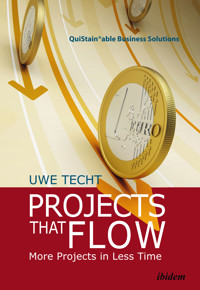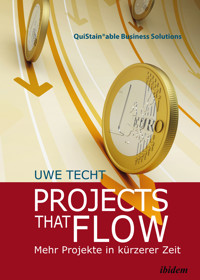
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: QuiStainable Business Solutions
- Sprache: Deutsch
Projekte überschreiten Liefertermine und Kosten. Abstriche an den Spezifikationen werden in Kauf genommen. Wirtschaftliche Schäden für Unternehmen und Kunden sind die Folge. Doch die Schwierigkeiten sind oft hausgemacht. Etablierte Kennzahlen und Managementmethoden erzeugen Handlungs- und Entscheidungskonflikte; sie bremsen Projekte aus. Ein radikal anderes Vorgehen ist erforderlich: • Fokus auf Geschwindigkeit, auf ProjectsFlow • Einfache, engpassorientierte Steuerung mit robusten Prioritäten • Unternehmens- statt Bereichsoptimierung Lesen Sie, wie Sie • Projekte mit gleichen Ressourcen realisieren, • Projektlaufzeiten deutlich verkürzen, • alle Projekte zuverlässig abschließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de.
Coverabbildung: D 24048836 © Auris | Dreamstime.com
Gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreien Papier Printed on acid-free paper
ISSN: 2199-2975
ISBN-13: 978-3-8382-0651-6
© ibidem-Verlag Stuttgart 2014
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und elektronische Speicherformen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronical, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.
Printed in Germany
Inhalt
Dank
1 Einführung
2 Management Summary: Mehr Projekte in kürzerer Zeit
2.1 Ausgangssituation
2.2 Neue Wege im Multiprojekt-Business
2.3 Herausforderungen im Veränderungsprozess
Teil 1 Die Realität in Multiprojektunternehmen
3 Unzuverlässigkeit und lange Lieferzeiten
3.1 Schäden durch Unzuverlässigkeit im Projektgeschäft
3.2 Implikationen langer Projektlaufzeiten
3.3 Schäden bei internen Projekten
3.4 Kosten / Spezifikationen „wichtiger“ als Zeit?
3.5 Chancen und Nutzen der Verbesserung
4 Variabilität, Murphy’s Law und schädliche Managementmechanismen
5 WIP und Ressourcennutzung
5.1 Die Matrix (Ressourcen / Projekte)
5.2 Knappe Ressourcen / effiziente Nutzung
5.3 Kampf um Ressourcen
5.4 Entscheidungsdruck der Ressourcenmanager
5.5 Schädliches Multitasking
5.6 Dünne Ressourcenverteilung
5.7 Desynchronisation
5.8 Fehlender Fokus und Multitasking bei Managementund Support-Funktionen
5.9 Hoher WIP erzeugt lange Projekte und hohe Kosten .
5.10 Schneller Projektstart
5.11 WIP-Teufelskreis
5.12 Schlechte Vorbereitung und Fehler
5.13 Notleidende Projekte erhalten Vorfahrt
6 Projektplanung und -steuerung
6.1 Termine und Meilensteine
6.2 Sicherheiten im Projektplan
6.3 Parkinson’s Law
6.4 Ressourcenzuteilung nach Plan
6.5 Studentensyndrom
6.6 Sicherheits-Teufelskreis
6.7 Verzögerung an Integrationspunkten
6.8 Verfrühungen? Verspätungen!
7 Handlungs- und Entscheidungskonflikte
8 Arbeitsmaterialien
8.1 Situation des Unternehmens
8.2 Zuverlässigkeit der Projekte
8.3 Implikationen: Schäden für Ihr Unternehmen
8.4 Potentieller Nutzen
8.5 Handlungsbedarf und Hinderungsgründe
8.6 Managementmechanismen
8.7 Handlungs- und Entscheidungskonflikte
8.8 Ursache & Wirkung
8.9 Fazit
9 Zusammenfassung und Ausblick
9.1 Variabilität
9.2 Projekte kämpfen um Ressourcen, WIP-Teufelskreis
9.3 Effizienz vor Effektivität
9.4 Parkinson’s Law
9.5 Fazit
9.6 Anforderungen an effektives Projekt- und Multiprojektmanagement
Teil 2 Die Zukunft im Multiprojektmanagement
10 Kernproblem: lokale Optimierung
11 Lösung: höchste Priorität!?
12 Work in Process steuern
12.1 Projekte am Engpass staffeln
12.2 Management als Engpass
12.3 Virtual Drum
12.4 Nutzen
12.5 Zusammenfassung
13 Explizite Sicherheiten planen
13.1 Sicherheiten bündeln
13.2 Staffelläufer-Prinzip
13.3 Größe der Sicherheit
13.4 Projekt- und Integrationspuffer
13.5 Exkurs: Kritischer Weg und kritische Kette
13.6 Praktisches Vorgehen
13.7 Zusammenfassung
14 Operativ steuern mit robusten und synchronisierten taktischen Prioritäten
14.1 Notwendigkeit taktischer Prioritäten
14.2 Anforderungen an taktische Prioritäten
14.3 Identifikation taktischer Prioritäten
14.4 Taskmanagement
14.5 Projektmanagement
14.6 Wirkung auf Klima und Zusammenarbeit
14.7 Topmanagement-Intervention
14.8 Projektstatus
14.9 Warnungen und Hinweise
14.10 Zusammenfassung
15 ProjectsFlow® – Zusammenfassung
16 Arbeitsmaterialien
16.1 Ursache und Wirkung
16.2 Aufgelöste Handlungs- und Entscheidungskonflikte.
16.3 Nutzen
16.4 Negative Nebeneffekte
16.5 Hindernisse / Stolpersteine für die Umsetzung
Teil 3 Transformation
17 Einführung: Transformation
18 Von der traditionell geführten zur Hochleistungsorganisation
19 Phase 1: Work in Process (WIP) reduzieren
19.1 Schritt 1.1: Projekte einfrieren
19.2 Schritt 1.2: Projekte beschleunigen
19.3 Schritt 1.3: Projekte auftauen
19.4 Schritt 1.4: Neue Projekte starten
19.5 Zusammenfassung Phase 1
19.6 Fazit
20 Phase 2: Gute Vorbereitung
20.1 Schritt 2.1: Aktuelle Projekte gut vorbereiten
20.2 Schritt 2.2: Gute Vorbereitung definieren
20.3 Schritt 2.3: Umgang mit besorgten Kunden
20.4 Zusammenfassung Phase 2
20.5 Fazit
21 Phase 3: Planung transformieren
21.1 Schritt 3.1: Projektnetzpläne erstellen
21.2 Schritt 3.2: Explizite Sicherheiten, kritische Kette
21.3 Schritt 3.3: Projekte staffeln
21.4 Schritt 3.4: Neue Projekte integrieren
21.5 Zusammenfassung Phase 3
21.6 Fazit
22 Phase 4: Steuerung transformieren
22.1 Schritt 4.1: Rückmeldung zum Fortschritt
22.2 Schritt 4.2: Taskmanagement
22.3 Schritt 4.3: Projektmanagement
22.4 Schritt 4.4: Topmanagement
22.5 Schritt 4.5: Geschwindigkeit anpassen
22.6 Zusammenfassung Phase 4
22.7 Fazit
23 Phase 5: Kunden und Lieferanten
23.1 Schritt 5.1: Schädliche Einflüsse von Kunden abmildern und reduzieren
23.2 Schritt 5.2: Fremdvergebene Teilprojekte
23.3 Schritt 5.3: Schnelle und zuverlässige Lieferanten
23.4 Zusammenfassung Phase 5
23.5 Fazit
24 Phase 6: Kapazität erweitern
24.1 Schritt 6.1: Prozesse verbessern
24.2 Schritt 6.2: Ressourcen aufbauen
24.3 Schritt 6.3: Sprint
24.4 Zusammenfassung Phase 6
24.5 Fazit
25 Veränderungsprozess Zusammenfassung
26 QuiStainable Change
26.1 Widerstände gegen Veränderungen
26.2 Anforderungen an bedeutende Verbesserungsinitiativen
26.3 Verbesserungs-WIP
26.4 Implementierung in Hochgeschwindigkeit
27 Zusammenfassung und Ausblick
28 Literatur
28.1 Literaturverzeichnis
28.2 Weiterführende Literatur
Dank
Dr. Eliyahu M. Goldratt hat mit Begründung und Entwicklung der Theory of Constraints und des Critical Chain Projektmanagements die Basis für meine Überlegungen und Darstellungen gelegt.
Sanjeev Gupta und sein Team von Realization Technologies Inc. haben ihre weltweit gesammelten Erfahrungen immer wieder gebündelt und weitergegeben.
Jaideep Srivastav hat mir tiefe Einblicke in die Dynamik von Veränderungsprozessen ermöglicht.
Dr. Georg Angermeier hat mir bei vielen Artikeln wertvolle Hinweise zur leserorientierten Darstellung gegeben.
Mit Claudia Simon, Jens-Olaf Schumacher und Gerhard Stix sind frühere Fassungen der in dieses Buch eingeflossenen Texte entstanden.
Rudolf G. Burkhard, Franz Nowak und Wolfram Müller haben mir stets profunde Rückmeldungen zu meinen Präsentationen und Texten gegeben.
Claudia Simon und das Office Team von VISTEM haben die Entstehung dieses Buchs in allen Phasen und mit allen Höhen und Tiefen tatkräftig unterstützt.
Ihnen allen danke ich von Herzen.
Uwe Techt November 2013
1 Einführung
Projekte überschreiten Termine und Kosten oder liefern eingeschränkte Funktionen und Qualität. Wirtschaftliche Schäden – für Unternehmen und ihre Kunden – sind die Folge.
Die Schwierigkeiten sind hausgemacht. Etablierte Kennzahlen und Managementmethoden erzeugen Handlungs- und Entscheidungskonflikte; sie bremsen Projekte aus.
Ein radikal neues Vorgehen ist erforderlich:
Einfache engpassorientierte Steuerung
Eindeutige, robuste Prioritäten
Unternehmens- statt Bereichsoptimierung
Fokus auf Geschwindigkeit – auf
ProjectsFlow®
Lesen Sie, wie Sie
mehr Projekte mit den gleichen Ressourcen realisieren,
alle Projekte zuverlässig liefern und
die Projektlaufzeiten deutlich verkürzen.
In Teil 1 „Die Realität im Multiprojektunternehmen“ beschreibe ich die typische IST-Situation einer Multiprojektorganisation:
Probleme im Projektgeschäft, Auswirkungen der Probleme, potentieller Nutzen durch Verbesserung
Zusammenhänge, Ursache-Wirkungs-Beziehungen
In Teil 2 „Die Zukunft im Multiprojektmanagement“ erkennen Sie, unter welchen Bedingungen die Multiprojektorganisation sehr viel zuverlässiger, schneller und effizienter arbeiten kann:
Work in Process steuern, explizite Sicherheiten planen, operative Prioritäten für die Steuerung nutzen;
Lösungsrichtung, Lösungsbausteine und ihre positiven Wirkungen;
potentielle negative Nebeneffekte, Vorbeugung.
In Teil 3 „Transformation“ beschreibe ich den Weg der Veränderung im Detail:
Umsetzungshindernisse und Widerstände
Veränderungsprozess
Projektplan
Notwendige Vorbereitung: Einigkeit im Management
Die integrierten Arbeitsmaterialien (Analysefragen, Logik-Diagramme, Checklisten etc.) helfen Ihnen, die Überlegungen konkret auf die Situation Ihres Unternehmens anzuwenden und dabei folgende Fragen zu klären:
Entspricht die IST-Situation meines Unternehmens den hier dargestellten Annahmen? (Symptome, Ursachen, Ursache-Wirkungs-Beziehung)
Können die dargestellten Lösungsbausteine die Performance unserer Multiprojektorganisation signifikant verbessern?
Welche Auswirkungen entstehen dadurch auf das gesamte Unternehmen?
Wie kann ich meine Kollegen, Führungskräfte, Mitarbeiter an die notwendigen Veränderungen heranführen?
Mit welchen Widerständen kann ich rechnen und wie gehe ich damit um?
Welche negativen Nebenwirkungen könnten durch die Veränderungen entstehen? Wie kann ich / können wir diesen vorbeugen?
Welche Umsetzungshindernisse könnten auftreten? Und wie können wir diese umgehen?
Die Arbeitsmaterialien stehen auf arbeitsmaterial.projectsflow.de zum Download bereit.
Wenn beim Durcharbeiten Fragen entstehen, freue ich mich auf Ihre Nachricht unter [email protected]!
2 Management Summary: Mehr Projekte in kürzerer Zeit
Zuverlässigkeit, Agilität und Hochgeschwindigkeit im Projektgeschäft
2.1 Ausgangssituation
Viele Projekt- und Multiprojektorganisationen leiden darunter, dass
ihre Projekte schon im Plan zu lange dauern und zu teuer sind und
sie kaum ein Projekt rechtzeitig, im Kostenrahmen und bei voller Erfüllung der Spezifikationen abschließen können.
Diese Tatsache hat tiefgreifende Konsequenzen für das Unternehmen und seine Partner:
Kunden leiden wirtschaftlich
Lieferanten geraten unter Druck
Mitarbeiter und Führungskräfte stehen unter Stress
Zahlungen gehen später ein
Rendite und Liquidität leiden
Variabilität
Ein Grund für Verzögerungen, Verspätungen und lange Projektlaufzeiten ist Variabilität:
Wie lange die Erledigung einer Aufgabe tatsächlich dauern und wie aufwändig sie sein wird, kann man vorher nicht wissen.
Wie viele Änderungswünsche der Kunde haben wird und welche Auswirkungen daraus auf das Projekt entstehen, kann man vorher nicht wissen.
Trotz bester Planung kann sich herausstellen, dass man etwas übersehen hat.
Dauern Vorgänge länger als geplant oder werden zusätzliche Aktivitäten erforderlich, entstehen Verspätungen oder höhere Kosten. Oft werden auch Abstriche an den Spezifikationen gemacht, um den versprochenen Termin oder die budgetierten Kosten einzuhalten.
Die weitaus größere Ursache für Unzuverlässigkeit ist jedoch die Art und Weise, wie Unternehmen versuchen, Zuverlässigkeit zu bewirken:
Projekte kämpfen um Ressourcen
Projekte sollen schnell und zuverlässig sein. Dafür setzt das Unternehmen Projektmanager ein. Jeder Projektmanager ist nur für sein eigenes Projekt, nicht aber für die Projekte seiner Kollegen oder gar für das Gesamtergebnis des Unternehmens verantwortlich. Folge: Projektmanager konkurrieren und kämpfen um die Mitarbeiter und andere knappe Ressourcen.
Dadurch zwingen sie die Ressourcenmanager (Abteilungs- /Gruppenleiter) zu dünner Ressourcenverteilung und zu schädlichem Multitasking. Infolge dessen vervielfachen sich die Projektlaufzeiten. Sind Verspätungen bereits an der Tagesordnung, müssen Projektmanager ihre Projekte so früh wie möglich starten; erst dann sind sie berechtigt, am Kampf um die Ressourcen teilzunehmen. Allerdings steigt so der „Work in Process“ weiter an. Ein Teufelskreis!
Abbildung 1: WIP-Teufelskreis
Effizienz vor Effektivität
Ressourcen sollen effizient genutzt, d.h. möglichst gut ausgelastet sein. Gleichzeitig sollen die richtigen Ressourcen für die Projekte verfügbar sein. Deshalb setzt das Unternehmen Ressourcenmanager ein. Diese stehen im Dilemma zwischen „mehr Ressourcen aufbauen“ (um immer alle Projekte sofort bedienen zu können) und „weniger Ressourcen aufbauen“ (um einen möglichst hohen Auslastungsgrad aller Ressourcen zu erzielen).
Abbildung 2: Ressourcenaufbau-Dilemma
Der Kostendruck übersteigt zumeist den Zuverlässigkeitsdruck. Aus diesem Grund tendieren Ressourcenmanager dazu, „weniger Ressourcen aufzubauen“, was wiederum den WIP erhöht. Die Folgen sind oben dargestellt.
Parkinson’s Law
Mitarbeiter, die danach beurteilt werden, ob sie mit der geplanten Zeit auskommen, planen sich individuelle Sicherheiten ein, um zuverlässig sein zu können. Diese Sicherheiten werden während der Projektrealisierung verbraucht, damit zukünftige Zeitschätzungen nicht gekürzt werden.
Dieser Effekt ist unter dem Namen „Parkinson’s Law“ bekannt: „Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht“.
Die Auswirkungen sind:
Verfrühungen entstehen nicht;
Verspätungen können nur schwer wieder eingeholt werden.
Infolgedessen werden Projekte normalerweise nicht rechtzeitig fertig, teurer als geplant oder sie liefern die versprochenen Ergebnisse nicht in vollem Umfang.
Mechanismen und Regeln, die dem Paradigma der lokalen Optimierung entstammen, führen dazu, dass Bereiche und Funktionen widersprüchliche bzw. konkurrierende Zielsetzungen verfolgen müssen. Daraus entstehen suboptimale Leistungen und eine unbefriedigende Unternehmenskultur.
Zusammenfassung der Ausgangslage
Unternehmen haben Mechanismen und Regeln entwickelt, die dazu dienen sollen, unternehmerische Ziele trotz Unsicherheit und Murphy’s Law zu erreichen. Viele dieser Mechanismen und Regeln entstammen dem Paradigma der lokalen Optimierung – „Die Optimierung von Teilen führt automatisch zur Optimierung des Ganzen“:
Projektmanager müssen um Ressourcen konkurrieren
Ressourcenmanager dürfen keine untätigen Ressourcen haben
Mitarbeiter müssen sich absichern
Mechanismen und Regeln, die dem Paradigma der lokalen Optimierung entstammen, führen dazu, dass Bereiche und Funktionen widersprüchliche bzw. konkurrierende Zielsetzungen ver-verfolgen müssen. Daraus entstehen suboptimale Leistungen und eine unbefriedigende Unternehmenskultur.
Der Begriff „Murphy’s Law geht auf den Ingenieur Edward A. Murphy jr. zurück. Es lautet: „Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ („Whatever can go wrong will go wrong.“)
2.2 Neue Wege im Multiprojekt-Business
Jeder Manager weiß, dass es möglich ist, ein einzelnes Projekt in einem Bruchteil der üblichen Zeit zu verwirklichen. Dazu müssen Mitarbeiter, Manager und die Geschäftsleitung dem Projekt (im Folgenden „Projekt A“ genannt) während seiner gesamten Laufzeit höchste Priorität zuweisen und dafür sorgen, dass Projekt A notwendige Ressourcen, Unterstützung oder Entscheidung erhält.
So wird erreicht, dass jeder Vorgang in der kürzestmöglichen Zeit abgeschlossen wird, weil
der Vorgang optimal mit Ressourcen ausgestattet und nicht wegen wechselnder Prioritäten unterbrochen wird;
wegen der optimalen Ressourcenausstattung und des unterbrechungsfreien Arbeitens Bedingungen entstehen, die es sonst im Unternehmen nicht gibt. Deshalb spielen die ursprünglichen Zeit- und Aufwandsschätzungen keine Rolle mehr (dürften also deutlich unterschritten werden);
das Projekt jede Unterstützung (durch Manager und andere Bereiche) erhält, sobald diese Unterstützung sinnvoll ist; dazu kann auch gehören, Anreize für Lieferanten zu schaffen, damit sie schneller liefern.
Zudem wird erreicht, dass es kaum Wartezeit zwischen den Vorgängen gibt, weil die erforderlichen Ressourcen jederzeit bereitstehen, sofern sie nicht gerade durch einen anderen Vorgang in Projekt A gebunden sind.
Das Problem ist allerdings: Die eindeutige Bevorzugung von Projekt A geht zu Lasten aller anderen aktiven Projekte. Diese werden noch später fertig.
Dennoch wird immer wieder zu dieser Vorgehensweise gegriffen; nach kurzer Zeit tauchen dann weitere A-Projekte auf. Damit landet man wieder in der Ausgangssituation.
Die Herausforderung in der Steuerung einer Multiprojektorganisation besteht also darin, möglichst jedem Projekt die Bedingungen von Projekt A zu verschaffen; und zwar ohne dafür zusätzliche Ressourcen zu benötigen oder in anderer Weise die Kosten hochzutreiben.
Wie ist das möglich?
Arbeitslast reduzieren
Dünne Ressourcenverteilung, schädliches Multitasking, Desynchronisation und Defokussierung entstehen dadurch, dass die aktiven Projekte sich gegenseitig in die Quere kommen. Das ist der Fall, wenn die Arbeitslast (nachfolgend Work in Process oder WIP genannt) zu hoch ist: Es sind mehr Projekte aktiv, als die Organisation verkraften kann, ohne dass sich die Projekte gegenseitig behindern.
Um signifikant besser zu werden, reduziert das Unternehmen den Work in Process auf ein sinnvolles Niveau und sorgt anschließend dafür, dass das reduzierte WIP-Niveau aufrechterhalten bleibt.
Es wird daher zunächst ein Teil der Projekte eingefroren, was die Abarbeitung der nicht eingefrorenen Projekte beschleunigt. Die eingefrorenen Projekte werden dann schrittweise und kontrolliert wieder „aufgetaut“. Anschließend werden die neuen Projekte so gestartet, dass der Work in Process nicht wieder „hochschwappt“.
Dazu werden die Projekte in der Reihenfolge ihrer strategischen Priorität am Engpass des Unternehmens gestaffelt; mehr als der Engpass kann das Unternehmen ohnehin nicht leisten.
Umfangreiche Erfahrungen zeigen, dass eine 25%ige WIPReduzierung die Leistung der Organisation um mindestens 20% erhöht. Erhöht sich die Performance, werden alle – auch die vorübergehend eingefrorenen – Projekte früher fertig.
Tabelle 1: Reduzierter WIP erzeugt höhere Performance
Staffelläufer-Prinzip und explizite Sicherheiten
Im Projektgeschäft sind Sicherheiten – wegen Variabilität und Murphy’s Law – erforderlich; ohne Sicherheiten kann kein Projekt auch nur annähernd zuverlässig sein. Werden Mitarbeiter nach individueller Termineinhaltung beurteilt, planen sie (und ihre Manager) erhebliche individuelle Sicherheiten ein und verbrauchen diese (Parkinson’s Law). So arbeiten Mitarbeiter scheinbar zuverlässig; die Projekte sind jedoch schon im Plan länger als nötig und dennoch unzuverlässig.
Um signifikant besser zu werden, implementiert das Unternehmen eine Arbeitsweise, in der die schnellstmögliche Abarbeitung jeder begonnenen Aufgabe im Vordergrund steht. Zu diesem Zweck
vermittelt das Management den Mitarbeitern glaubwürdig, dass sie nicht mehr nach individueller Termineinhaltung beurteilt werden;
plant das Unternehmen die Projektvorgänge ohne individuelle Sicherheiten und weist stattdessen gebündelte explizite Sicherheiten für jedes Projekt aus.
Umfangreiche Erfahrungen zeigen, dass diese Vorgehensweise schnell folgende Wirkungen erzeugt:
Plandauer der Projekte wird um wenigstens 25% reduziert.
Die reduzierte Projektdauer wird in der Regel zuverlässig eingehalten (während zuvor die längere Plandauer meist überschritten wurde).
Synchrone operative Prioritäten
Variabilität und Murphy’s Law sorgen dafür, dass es anders kommt als geplant. Trotz des reduzierten WIP werden daher Projekte (und die Projektmanager) immer wieder um Ressourcen und Managementaufmerksamkeit konkurrieren. Erneut drohen dünne Ressourcenverteilung und Multitasking mit ihren schädlichen Wirkungen.
Um signifikant besser zu werden, stellt das Unternehmen (durch ein geeignetes System) den Ressourcen und allen Managementfunktionen (Ressourcen-, Projekt- und Topmanagern) eindeutige, robuste und synchronisierte operativen Prioritäten zur Verfügung·
Diese Prioritäten bewirken:
Ressourcenmanager starten Projektvorgänge in der für das Unternehmen richtigen Reihenfolge, statten sie optimal mit Ressourcen aus und schützen die Mitarbeiter vor Störungen, die Multitasking induzieren.
Projektmanager kümmern sich um die Vorbereitung nicht gestarteter Projektvorgänge und unterstützen die Ressourcen bei der Abarbeitung aktiver Vorgänge. Sie versuchen nicht mehr, an anderen Projekten arbeitende Ressourcen zu unterbrechen (weil sich dies nachteilig für sie selbst auswirkt).
Höhere Führungskräfte halten sich aus der Projektrealisierung heraus und intervenieren nur dort, wo ihre Unterstützung einen erheblich beschleunigenden Beitrag leisten kann. Konkurrieren mehrere Projekte um ihre Aufmerksamkeit, wissen sie, welches Projekt zuerst versorgt wird und welche anderen Projekte warten müssen.
Die operativen Prioritäten werden laufend automatisch ermittelt. Sie basieren auf dem Verhältnis zwischen Projektfortschritt und verbrauchter, expliziter Sicherheit; ein objektiver Wert, der nicht dem „Gefühl“ des Projektmanagers unterliegt.
Umfangreiche Erfahrungen belegen, dass durch diese Vorgehensweise
dünne Ressourcenverteilung und schädliches Multitasking weitestgehend verschwinden;
Reibungsverluste drastisch abnehmen, während ein Klima der produktiven Zusammenarbeit entsteht;
der Bedarf für operative Prioritätsabstimmungen entfällt, was die Besprechungszeiten erheblich reduziert;
mit denselben Ressourcen signifikant mehr Projekte fertiggestellt werden.
2.3 Herausforderungen im Veränderungsprozess
Die notwendigen Veränderungen in der Planung und Steuerung des Portfolios basieren auf „gesundem Menschenverstand“. Daher ist es in der Regel nicht schwierig, die aktive Mitwirkung der Führungskräfte und Mitarbeiter zu bewirken.
Ein großer Vorbehalt von Mitarbeitern und unteren Führungskräften ist fehlendes Vertrauen; sie glauben nicht, dass die höheren Führungskräfte sich selbst nachhaltig an die erforderlichen Veränderungen halten werden. Führungskräfte können diesen – oft berechtigten – Vorbehalt nur durch glaubwürdige Vorbildwirkung entkräften.
Die eigentliche Herausforderung der Veränderung liegt jedoch in der aus dem Erfolg resultierenden Gefahr:
Mitarbeiter und Führungskräfte verstehen sehr schnell, dass die Veränderungen zu einer signifikant erhöhten Kapazität führen werden. Sie fragen daher zu Recht, wie die gewonnene Kapazität genutzt werden soll. Darauf muss die Geschäftsführung eine überzeugende Antwort liefern und erforderliche Maßnahmen (z.B. im Verkauf) realisieren.
Teil 1
Die Realität in Multiprojektunternehmen
Ausgangsituation und Veränderungsbedarf
3 Unzuverlässigkeit und lange Lieferzeiten
Viele Multiprojektorganisationen sind – nach eigener Einschätzung – unzuverlässig, unflexibel, zu langsam und zu teuer.
Zu dieser Einschätzung gelangen Führungskräfte aus folgenden Gründen:
Kaum ein Projekt wird rechtzeitig und im Kostenrahmen und mit vollständig erfüllten Anforderungen abgeschlossen.
Viele – an sich sinnvolle – Projekte erscheinen von vorneherein als so lang oder aufwändig, dass sie gar nicht erst (angeboten und) realisiert werden; sie lohnen sich nicht.
Ein – oft signifikanter – Teil der begonnenen Projekte wird wieder abgebrochen. Während der Projektbearbeitung stellt sich heraus, dass es viel zu lange dauert oder zu teuer ist, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Oder die Rahmenbedingungen haben sich so verändert, dass das Projekt überflüssig geworden ist.
Analysieren Sie Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit Ihres Unternehmens. → Kapitel 8
Diese Umstände haben tiefgreifende Konsequenzen für Unternehmen und deren Partner.
3.1 Schäden durch Unzuverlässigkeit im Projektgeschäft
Unternehmen, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten leiden unter Unzuverlässigkeit:
Kunden erleiden durch Verspätungen (bzw. durch Einschränkungen im Leistungsumfang oder in der Qualität) wirtschaftliche Schäden. Infolgedessen fordern Kunden Vertragsstrafen ein, ihr Vertrauen in das Unternehmen sinkt und sie geben dem Unternehmen zukünftig – sofern sie Beschaffungsalternativen haben – weniger Aufträge.
Lieferanten geraten unter Druck, wenn Spezifikationen nicht zeitig geliefert werden oder wenn sie bereits eingetretene Projektverspätungen wieder aufholen sollen. Außerdem kommt bei Verspätungen ihre eigene Planung durcheinander.
Mitarbeiter und Führungskräfte stehen unter Stress. Ständige Prioritätenänderungen und „Feuerlöschaktionen“ nagen an Motivation, Arbeitsmoral und Gesundheit.
Das Unternehmen muss Vertragsstrafen zahlen oder erhält Zahlungen von Kunden später, während Lieferanten bereits bezahlt werden müssen. Der Durchsatz (Deckungsbeitrag) pro Zeiteinheit sinkt, Rendite und Liquidität leiden.
Im Folgenden werden diese Konsequenzen anhand von einigen Beispielen illustriert.
Beschichtungsanlage
In einer neuen Fabrik soll am 1. Oktober die Produktion anlaufen. Die komplette Produktion des ersten halben Jahres ist bereits für 30 Mio € an Kunden verkauft (pro Monat also ca. 5 Mio €). Bei 50 % tatsächlich variablen Kosten kann die neue Fabrik einen monatlichen Deckungsbeitrag von 2,5 Mio € erwirtschaften.
Allerdings: Die neu entwickelte Beschichtungsanlage (Kaufpreis 2,5 Mio €) wird einen Monat verspätet geliefert. Die Produktion läuft erst am 3. November an.
Konsequenz: Das Unternehmen muss den Kaufpreis (2,5 Mio €) der Beschichtungsanlage (abzüglich einer geringen Vertragsstrafe) zwar erst einen Monat später zahlen, verliert dafür allerdings auch den Oktober-Deckungsbeitrag (2,5 Mio €) unwiederbringlich. Der Schaden ist so groß wie der Preis der Anlage!
IT-Unternehmen
Ein IT-Unternehmen hat geplant, in diesem Jahr zwölf Projekte fertigzustellen. Die Projekte sind unterschiedlich lang; nach Plan dauert jedes Projekt durchschnittlich zwölf Monate. Die Projekte sind unterschiedlich groß; der durchschnittliche Verkaufspreis pro Projekt beträgt 5 Mio €. Der Anteil der tatsächlich variablen Kosten am Umsatz liegt bei 20%. Die jährlichen Betriebskosten des Unternehmens belaufen sich auf 44 Mio €.
Bei zuverlässiger Lieferung der Projektergebnisse erwirtschaftet das Unternehmen 4 Mio € Gewinn.
Allerdings: Die Projekte sind zwischen 2 Wochen und 3 Monaten verspätet; im Durchschnitt wird jedes Projekt 4 Wochen zu spät fertiggestellt.
Das wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens ändert sich erheblich: Nur elf statt zwölf Projekte werden fertiggestellt und abgerechnet.
Tabelle 2: Schaden durch Unzuverlässigkeit in IT-Unternehmen
Die durchschnittliche Verspätung von einem Monat verzehrt den kompletten geplanten Gewinn des Unternehmens. Vertragsstrafen und Auswirkungen auf die Liquidität wurden bei dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt.
Liegt die durchschnittliche Verspätung bei zwei oder drei Monaten, landet das Unternehmen bei einem Verlust von 4 oder gar 8 Mio €.
Anlagenbau
In einem Anlagenbau-Unternehmen mit deutlich höheren variablen Kosten und geringeren Fixkosten ist der unmittelbare wirtschaftliche Schaden zwar nicht ganz so groß, aber immer noch erheblich.
Tabelle 3: Schaden durch Unzuverlässigkeit in IT- und Anlagenbau- Unternehmen
Werkzeugbau
Die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens rechnete kürzlich folgendes vor: Wenn sie es nicht schafft, in diesem Jahr alle Projekte zuverlässig zu liefern und die Projektleistung um mindestens 30 % zu steigern, wird ihr Unternehmen bereits verkaufte (!) Projekte im Wert von 30 Mio € nicht liefern können. Dadurch gehen 10 Mio € Deckungsbeitrag verloren; Vertragsstrafen in Höhe von 2,5 Mio € werden fällig. Eine Gewinnschmälerung von 12,5 Mio € ist ein gewaltiger Betrag für ein Unternehmen, das jährlich 150 Mio € umsetzt.
Fazit
Die Beispiele verdeutlichen: Der wirtschaftliche Schaden durch Unzuverlässigkeit kann den Gewinn eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Für Kunden kann der wirtschaftliche Schaden schnell größer sein, als die Kosten des zu spät gelieferten Projekts.
3.2 Implikationen langer Projektlaufzeiten
Im Projektgeschäft sind die Lieferzeiten oft (sehr viel) länger, als die Kunden es sich wünschen. Der Wunsch des Kunden nach einer deutlich kürzeren Lieferzeit entsteht in der Regel aus zwei Richtungen:
Kunden möchten sich gerne möglichst spät hinsichtlich der Spezifikationen festlegen. Deshalb möchten sie den Auftrag später erteilen, die Lieferung aber dennoch zum gewünschten Termin erhalten.
Eine deutlich frühere Lieferung ermöglicht einem Kunden erhebliche wirtschaftliche Vorteile.
Beispiel: Beschichtungsanlage
Die oben geschilderte Fabrik des Kunden ist – abgesehen von der Beschichtungsanlage – bereits Ende August fertiggestellt. Wäre der Lieferant in der Lage, die Beschichtungsanlage ebenfalls Ende August zu liefern, erzielte das Unternehmen dadurch einen Durchsatzgewinn von 2,5 Mio €; das ist der Kaufpreis der Anlage. Tatsächlich hat der Kunde bereits im Juni angefragt, ob eine frühere Lieferung möglich ist.
3.3 Schäden bei internen Projekten
Top-Führungskräfte wollen Umsätze steigern, Kosten senken, neue Produkte entwickeln, Kunden gewinnen und binden, Gewinne nachhaltig steigern. Sie nutzen Projekte, um die dafür erforderlichen Veränderungen zu realisieren.
Je mehr Projekte (pro Monat) fertig werden, umso mehr Veränderungen sind erfolgreich realisiert. Je kürzer die Durchlaufzeit eines Projekts, umso schneller lernt das Unternehmen, ob die erwünschte positive Wirkung des Projekts auf die Unternehmensergebnisse tatsächlich eintritt oder ob Kurskorrekturen erforderlich werden.
Da Projekte sich gegenseitig in die Quere kommen und dadurch länger dauern als geplant, kommen die Veränderungen (und ihre Wirkungen) langsamer als gewünscht. Folgen: Das Unternehmen lernt langsam, die Unternehmensergebnisse verbessern sich zu wenig, Manager verfehlen ihre Ziele, ihre Reputation wird beeinträchtigt, der Druck steigt.
Je kürzer die Durchlaufzeit eines Projekts, umso schneller lernt das Unternehmen, ob die erwünschte positive Wirkung des Projekts auf die Unternehmensergebnisse tatsächlich eintritt oder ob Kurskorrekturen erforderlich werden.
3.4 Kosten / Spezifikationen „wichtiger“ als Zeit?
In einigen Branchen scheinen die Kosten oder die Einhaltung der Qualität wichtiger zu sein als der Termin. In den meisten Fällen bedeutet das: Man hat sich daran gewöhnt, dass es sowieso nicht möglich ist, in der geplanten Zeit das zu erreichen, was man erreichen will. Infolgedessen hat man sich dafür entschieden, dass der Schaden kleiner ist, wenn man später fertig wird und dafür Kosten bzw. Qualität einhält. Anders formuliert: Gerade die Tatsache, dass Kosten oder Qualität als wichtiger betrachtet werden, deutet darauf hin, dass das Unternehmen erhebliche Probleme hat, Projekte zuverlässig fertigzustellen.
Analysieren Sie die Implikationen von Unzuverlässigkeit und langen Lieferzeiten für Ihr Unternehmen. → Kapitel 8.3
3.5 Chancen und Nutzen der Verbesserung
Welchen Nutzen hat ein Unternehmen, wenn es möglich ist, sehr viel besser (zuverlässiger und schneller) zu sein? Was nützt die Verbesserung den Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten?
Zunächst einmal entfällt der Schaden, der aus Unzuverlässigkeit und langen Lieferzeiten entsteht. Darüber hinaus kann ein erheblicher wirtschaftlicher Nutzen entstehen.
Zuverlässigkeit und schnelle Lieferung sind entscheidende Wettbewerbsvorteile im Projektgeschäft:
Wer außerordentlich
zuverlässig
ist (während die Konkurrenz weiterhin unzuverlässig liefert), hebt sich deutlich aus dem Wettbewerb hervor und erhält
mehr Aufträge
.
Wer
deutlich schneller
liefern kann
als der Wettbewerb
, erhält mehr Aufträge und erzielt oft auch
bessere Preise
.
Beispiel: Beschichtungsanlage
Wie oben erwähnt, hat der Kunde angefragt, ob es möglich ist, einen Monat früher zu liefern. Diese Anfrage verbindet der Kunde sogar mit einem finanziellen Anreiz. Für vorzeitige Lieferung bietet er 25.000 € Bonus pro Tag (maximal 500.000 €) an.
Einen Monat früher produzieren zu können, bringt einen Umsatzgewinn von 5 Mio €, also eine Durchsatzsteigerung von 2,5 Mio €. Der Anlagenlieferant erhält 500.000 € Bonus, also eine 20%
Erhöhung des Projektpreises – ohne zusätzliche Kosten. Der Gewinn des Kunden erhöht sich um 2 Mio €, der Gewinn des Lieferanten steigt um 500.000 € – eine WinWin-Situation für alle Beteiligten.
Schneller zu sein als andere, bringt Marktanteile, mehr Geschäft und bessere Ergebnisse. Falls Sie in Projekten neue Produkte entwickeln, können Sie mit diesen früher an den Markt kommen und dadurch einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung erzielen.
Analysieren Sie den Nutzen aus hoher Zuverlässigkeit und kurzen Projektlaufzeiten für Ihr Unternehmen. → Kapitel 8.4
4 Variabilität, Murphy’s Law und schädliche Managementmechanismen
Warum fällt es Unternehmen so schwer, zuverlässig zu sein? Was hindert sie daran, die Projektlaufzeiten zu verkürzen?
Fragt man Projektmanager danach, warum ihre Projekte unzuverlässig sind oder so lange dauern, erhält man in der Regel eine Variation der folgenden Aussagen:
Projekte kommen in Schwierigkeiten, weil
versprochene Fertigstellungstermine für einzelne Aufgaben oft nicht eingehalten werden;
es zu viele Änderungen gibt (mehr oder andere Änderungen als erwartet);
es zu oft vorkommt, dass eingeplante Ressourcen (manchmal trotz guter Planung und expliziter Absprache) nicht verfügbar sind;
notwendige Informationen, Spezifikationen, Materialien, Designs, Befugnisse, … fehlen;
es Auseinandersetzungen um Prioritäten und Ressourcenzuordnung zwischen Projekten gibt;
Budgets für einzelne Aufgaben überzogen werden,
zu oft bereits erledigte Aufgaben erneut aufgegriffen werden müssen (Nacharbeit);
…
In allen Projektbranchen, überall in der Welt, hört man diese Aussagen. Sie illustrieren den Umstand, dass Projekte von Variabilität und Murphy’s Law geprägt sind.
Variabilität
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Zuverlässigkeit ist der Umstand, dass Projekte von Variabilität (Unsicherheit) geprägt sind:
Wie lang ein Vorgang dauern und wie groß der Aufwand sein wird, um eine definierte Leistung zu erbringen, kann man nicht exakt vorhersehen; nur eine unscharfe Schätzung ist möglich.
Vor dem Projekt – wenn der Plan erstellt wird – weiß man nicht, wie viele Änderungswünsche es geben wird und welche Auswirkungen diese Änderungswünsche auf die Dauer von Vorgängen, den notwendigen Aufwand und die Kosten haben werden.
Projekte sind jedes Mal „neu“. Daher wird es – auch bei Nutzung hervorragender Planungsmethoden – vorkommen, dass bei der Planung ein Umstand mit signifikanter Auswirkung übersehen und nicht eingeplant wurde.
Externe Faktoren, auf die Projektmanager keinen Einfluss haben, verzögern den Projektfortschritt (z.B. Naturereignisse, Gesetzesänderungen, Genehmigungsbehörden).
Murphy’s Law
Was schiefgehen kann, geht schief – besonders dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann (Murphy’s Law). Beispiele:
Ein Schlüsselmitarbeiter wird gerade dann krank, wenn das wichtigste Projekt von ihm bearbeitet werden soll.
Maschinen fallen gerade dann aus, wenn sie zwingend in einem Projekt benötigt werden.
Eine speziell entwickelte und aufwändig angefertigte Komponente wird bei der Montage beschädigt; sie muss neu beschafft werden.
Auswirkungen von Variabilität und Murphy’s Law
Da Projekte von Variabilität und Murphy’s Law geprägt sind, kommt es zu Störungen: Mitarbeiter werden mit ihren Aufgaben nicht rechtzeitig fertig, Teile sind teurer als geplant, es gibt mehr Änderungswünsche als erwartet, Ressourcen werden plötzlich für andere Projekte benötigt. Diese Störungen bringen Projekte in Schwierigkeiten: Mindestens eine der drei Projektzusagen (Termin, Budget, Inhalt) ist dann gefährdet.
Variabilität und Murphy’s Law erklären, warum es so schwer ist, einen zuvor erstellten Plan einzuhalten bzw. einen Plan zu erstellen, der eingehalten werden kann (so dass Plan und Realisierung einigermaßen übereinstimmen).
Variabilität und Murphy’s Law allein erklären jedoch nicht, warum es so schwer ist, Projekte in sehr viel kürzerer Zeit zu realisieren. Damit befasst sich das nächste Kapitel.
Warnung
Variabilität und Murphy’s Law sind Tatsachen des Lebens – nicht nur im Projektgeschäft. Projekte werden also nicht dadurch zuverlässiger und schneller, dass Variabilität und Murphy’s Law „verschwinden“.
Projekt- und Multiprojektmanagement sind vielmehr dazu da, erfolgreich zu sein, obwohl Variabilität und Murphy’s Law Realität sind und Realität bleiben.
Schädliche Managementmechanismen im Projektgeschäft
Um ihre Ziele zu erreichen und die dabei störenden Auswirkungen der Variabilität zu begrenzen, haben Unternehmen Regeln und Mechanismen etabliert.
Es mag paradox erscheinen: Die weitaus größere Ursache für Unzuverlässigkeit und für lange Projektlaufzeiten ist das (Projekt-) Management selbst, also die Art und Weise wie Unternehmen versuchen, Zuverlässigkeit zu bewirken sowie Projekte schneller und kostengünstiger zu machen.
Denn einige dieser – zum Teil ungeschriebenen und in bester Absicht geschaffenen – Mechanismen bewirken das Gegenteil von dem, was sie erreichen sollen: Sie bringen Mitarbeiter und Führungskräfte in Schwierigkeiten, beeinträchtigen die Performance der Projekte und verschlechtern die Leistung des Unternehmens.
Analysieren Sie die in Ihrem Unternehmen geltenden Regeln und Mechanismen → Kapitel 8.6
5 WIP und Ressourcennutzung
5.1 Die Matrix (Ressourcen / Projekte)
Die in einem Projekt eingesetzten Ressourcen werden während der Laufzeit des Projektes in unterschiedlicher Intensität genutzt.
In einem Unternehmen beispielsweise, das große Produktionsanlagen mit hohen technologischen Anforderungen entwickelt und produziert, sind am Anfang eines Projektes schwerpunktmäßig Technologen im Einsatz. Die Technologen erstellen das Anlagenkonzept, legen die Technologie fest und übergeben das Layout an die Konstruktion. Die Konstrukteure und Elektroingenieure erstellen das Design der Anlage und ihrer Komponenten, legen Fertigungs- und Montagezeichnungen an und übergeben diese an die Bereiche Beschaffung und Fertigung. Nachdem diese Bereiche ihre Arbeit abgeschlossen haben, werden Komponenten montiert, die gesamte Anlage aufgebaut und zunächst mechanisch, dann elektrisch und schließlich technologisch in Betrieb genommen. Das Projekt endet mit einem abschließenden Test und dessen Akzeptanz durch den Kunden.
Abbildung 3: Typischer Projektablauf im Produktionsanlagenbau
Würde ein Unternehmen stets nur an einem einzigen Projekt arbeiten, wären die meisten Ressourcen oft ungenutzt; sie wären im Leerlauf. Daher versuchen Unternehmen, ihre Wirtschaftlichkeit dadurch zu optimieren, dass sie mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten. Die Projekte sind idealerweise zeitlich so angeordnet, dass die Ressourcen optimal ausgelastet sind.
Aus dieser Motivation ergibt sich die typische Matrixorganisation eines Multiprojektunternehmens: