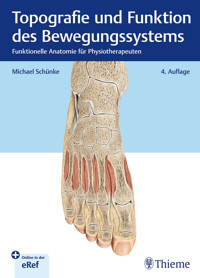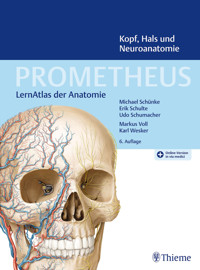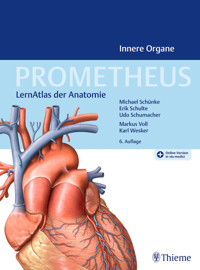
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
PROMETHEUS verbindet faszinierende anatomische Illustrationen mit didaktisch perfekt abgestimmten Erläuterungen. Als LernAtlas ordnet er das Wissen einprägsam in doppelseitigen Einheiten. So macht das Lernen Spaß und der Prüfungsstoff wird überschaubar.
Der Band "Innere Organe" umfasst:
- Aufbau und Embryonalentwicklung der Organsysteme
- Zusammensetzung und Bildung des Blutes
- Organe in Thorax, Abdomen und Becken mit Leitungsbahnen und Topografie
- Systematik der Organversorgung
- „Steckbriefe“ mit wesentlichen Informationen zu allen inneren Organen sowie
- ausgewählte klinische Informationen zu Erkrankungen und Diagnoseverfahren
Neu in der 6. Auflage:
- vollständig überarbeitet
- zahlreiche neue und optimierte Abbildungen
- ergänzt um das Kapitel „Thoraxschnittbilder“ sowie neue Lernheiten zu Koronarangiografie, Rektumkarzinom, Bildgebung von Dünn- und Dickdarm
Gut zu wissen: Der Buchinhalt steht dir ohne weitere Kosten digital in unserem Lernportal via medici und in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App hast du viele Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PROMETHEUS Innere Organe – LernAtlas der Anatomie
Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher, Markus Voll, Karl H. Wesker
6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
1437 Illustrationen
Warum PROMETHEUS?
In der griechischen Mythologie ist Prometheus der Titanensohn, der sich Menschen nach seinen eigenen Vorstellungen erschafft. Damit beschwört er den Zorn des Göttervaters Zeus herauf. Zeus muss jedoch der Sage nach wehrlos mit ansehen, wie Prometheus den Menschen das Feuer und damit Erleuchtung bringt – auch im übertragenen Sinne. Prometheus bedeutet im Griechischen auch „der Vorausdenkende“, so dass unser Atlas neue Wege gehen muss, um seinem Namen gerecht zu werden. Diese neuen Wege wurden bereits bei der Konzeption des Buches beschritten. Sie basieren auf Umfragen und Interviews des Verlages mit Studierenden und Dozentinnen und Dozenten im deutschen Sprachraum sowie in den USA. Ausgangspunkt war die Frage, wie denn der „ideale“ Anatomie-Atlas aussehen müsste. Ideal für Studierende, die mit dem Atlas lernen sollen, die Informationsfülle des Faches Anatomie innerhalb eines sehr gedrängten Stundenplans zu bewältigen und sich dabei dauerhaft solide Kenntnisse zu erarbeiten.
Dass fundierte Kenntnisse im Fach Anatomie unverzichtbar für kompetentes ärztliches Handeln sind, wird mit fortschreitendem Studium immer klarer. Hierzu gehört es auch, Varianten des menschlichen Körpers zu kennen, denn dies kann später im Rahmen der Interpretation von Befunden oder bei Operationen hochrelevant sein und dazu beitragen, Fehler zu verhindern. PROMETHEUS berücksichtigt daher in besonderem Maße auch Varianten in der Anatomie des Menschen, wie z. B. zusätzliche oder nicht „regelkonform“ verlaufende Blutgefäße oder Lageanomalien von Organen.
Dabei vergessen die Autoren nicht, dass gerade die Anatomie – und hier besonders die makroskopische – die Lernenden wie kaum ein anderes medizinisches Fach vor die Schwierigkeit stellt, sich in einer erdrückenden Fülle von Namen und Fakten zu orientieren. Dies gilt umso mehr, als Anatomie ganz zu Beginn des Studiums gelehrt und gelernt werden muss, zu einem Zeitpunkt also, an dem die Studierenden meist noch nicht genügend Erfahrungen mit sinnvollen Lerntechniken gemacht haben. Sie können daher zwangsläufig Wichtiges noch nicht von weniger Wichtigem trennen und schließlich auch noch kaum Verknüpfungen zu anderen Fächern, wie etwa der Physiologie, aufbauen.
Vor diesem Hintergrund war es eine zentrale Zielsetzung bei der Konzeption des LernAtlas, eine wohlstrukturierte „Lernumgebung“ für Studierende zu schaffen. Eine Lernumgebung, die auf die genannten Schwierigkeiten gezielt Rücksicht nimmt und durch ihren Aufbau gleichzeitig Lernhilfe ist. Diesem Ziel diente zum einen die sorgfältige Auswahl der Themen, bei der „Vollständigkeit“ allein kein ausreichendes Kriterium sein konnte. Vielmehr wurde geprüft, inwieweit ein Thema entweder dem erforderlichen Grundverständnis des Faches Anatomie dient oder aber bereits sinnvolle Verbindungen zur klinischen Tätigkeit der späteren Ärztin/ des späteren Arztes knüpft. Selbstverständlich spielte die Prüfungsrelevanz eines Themas in diesem Zusammenhang ebenfalls eine bedeutende Rolle, so dass sich unterschiedliche Gewichtungen von Themen ergaben. Ein zweites Anliegen war es, den Studierenden nicht einfach eine wenig oder gar nicht kommentierte Bilderfolge vorzulegen. Vielmehr wurden alle Bildinformationen in engen Zusammenhang mit einem erklärenden Text gestellt. Auch wenn die Bilder teilweise „einfach für sich sprechen“, schafft der beigefügte Text zusätzliches Verständnis durch Erklärung der Bilder, durch Lernhinweise, fachübergreifende und in die Klinik verweisende Bezüge und vieles mehr. Dabei erläutert der Text schrittweise die Bilder und ermöglicht so ein tiefergehendes Verständnis auch komplexer Zusammenhänge. Der Grundsatz „Vom Einfachen zum Komplizierten“ war dabei ein Leitmotiv.
Als hilfreich erwies sich die Tatsache, dass die Makroskopische Anatomie in vielen Bereichen – vielleicht mit Ausnahme einiger neuroanatomischer Befunde – als ein „abgeschlossenes“ Fach gilt. Neues im Sinne einer wirklichen inhaltlichen Innovation ist eher die Ausnahme. Die Regel ist ein in vielen Bereichen etabliertes Fachwissen, das lediglich im Licht sich wandelnder klinischer Anforderungen neue Facetten bekommt. So ist die Schnittanatomie seit über 80 Jahren unter Anatomen bekannt, aber kaum genutzt worden. Eine enorme Renaissance erlebte sie mit modernen Bildgebungsverfahren wie CT und NMR, deren Bilder ohne ein profundes Verständnis der Schnittbildanatomie überhaupt nicht interpretiert werden können. „Neu“ im wirklich innovativen Charakter des Wortes konnte also nicht die Anatomie selbst sein. Neu – und auch modern im Sinne von zeitgemäß – sollte aber die Art und Weise der didaktischen Aufarbeitung sein.
Damit war im Grunde das prinzipielle Vorgehen bei der Erstellung des LernAtlas festgelegt: Ein Lernthema wird formuliert und erhält eine Lernumgebung aus Bildern, Legenden und Tabellen; auf benachbarte Themen, die ebenfalls in diesem Buch abgehandelt werden, wird verwiesen. Da also am Anfang die Formulierung des Lernthemas stand und nicht ein Bild oder ein Präparat als Bildvorlage, mussten alle Bilder komplett neu konzipiert und erstellt werden, was allein acht Jahre dauerte. Dabei stand nicht die 1 : 1-Wiedergabe eines Präparates im Vordergrund, vielmehr sollte das Bild selbst bereits einen anatomischen Befund didaktisch sinnvoll und lerntechnisch hilfreich deuten, um dem Lernenden das Arbeiten mit dem komplexen Bildinhalt zu erleichtern. Es war unser Ziel, mit PROMETHEUS einen LernAtlas zu schaffen, der die Studierenden bei ihrer Arbeit im Fach Anatomie im Sinne einer didaktischen Führung unterstützt, ihre Begeisterung für dieses so spannende Thema noch verstärkt, der dem ganz am Anfang Stehenden ein Zuversicht gebender, lehrreicher Wegweiser durch die Anatomie ist und den Studierenden als zuverlässige Informationsquelle, der Ärztin wie dem Arzt als vertrautes Nachschlagewerk dient.
„Wenn Du das Mögliche erreichen willst, musst Du das Unmögliche versuchen“ (Rabindranath Tagore).
Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher, Markus Voll und Karl Wesker Kiel, Mainz, Hamburg, München und Berlin im August 2022
Danke …
möchten wir zuallererst und zum wiederholten Male unseren Familien sagen. Ihnen widmen wir PROMETHEUS.
Seit der 1. Band PROMETHEUS 2005 erschienen ist, haben wir zahlreiche Hinweise und Ergänzungsvorschläge erhalten. Wir möchten diese Seite nutzen, um allen, die im Laufe der Jahre in irgendeiner Weise geholfen haben, PROMETHEUS zu verbessern, unseren herzlichen Dank auszusprechen. Im Einzelnen sind dies:
Frau Dr. rer. nat. Kirsten Hattermann, Frau Dr. med. dent. Runhild Lucius, Frau Prof. Dr. Renate Lüllmann-Rauch, Herr Prof. Dr. Jobst Sievers, Herr Dr. med. dent. Ali Therany, Herr Prof. Dr. Thilo Wedel (alle Anatomisches Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) sowie Herr Univ.- Prof. Dr. med. Christoph Düber (Univ.-Med. Mainz), Herr Dr. med. dent. Christian Friedrichs (Praxis für Zahnerhaltung und Endodontie, Kiel), Herr Prof. Dr. Reinhart Gossrau (Charité Berlin, Institut für Anatomie), Herr Prof. Dr. Daniel Haag-Wackernagel (Basel), Herr Dr. med. Johannes- Martin Hahn (Tübingen), Herr Prof. Dr. med. Stefan Müller-Hülsbeck (DIAKO Krankenhaus gGmbH Flensburg), Herr Dr. Róbert Késmárszky, MD, Frau Prof. Susanne Klutmann (UKE Hamburg), Herr Michael Kriwat (Kiel), Herr Prof. Dr. Paul Peter Lunkenheimer (Westfälische Wilhelms- Universität Münster), Herr Prof. Dr. Janos Mester (UKE Hamburg), Herr Priv.-Doz. Dr. Jörg Detlev Moritz (Klinik für Radiologie und Neuroradiologie Kiel), Herr Priv.-Doz. Dr. Thomas Müller (Univ.-Med. Mainz), Herr Priv.-Doz. Dr. med. Dan mon O’Dey (Luisenhospital Aachen), Herr Dr. Kai-Hinrich Olms, Fußchirurgie Bad Schwartau, Herr Dr. med. Dipl.- Phys. Daniel Paech (Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg), Herr OA Dr. Thilo Schwalenberg (Urologische Klinik des Universitätsklinikums Leipzig), Herr Dr. med. Hans-Peter Sobotta (Stiftung Herzogin Elisabeth Hospital Braunschweig), Frau Prof. Dr. em. Katharina Spanel- Borowski (Universität Leipzig), Herr Dr. Jürgen Specht (Orthopaedicum Frankfurt), Herr Prof. Dr. Christoph Viebahn (Georg-August-Universität Göttingen), Frau Dr. med. Imke Weyers (Univ. Lübeck). Für aufwändige Korrekturarbeiten, insbesondere im Rahmen der 1. Auflage, danken wir Frau Dipl.-Biologin Gabriele Schünke, Herrn Dr. med. Jakob Fay sowie Frau cand. med. Claudia Dücker, cand. med. Simin Rassouli, cand. med. Heike Teichmann, cand. med. Susanne Tippmann und cand. med. dent. Sylvia Zilles, insbesondere für die Mithilfe bei den Beschriftungen Frau Dr. Julia Jörns-Kuhnke. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere beiden Layouter Stephanie Gay und Bert Sender. Ihre Fähigkeit, Bilder und Text so anzuordnen, dass jede Doppelseite einfach eine „klare Sache“ ist, trägt ganz entscheidend zur didaktischen und optischen Qualität unseres LernAtlas bei.
PROMETHEUS wäre ohne den Verlag nicht zustande gekommen. Da es aber immer Menschen und nicht Institutionen sind, die ein solches Projekt möglich machen, soll von unserer Seite besonders denen gedankt werden, die dieses Projekt von Verlagsseite aus betreut haben. Das „Unmögliche möglich gemacht“ hat dabei Herr Dr. Jürgen Lüthje, Programmplaner des Thieme Verlages. Er hat es nicht nur geschafft, die Wünsche der Autoren und Grafiker mit den Zwängen der Realität sinnvoll zu vereinen. Er hat vielmehr über die Jahre der gemeinsamen Arbeit ein Team aus fünf Personen geschlossen bei einem Projekt gehalten, dessen Ziel uns von Anfang an bekannt war, dessen ausladende Dimension sich uns aber erst während der Arbeit im vollen Umfang erschloss. Sein Verdienst ist es in hohem Maße, dass der gemeinsame Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, trotz aller Hürden, die überwunden werden mussten, nie erlosch. Bewundernswerte Geduld und die Fähigkeit zum Ausgleich von seiner Seite gerade auch in Problemsituationen kennzeichneten die zahllosen Gespräche mit ihm. Daher gebührt ihm unser aufrichtig und zutiefst empfundener Dank. Seit Herr Dr. Jürgen Lüthje 2018 in den Ruhestand gegangen ist, hat Herr Dr. Jochen Neuberger PROMETHEUS mit großem Engagement übernommen und mit dem bisherigen Team zusammen weitergeführt und weiterentwickelt.
Frau Sabine Bartl wurde im besten Sinne des Wortes zum Prüfstein für die Autoren. Sie hat – als Geisteswissenschaftlerin, nicht als Medizinerin – alle Texte gelesen und im Zusammenhang mit den Bildern darauf hin geprüft, ob einem/er (Noch-)Nicht-Mediziner/in – denn dies sind Studierende ganz am Anfang noch – die Logik der Darstellung wirklich gut ersichtlich wird. Gedankensprünge, die den Autoren, die das Fach aus einer anderen Perspektive sehen müssen, wohl zwangsläufig unterliefen, hat sie sofort entdeckt und die Neubearbeitung des Textes mit zahllosen Vorschlägen unterstützt. Aufgrund Ihrer Anregungen wurden auch Themen umformuliert und neu gestaltet. Ihr sind nicht nur die Autoren zu Dank verpflichtet: auch der Leser, dem sich nun ein Sachverhalt gut erschließt, profitiert von ihrem didaktischen Talent.
Herr Martin Spencker, bei Erscheinen der 1. Auflage Verlagsleiter Studium und Lehre, war, als der für das Projekt aus Verlagssicht Hauptverantwortliche, die letzte Instanz in der Koordination zwischen Verlag einerseits und Autoren und Grafikern andererseits. Seiner Fähigkeit, bei Problemen und Unklarheiten schnell und unkonventionell Entscheidungen zu treffen, verdankt das Projekt enorm viel. Seine Offenheit gegenüber allen Anliegen der Autoren und Grafiker, die Transparenz und Fairness bei allen Diskussionen gaben dem Projekt immer wieder Schwung und klare Rahmenbedingungen für eine offene und partnerschaftliche Kooperation. Auch ihm schulden wir großen Dank.
Ganz ausnahmslos war die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Thieme Verlages zu jedem Zeitpunkt angenehm und freundschaftlich. Aus Platzgründen können wir hier leider nicht alle Personen namentlich aufführen, die in irgendeiner Weise an der Fertigstellung von PROMETHEUS beteiligt waren. Wir beschränken uns daher auf einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit diesem Buch besonders intensiv verbunden sind. In diesem Zusammenhang möchten wir uns bedanken bei Antje Bühl, die als Projektassistentin von Anfang an mit dabei war und als „guter Geist im Hintergrund“ zahlreiche Arbeiten übernommen hat, wie z. B. wiederholtes Korrekturlesen der Layouts und Mithilfe beim Erfassen der Beschriftungen, bei Yvonne Straßburg, Michael Zepf und Laura Diemand, die dafür gesorgt haben, dass PROMETHEUS termingerecht gedruckt, gebunden und auf seinem gesamten Entstehungsweg mit bestem herstellerischem Know-how begleitet wurde; bei Susanne Tochtermann-Wenzel und Anja Jahn für die Unterstützung bei technischen Fragen rund um die Bebilderung, bei Julia Fersch, die dafür gesorgt hat, dass PROMETHEUS auch über eRef zugänglich ist, bei Almut Leopold und Dr. Wilhelm Kuhn für das ausgezeichnete Register; bei Marie-Luise Kürschner und Nina Jentschke für die ansprechende Gestaltung des Umschlags sowie bei Dr. Thomas Krimmer, Liesa Arendt, Birgit Carlsen, Stephanie Eilmann, Marion Hamm und Anne Döbler stellvertretend für alle, die PROMETHEUS im Hinblick auf Marketing, Verkauf und Öffentlichkeitsarbeit betreuen oder betreut haben.
Die Autoren im August 2022
Die Menschen hinter PROMETHEUS
Ein Werk wie PROMETHEUS kann nur entstehen, wenn die Menschen, die daran beteiligt sind, Hand in Hand zusammenarbeiten. Erst der rege Austausch zwischen den Anatomieprofessoren Michael Schünke, Erik Schulte und Udo Schumacher einerseits und den anatomischen Illustratoren Markus Voll und Karl Wesker andererseits führte zu dem didaktischen und künstlerischen Gesamtwerk, wie es jetzt vor Ihnen liegt.
Lerneinheiten zu schaffen, die ein Thema konsequent auf zwei gegenüberliegenden Seiten abhandeln, ist schon an sich eine besondere Herausforderung. Die Autoren müssen die Inhalte präzise auswählen, zusammenstellen und mit erläuternden Legenden versehen. Wie sich diese Inhalte dann jedoch im Atlas präsentieren, wie ansprechend und einprägsam sie sind, hängt maßgeblich von den Bildern ab – im PROMETHEUS sind es inzwischen gut 5000! Um sie zu zeichnen, haben Markus Voll und Karl Wesker jahrzehntelange Erfahrungen in der anatomischen Illustration gesammelt, anatomische Sammlungen besucht, Präparate studiert und alte und neue Werke der Anatomie durchgearbeitet. Auf dieser Basis entstand der PROMETHEUS.
Er führt Sie Schritt für Schritt sicher durch die Anatomie und zeigt, welche bedeutende Rolle die Anatomie in der späteren praktischen Tätigkeit spielt: Ob Darmoperation bei einem Tumor, Trommelfellpunktion bei einer Mittelohrentzündung oder Untersuchung einer Schwangeren – immer sind profunde anatomische Kenntnisse notwendig. Ohne sie ist niemand eine gute Ärztin oder ein guter Arzt.
Das Lernen kann Ihnen auch PROMETHEUS nicht ersparen, aber er macht es schöner. Dafür garantieren Autoren und Grafiker.
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Schünke
Abb. 0.1Anatomisches Institut der Universität Kiel Studium der Biologie und Medizin in Tübingen und Kiel Intensive Lehrtätigkeit bei Medizin- studierenden und Physiotherapeuten Autor und Übersetzer weiterer Lehrbücher
Foto: privat
Prof. Dr. med. Erik Schulte
Abb. 0.1Institut für Funktionelle und Klinische Anatomie der Universitätsmedizin Mainz Studium der Medizin in Freiburg Intensive Lehrtätigkeit bei Medizin- studierenden Preis für herausragende Leistungen in der Lehre in Mainz
Foto: Kristina Schäfer
Prof. Dr. med. Udo Schumacher
Abb. 0.1MSB Medical School Berlin Studium der Medizin in Kiel sowie einjähriger Studienaufenthalt am Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia Intensive Lehrtätigkeit bei Medizinstudierenden, Physiotherapeuten/innen und Facharztkandiaten/ innen (FRCS). Mehrjähriger Aufenthalt in Southampton, dort Erfahrungen in fächerübergreifendem, integriertem Unterricht
Foto: privat
Markus Voll
Abb. 0.1Freiberuflicher Illustrator und Grafiker in München Grafikausbildung an der Blochererschule für Gestaltung in München Studium der Medizin an der LMU München Jahrzehntelange Tätigkeit als wissenschaftlicher Illustrator für zahlreiche Buchprojekte
Foto: privat
Karl Wesker
Abb. 0.1Freiberuflicher Maler und Grafiker in Berlin Lehre als Klischeeätzer und Lithograph Studium der Visuellen Kommunikation an der FH Münster und an der Hochschule der Künste Berlin sowie der Kunstwissenschaft an der TU Berlin Jahrzehntelang tätig in der freien Malerei und in der wissenschaftlichen Grafik, u. a. Buchprojekte für Anatomie
Foto: privat
Teil I A Aufbau und Embryonalentwicklung der Organsysteme im Überblick
1 1. Organsysteme und Entwicklung der Körperhöhlen
2 2. Kreislaufsystem
3 3. Blut
4 4. Lymphatisches System
5 5. Atmungssystem
6 6. Verdauungssystem
7 7. Harnsystem
8 8. Genitalsystem
9 9. Endokrines System
10 Vegetatives Nervensystem
22. Kreislaufsystem
2.1 Übersicht und prinzipieller Wandbau
A Herz-Kreislauf-System im Überblick
Abb. 2.1Das Herz-Kreislauf-System ist ein geschlossenes Röhrensystem, in dem das Blut zirkuliert. Diese Zirkulation ist notwendig, um permanent Sauerstoff, Nährstoffe und Hormone zu den Organen hin und Kohlendioxid und andere Stoffwechselabfallprodukte von den Organen weg zu den Ausscheidungsorganen zu transportieren. Zusätzlich befördert der Blutstrom Zellen und Eiweiße des Immunsystems. Sie „patroullieren“den Körper ständig auf der Suche nach Pathogenen und nutzen das Blut als Transportmedium. Ähnlich wie bei einer Zentralheizung kann mit dem Blut auch Wärme transportiert werden, so dass die Zirkulation Teil des Wärmehaushalts des Körpers ist. Neben diesen Servicefunktionen beinhaltet das Blut noch ein spezialisiertes Leckabdichtungssystem: die Bestandteile der Blutgerinnung. Es wird aktiviert, wenn das Röhrensystem verletzt ist. Angetrieben wird die Zirkulation im System durch das Herz, das wie eine Saug-Druck-Pumpe wirkt.
Zwei Kreislaufsysteme werden zunächst unterschieden:
• der große oder Körperkreislauf (Hochdrucksystem mittlerer Blutdruck 100 mmHg in großen Arterien) und
• der kleine oder Lungenkreislauf (Niederdrucksystem Mittelwert 12 mmHg; Unterschied im Druck fast Faktor 10!).
In Bezug auf das Röhrensystem unterscheidet man in beiden Kreisläufen vier definierbare Abschnitte:
• Arterien und Arteriolen: führen vom Herzen weg und verteilen das Blut auf die Organe,
• Kapillaren: schließen an die Arterien an und dienen dem Stoffaustausch in den Organen,
• Venolen und Venen: nehmen das Blut aus den Kapillaren auf und leiten es an das
• Herz zurück, welches das Blut im Sinne einer Umwälzpumpe wieder in die Arterien weiterleitet.
Das Lymphgefäßsystem ist ein zusätzliches Gefäßsystem, das Flüssigkeiten aus den Organen abtransportiert. Es beginnt blind mit den Lymphkapillaren in den Organen und leitet die Lymphflüssigkeit in das venöse System ein.
Beachte: Die Bezeichnung eines Blutgefäßes als „Arterie“ oder „Vene“ erfolgt ausschließlich entsprechend der Flussrichtung des Blutes. In diesem Buch sind Arterien meist rot, Venen meist blau dargestellt. Abbildung A nimmt aber – unabhängig von der Flussrichtung des Blutes – auf dessen Sauerstoffgehalt Bezug: Sauerstoffreiches Blut ist hier rot, sauerstoffarmes Blut blau, um den Sauerstofftransport darzustellen. Im Lungenkreislauf enthält folglich die Pulmonalarterie venöses Blut (= blau), während die Pulmonalvene das arterialisierte Blut (= rot) enthält.
Abb. 2.2B Prinzipieller Wandbau großer Gefäße
Abb. 2.2aa Die größeren Transportgefäße (Arterien, Venen) bestehen prinzipiell aus drei Schichten:
• Tunica intima (Intima): Endothel bestehend aus einschichtigem Plattenepithel, wobei sich die Zellen in Richtung des Blutflusses strecken und einer darunter liegenden subendothelialen Bindegewebsschicht;
• Tunica media (Media): ringförmig angeordnete glatte Muskelzellen, außerdem die elastischen Fasern von der Membrana elastica interna (die das Endothel der Intima von der Media abgrenzt) und Membrana elastica externa (welche die Media von der Adventitia abgrenzt);
• Tunica adventitia (Adventitia): lockeres Bindegewebe, welche das Gefäß in die Umgebung einbaut und für eine gewisse Verschieblichkeit bei Organbewegungen sorgt; enthält außerdem Blut- und Lymphgefäße sowie Nerven.
Abb. 2.2bb (nach Frick/Leonhardt/Starck). Abgesehen von diesem prinzipiell identischen dreischichtigen Aufbau der Arterien sind bei Venen die glatten Muskelzellen in der Media in weniger Schichten vorhanden und zudem weniger dicht gepackt als bei Arterien, so dass die Media von Venen lockerer erscheint. Diese beiden Baumerkmale sind durch den im Vergleich zu den Arterien geringeren Blutdruck in den Venen bedingt. Die peripheren Venen in den Extremitäten zeichnen sich zudem durch das Vorkommen von Klappen aus. Die kleinen Austauschgefäße, die Kapillaren besitzen keine Muskelschicht mehr, sondern bestehen nur aus Endothel und Basalmembran.
C Blutdruckverhältnisse in den verschiedenen Abschnitten des Herz-Kreislauf-Systems (nach Siegenthaler)
Abb. 2.3Bei kaum einem Organsystem ist die Funktion so eng mit der Morphologie gekoppelt wie bei dem Gefäßsystem, da ein hoher Blutdruck eine dicke Gefäßwand und ein niedriger eine dünne Gefäßwand bedingt. Deshalb ist die Kenntnis der Druckverhältnisse für die Interpretation der Morphologie von Bedeutung. Bei den großen herznahen Arterien kommen zudem Blutdruckschwankungen vor, da sich bei der jeweiligen Aktionsphase des Herzens auch der Blutdruck ändert: während der Blutdruck in der Spitze der Systole 120 mmHg in der linken Herzkammer erreicht, fällt er in der Diastole bis auf 0 mmHg. Durch die Wandeigenschaften des arteriellen Systems der herznahen Gefäße werden die Blutdruckspitzen abgepuffert und durch die Widerstandsgefäße weiter reguliert, so dass von den Kapillaren an ein gleichmäßiger Druck herrscht. Am niedrigsten ist der Druck in den zentralen, herznahen Venen, die das Blut aufgrund ihrer geringen Wand dicke wie ein Wassersack speichern können.
Beachte: Den Abschnitten des Gefäßsystems sind jeweils spezielle Funktionen zugeordnet, die oben in der Abbildung bezeichnet sind.
2.2 Endstrombahn und Systematik der großen Gefäßstraßen
A Endstrombahn
Abb. 2.4a In den Arterien und Venen steht der Transport des Blutes funktionell im Vordergrund, im Bereich der Endstrombahn ist es der Austausch zwischen Blut und Gewebe. Diesen Austauschabschnitt bezeichnet man alternativ auch als Mikrozirkulation.
Zur Endstrombahn zählen:
• Arteriolen
• Kapillaren
• Venolen
b In Bezug auf die Durchblutung der Organe ist wichtig, dass nicht alle Kapillaren gleichmäßig durchblutet sind. Um den Blutfluss zu regulieren, findet man präkapilläre Sphinkter aus glatten Muskelzellen, welche die Durchblutung einer Kapillare regeln. Die lokale Durchblutung in der Endstrombahn ist nicht nur innerhalb eines Organs funktionsabhängig, sondern schwankt – natürlich auch – funktionsbedingt von Organ zu Organ.
c Daneben gibt es arteriovenöse Anastomosen, welche die Durchblutung einer Gruppe von benachbarten und zu einer funktionellen Einheit zusammengefassten Kapillaren regeln. Somit können ganze Kapillarbezirke abgeschaltet werden.
Das Versagen der Feinregulation der Kapillardurchblutung ist das Hauptproblem beim Schock: Das Blut „versackt“in den Kapillaren.
B Besondere Gefäßverhältnisse
Abb. 2.5Neben den oben genannten Regelfällen der Organdurchblutung: Arterie – Kapillare – Vene gibt es bei den inneren Organen einige Spezialfälle in der Gefäßversorgung.
a Passage von arteriellem Blut durch zwei hintereinander geschaltete Kapillarkreisläufe: Zwei hintereinander geschaltete Kapillarkreisläufe findet man in der Niere, wo das arterielle Blut zunächst durch die Nierenkörperchen (Glomerula) fließt und dann in die Kapillaren des Nierenmarks.
b Passage durch zwei venöse Kreisläufe (Pfortadersystem): Fließt venöses Blut hintereinander durch zwei Kapillarbetten, so spricht man von einem Pfortaderkreislauf. Das Blut aus dem ersten Kapillarbett ist zur Verdeutlichung violett eingezeichnet, da es noch nicht komplett deoxygeniert ist. Ein solches Pfortadersystem findet sich im Verdauungstrakt, wo das venöse Blut aus den unpaaren Bauchorganen (Magen, Darm, Milz) in der Pfortader gesammelt wird und einer zweiten Kapillarpassage in der Leber unterworfen wird.
C Doppelte Organversorgung
Abb. 2.6Die Leber wird sowohl von einer Leberarterie (A. hepatica) mit arteriellem Blut versorgt als auch von einer Vene (Pfortader, V. portae hepatis) mit venösem Blut (a). Das Gefäß, das für die eigentliche Organversorgung zuständig ist, ist die A. hepatica. Sie wird als das Vas privatum bezeichnet. Das Gefäß, das das Blut mit den Produkten enthält, die in der Leber verstoffwechselt werden sollen, ist das sog. Vas publicum. Eine Blutversorgung durch zwei Arterien findet man bei der Lunge (b). Hier ist das Vas publicum die Pulmonalarterie (enthält aber venöses Blut) und die Vasa privata sind die Rami bronchiales aus der Aorta. Beim Gehirn liegt eine weitere Variante der mehrfachen Blutversorgung vor, vier Arterien bilden einen untereinander geschlossenen Kreis (Circulus arteriosus), aus dem die direkten Gefäße in das Gehirn abgehen (c). Alle drei Varianten der Blutversorgung durch mehrere Gefäße sorgen für eine gewisse Kompensationsmöglichkeit, falls eines der zuführenden Gefäße ausfällt.
D Große Gefäßstraßen
Abb. 2.7In dieser Übersicht sind die großen Arterien (a) und Venen (b) dargestellt. In der folgenden Systematik der Organe wird die Kenntnis der großen Gefäßstämme vorausgesetzt, die kleineren organversorgenden Gefäße werden im Zusammenhang mit den Organen abgehandelt.
2.3 Kardiogene Zone, Entwicklung des Herzschlauches
BesonderheitenDas Herz-Kreislauf-System ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich: Zum einen ist es das 1. funktionsfähige Organsystem des menschlichen Embryos; es arbeitet bereits am Ende der 3. Entwicklungswoche (1. Kontraktion des primitiven Herz-[Endothel-]schlauches). Zum anderen ist die sog. Herzschleife (s. B ▶ Abb. 2.9) die 1. asymmetrische Struktur des Körpers. Da der menschliche Embryo nicht ausreichend mit Dotter ausgestattet und die Ernährung über Diffusion damit nur für kurze Zeit gewährleistet ist, ist er bereits früh auf extraembryonale Kreisläufe angewiesen. Während der zeitlich etwas früher angelegte Dotterkreislauf keine bedeutende hämodynamische Wirkung hat, wird der Plazentarkreislauf im Verlauf der Embryonalund Fetalperiode zur treibenden Kraft (s. D▶ Abb. 2.11).
A Herkunft des Herzgewebes (kardiogene Zone)
Abb. 2.8Sicht von der Amnionhöhle aus auf die Keimscheibe von dorsal. Während der 3. Entwicklungswoche (Präsomitenstadium) bildet das kardiogene Mesoderm, aus dem sich das Herz entwickelt, beim menschlichen Embryo eine hufeisenförmige Zone (kardiogene Zone/Platte) aus verdicktem mesenchymalen Gewebe. Es liegt vor und seitlich der Neuralplatte. Das mesenchymale Gewebe befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch am Boden bzw. unterhalb der ebenfalls hufeisenförmigen, intraembryonalen Zölomhöhle und grenzt als Splanchnopleura (= das den Eingeweiden zugewandte Blatt des Seitenplattenmesoderms) an die zukünftige Perikardhöhle (s. Be▶ Abb. 2.9 ). Mit Beginn der kraniokaudalen sowie der seitlichen Abfaltung des Embryos wandert die ursprünglich rostral (also „oben“ bzw. am vorderen Teil der Keimscheibe) und seitlich liegende kardiogene Zone mit dem dorsal aufgelagerten Zölomspalt nach ventral unter den Vorderdarm (s. Bc▶ Abb. 2.9 ).
B Bildung der Herzanlage im Laufe der Abfaltung des Embryos
Abb. 2.9a–d Sagittalschnitte; e–h Querschnitte (21.–23. Entwicklungstag/4–12 Somiten); Ansicht von lateral (a–d) bzw. rostral (e–h); zur Lage der jeweiligen Schnittebene s. A▶ Abb. 2.8.
Durch die kraniokaudale Abfaltung (a–d) verlagern sich Herzanlage und angrenzende Perikardhöhle durch eine 180°-Drehung unter die Vorderdarmbucht (Deszensus des Herzens). Die ehemals kaudal liegende Prächordalplatte (hier entsteht die spätere Mundöffnung) liegt damit nun rostral (oberhalb) der Herzanlage. Auf diese Weise wandert auch das Septum transversum (Anlage des Centrum tendineum des zukünftigen Diaphragmas) nach kaudal unter die Herz- bzw. Perikard (Herzbeutel-)anlage. Im Laufe der etwas verzögert vor sich gehenden, seitlichen Abfaltung (e–h) fusionieren die zunächst paarigen Herzanlagen zur unpaaren Herzanlage (h). Innerhalb des mesenchymalen Gewebes der kardiogenen Zone, d. h. zwischen Endoderm des Vorderdarms und Splanchnopleura der Perikardhöhle entwickeln sich aus proliferierenden Hämangioblasten zahlreiche, mit Endothel ausgekleidete embryonale Gefäße. Die angrenzende Splanchnopleura verdickt sich und entwickelt sich nach Fusion mit der Gegenseite zum Herzmuskel (Myokard). Zwischen den Anlagen von Endound Myokard liegt eine breitangelegte basalmembranähnliche Struktur aus gallertiger Extrazellularmatrix (Herzgallerte/sog. Kardioglia). Somit besteht der fusionierte embryonale Herzschlauch von innen nach außen aus drei Schichten: Endokard, Herzgallerte und Myokard. Das viszerale Blatt des Herzbeutels, das Epikard, bildet sich aus Vorläuferzellen im Bereich des Sinus venosus, die sekundär das Myokard überwachsen.
C Bildung der Herzschleife
Abb. 2.10a Ansicht von links-lateral; b–d Sicht von vorne auf die eröffnete Perikardhöhle.
Während der kranialen Abfaltung des Embryos verlagern sich Herzanlage und zukünftige Perikardhöhle nach ventral und kaudal. Mit Beginn der 4. Entwicklungswoche verlängert und krümmt sich der tubuläre Herzschlauch zur sog. Herzschleife, die zunächst noch über ein dorsales Mesokard an der Hinterwand der Perikardhöhle aufgehängt ist. Dieses Aufhängeband bildet sich im Weiteren zurück (Ausbildung des Sinus transversus pericardii), so dass der Herzschlauch nur noch an seiner venösen und arteriellen Ein- bzw. Ausflussbahn am Perikard befestigt ist (s. c). Bei der Bildung der Herzschleife verlagert sich der kraniale Abschnitt des Herzschlauches nach ventrokaudal und rechts, während der kaudale Abschnitt nach dorsokranial und links wandert (d). Somit liegt die Einstrombahn (Porta venosa) der Herzschleife dorsal, die Ausstrombahn hingegen ventral. Gleichzeitig gliedert sich der Herzschlauch durch lokale Einschnürungen und Aussackungen in mehrere Abschnitte:
• Truncus arteriosus,
• Conus cordis,
• primitiver Ventrikel,
• primitiver Vorhof und
• Sinus venosus.
D Frühembryonaler Kreislauf
Abb. 2.11Ansicht von lateral. Herz-Kreislauf-System eines 3–4 Wochen alten Embryos mit Herzschlauch und drei unterschiedlichen Blutkreislaufsystemen: • intraembryonaler Körperkreislauf: (Aortae ventralis und dorsalis, Kiemenbogen- bzw. Schlundbogenarterien, Vv. cardinales cranialis, caudalis und communes), • extraembryonaler Dotterkreislauf (Aa. und Vv. omphalomesentericae/vitellinae) und • Plazentakreislauf (Aa. und Vv. umbilicales). Das teilweise bereits arterialisierte Blut (Dottersack bzw. Placenta) der sechs großen Venenstämme (je zwei Dottersackvenen, Allantois- bzw. Plazentavenen und gemeinsame Kardinalvenen) mündet in ein gemeinsames venöses, herznahes Auffangbecken, den Sinus venosus. Danach gelangt es entlang des Herzschlauches und weiter über die paarige, dorsale Aorta zurück in den Körperkreislauf bzw. zum Dottersack und der Placenta (zur Entwicklung des Sinus venosus ▶ Abb. 2.15).
2.4 Entwicklung der Herzbinnenräume, Schicksal des Sinus venosus
A Herzschleife und daraus entstehende Herzabschnitte
Abb. 2.12a Herzschleife in der Ansicht von links; b Sagittalschnitt durch die Herzschleife.
In der Herzschleife sind Ende der 3./Anfang der 4. Woche die Vorstufen der definitiven Herzabschnitte gut zu erkennen:
• Bulbus cordis (= Truncus arteriosus und Conus cordis) wird zu glattwandiger Ausstrombahn von linkem und rechtem Ventrikel sowie Anfangsteil von Pars ascendens aortae (aufsteigende Aorta) und Truncus pulmonalis;
• aufsteigender Schenkel der Herzschleife: wird zum rechten Ventrikel;
• absteigender Schenkel der Herzschleife: wird zum linken Ventrikel;
• Sulcus interventricularis: markiert äußerlich die Grenze zwischen definitivem linkem und rechtem Ventrikel;
• auf Höhe des Atrioventrikularkanals bilden sich die zukünftigen Atrioventrikularklappen.
Zwischen dem 27. und 37. Entwicklungstag kommt es durch komplizierte Septierungsvorgänge im Bereich von Vorhof, Ventrikel und Ausflussbahn (s. ▶ Septierung des Herzens) zu einer Unterteilung des einheitlichen Herzschleifenlumens in eine Strombahn des „rechten“ und „linken“ Herzens.
B Bildung der Endokardkissen und Entstehung der Herzbinnenräume
Abb. 2.13a u. b Sagittalschnitt durch die Herzschleife; c Frontalschnitt auf Höhe der Endokardkissen (Schnittebene s. b).
Während der 4. Entwicklungswoche wird der Herzschlauch am Übergang von Vorhof zu Kammerbereich zum Atrioventrikularkanal (AV-Kanal) verengt. Dieses geschieht durch Bildung von je einem dorsalen und ventralen Endokardkissen, das sind lokale Verdickungen im Bereich der myokardialen Basalmembran (Herzgallerte). Sie verschmelzen miteinander und untergliedern den AV-Kanal im Weiteren in eine linke und rechte Strombahn (Canalis atrioventricularis dexter und sinister). Aus den fusionierten Endokardkissen entwickeln sich später die Atrioventrikularklappen, die die Vorhöfe von den Kammern trennen (Mitralund Trikuspidalklappe). Gleichzeitig beginnt die Unterteilung von Vorhof und Kammern (s. ▶ Septierung des Herzens).
C Schicksal des Sinus venosus und seiner Veneneinmündungen
Abb. 2.14a 4. Woche; b 3. Monat; Ansicht von ventral.
Bis zur 4. Woche ist der Sinus venosus ein separater Herzabschnitt am Anfang der venösen Einstrombahn. Er mündet in die Mitte des noch nicht geteilten Vorhofs. Über sein linkes bzw. rechtes Sinushorn münden jeweils drei große paarige Venen in den Vorhof: Dottervene (V. vitellina/omphalomesenterica), Nabelvene (V. umbilicalis) und Stamm der Kardinalvene (V. cardinalis communis). Durch zwei Links-Rechts-Kurzschlüsse verlagert sich die Einflussbahn zunehmend auf die rechte Körperseite, links obliteriert der größte Teil der Venen (s. ▶ Tab. 2.1 ):
1. Links-Rechts-Kurzschluss: Der Blutstrom aus der Placenta gelangt über die linke Nabelvene und den Ductus venosus in der Leber auf die rechte Seite und dort über den Stamm der rechten Dottervene (spätere V. cava inferior) zum rechten Sinushorn.
2. Links-Rechts-Kurzschluss: Die beiden oberen Kardinalvenen werden durch eine Anastomose verbunden. Das Blut aus dem Körperkreislauf mündet dann über den Stamm der rechten Kardinalvene (spätere V. cava superior) in das rechte Sinushorn. Dabei vergrößert sich das rechte Sinushorn und wird zunehmend in die Wand des rechten Vorhofs miteinbezogen (b). Das linke Sinushorn hingegen wird zunehmend kleiner und entwickelt sich zum Sinus coronarius.
D Umgestaltung der Vorhöfe
Abb. 2.15Die Aufteilung des primär einheitlichen Vorhofs (Atrium commune) in einen linken und rechten Vorhof wird in der 5. Woche durch die Bildung des Septum primum eingeleitet (s. ▶ Septierung des Herzens). Etwa gleichzeitig beginnt die Umgestaltung der Vorhöfe durch Einbeziehung von Venenwandmaterial. Während auf der rechten Seite Teile des rechten Sinushorns in die Vorhofwand miteinbezogen werden, entsteht der größte Teil des linken Vorhofs durch Einbeziehung der primitiven Vv. pulmonales. Die Herkunft der Vorhofanteile lässt sich noch am ausgewachsenen Herzen nachvollziehen:
• glattwandige Wandabschnitte entstehen aus Venenwandmaterial (Sinus venosus, Vv. pulmonales),
• trabekuläre Anteile (v. a. das linke und das rechte Herzohr) gehen auf das ehemalige Atrium commune (den noch nicht geteilten Vorhof) zurück.
Diese Grenze zwischen glattwandigen und trabekulären Wandanteilen markiert im rechten Vorhof beispielsweise eine vertikale Leiste, die Crista terminalis. Ihr kranialer Abschnitt ist die ehemalige rechte Sinusklappe, ihr kaudaler Abschnitt sind die Klappen der V. cava inferior und des Sinus coronarius.
E Umgestaltung des Sinus venosus und seiner Veneneinmündungen nach der 4. Embryonalwoche (s. auch Cb▶ Abb. 2.14)
Tab. 2.1
Sinus venosus und in ihn mündende Venen bis inklusive der 4. Woche
Was nach der 4. Woche auf der rechten Seite des Körpers bleibt
Was nach der 4. Woche auf der linken Seite des Körpers bleibt
rechtes und linkes Sinushorn
glattwandiger Anteil des rechten Vorhofs
Sinus coronarius
rechte und linke V. cardinalis communis
rechte Vene wird zu einem Teil der V. cava superior
linke Vene geht im Sinus coronarius auf
rechte und linke V. cardinalis cranialis
rechte Vene wird ebenfalls zu einem Teil der V. cava superior
linke Vene obliteriert
rechte und linke V. cardinalis caudalis
rechte Vene wird zur V. azygos
linke Vene obliteriert
rechte und linke V. umbilicalis
Vene obliteriert
distaler Teil bleibt bis zur Geburt erhalten
rechte und linke V. vitellina
proximaler Teil der rechten Vene wird zur V. cava inferior
distaler Teil der rechten Vene wird zur V. portae hepatis
linke Vene obliteriert
2.5 Septierung des Herzens (Septum atriale, interventriculare und aorticopulmonale)
Grundsätzliches zur Entwicklung der HerzseptenDie Septierung des Herzens beginnt Ende der 4. Woche und dauert etwa drei Wochen. In dieser Zeit wächst der Embryo von etwa 5 auf 17 mm. Durch die Entwicklung der verschiedenen Septen wird der Herzschlauch doppelläufig. Es entsteht eine Strombahn des linken und eine Strombahn des rechten Herzens. Die endgültige Trennung der beiden Kreisläufe erfolgt erst zum Zeitpunkt der Geburt durch den Verschluss des Foramen ovale (s. ▶ Prä- und postnataler Blutkreislauf und die häufigsten angeborenen Herzfehler), wenn die Lungen des Kindes die Arterialisierung des Blutes übernommen haben.
Beachte: Störungen bei der Entwicklung der Herzsepten spielen eine Schlüsselrolle für viele Herzfehlbildungen (z. B. Vorhof- und Kammerseptumdefekte, Transposition der großen Gefäße, Fallot-Tetralogie, s. ▶ Angeborene Herzfehler). Herzfehlbildungen sind mit einer Inzidenz von 7,5 pro 1000 Lebendgeborene die häufigsten angeborenen Erkrankungen. In Deutschland werden zur Zeit jedes Jahr ca. 6000 Kinder mit einem Herzfehler geboren.
A Septierung der Vorhöfe (Septum atriale)
Abb. 2.16a, c, e, g, i, k Frontalschnitte, Ansicht von ventral; b, d, f, h, j Sagittalschnitte, Ansicht von rechts.
Septum primum und Foramen secundum: Am Ende der 4. Entwicklungswoche wird der primär einheitliche Vorhof (Atrium commune) allmählich in zwei Vorhöfe unterteilt. Vom Dach des noch ungeteilten Vorhofs wächst das