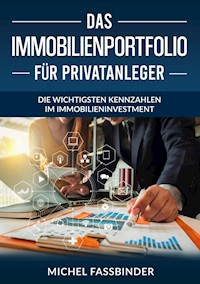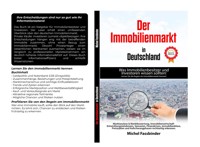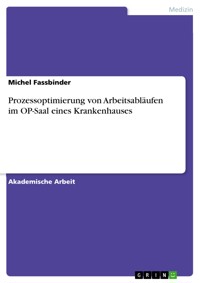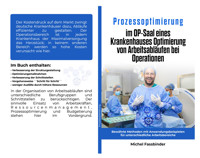
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kostendruck im Gesundheitswesen Seit Jahren sehen sich Manager im Gesundheitswesen einem stetig wachsenden Kostendruck ausgesetzt. Dieses Phänomen hat verschiedene Ursachen. Auf der Einnahmeseite sind dies u. a. der Wegfall öffentlicher Zuschüsse zur Deckung von Defiziten infolge der Privatisierung von Krankenhäusern oder zumindest der Überführung in eigenständige kommunale Unternehmen, und die Einführung des Fallpauschalensystems zur Finanzierung der Krankenhausleistungen. Auf der Ausgabenseite beeinflusst der medizinische Fortschritt mit kostenintensiven Medikamenten oder moderner Medizintechnik sowie nicht refinanzierte Erhöhungen der Personalaufwendungen die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses. Vor diesem Hintergrund sind in der heutigen Zeit die knappen Ressourcen und ökonomischen Imperative für Gesundheitseinrichtungen normaler Alltag geworden. Das erfordert eine Arbeitsaufgabengestaltung mit einer effizienten Disposition. Ein modernes betriebswirtschaftliches Arbeiten i. S. v. Methoden eines Prozessmanagements ist Teil der Aufgabenfelder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 36
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michel, D., P., P., Fassbinder
Prozessoptimierung im OP-Saal eines
Krankenhauses
Optimierung von Arbeitsabläufen bei Operationen
Bewährte Methoden mit Anwendungsbeispielen für unterschiedliche
Arbeitsbereiche
Copyright
Das Buch darf ohne Genehmigung des Autors weder im Ganzen noch in
Teilen kopiert, vervielfältigt, auf Datenträger gebracht oder zu sonstigen
Zwecken genutzt werden
Alle Rechte befinden sich beim Autor.
Impressum
Self-Publishing by Michel Fassbinder 2022
Druck & Versand
1
Michel Fassbinder
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
a. Allgemeine Rahmenbedingungen • Kostendruck im Gesundheitswesen • OP-Bereich als kostenintensiver Bereich • Struktur des OP-Bereichs
b. Forschungsstand
Die Beurteilung von OP-Prozessen mittels der Kennzahlen „Auslastung“
und „Wechselzeit“.
c. Grundlagen in den OP-Bereichen des Untersuchungsobjektes
I Fachdisziplinen
II Anzahl OP-Säle
III OP-Management und Koordination 2. Arbeitshypothese und Fragestellung a. Fragestellungen
b. Hypothese
3. Aufbau der Arbeit
4. Datenmaterial und Methoden
4.1. Datenmaterial
I OP-Protokolle
II Narkosedatenbank
III OP-Statut
4.2 Methoden
Berechnung der Saal-Nutzungsgrad-Schnitt-Naht-Zeit 5. Ergebnisse der Datenanalyse d. Soll-Schnitt-Naht-Zeiten
e. Stichprobenerhebung der Ist-Schnitt-Naht-Zeiten einzelner OP-Eingriffe im Vergleich mit den Soll-Zeiten f. Saalbelegungsverläufe
g. Schnittzeit der 1. OP
h. Nutzung der OP-Kapazität
6. Diskussion
6.1 Methodik
6.2 Dokumentation
6.3 OP-Auslastung
Michel Fassbinder
6.4 Vergleich der Soll- mit den Ist-SNZ der OP-Eingriffen 6.5 Saalbelegungsverläufe
7. Lösungsansätze
8. Fazit und Ausblick
9. Literaturverzeichnis
10. Glossar
11. Abkürzungsverzeichnis 12. Abbildungsverzeichnis 13. Anlagenverzeichnis
Michel Fassbinder
1. Einleitung
a. Allgemeine Rahmenbedingungen
• Kostendruck im Gesundheitswesen
Seit Jahren sehen sich Manager im Gesundheitswesen einem stetig wachsenden Kostendruck ausgesetzt. Dieses Phänomen hat verschiedene Ursachen. Auf der Einnahmeseite sind dies u. a. der Wegfall öffentlicher Zuschüsse zur Deckung von Defiziten infolge der Privatisierung von Krankenhäusern oder zumindest der Überführung in eigenständige kommunale Unternehmen, und die Einführung des Fallpauschalensystems zur Finanzierung der Krankenhausleistungen. Auf der Ausgabenseite beeinflusst der medizinische Fortschritt mit kostenintensiven Medikamenten oder moderner Medizintechnik sowie nicht refinanzierte Erhöhungen der Personalaufwendungen die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses.
Vor diesem Hintergrund sind in der heutigen Zeit die knappen Ressourcen und ökonomischen Imperative für Gesundheitseinrichtungen normaler Alltag geworden. Das erfordert eine Arbeitsaufgabengestaltung mit einer effizienten Disposition. Ein modernes betriebswirtschaftliches Arbeiten i. S. v. Methoden eines Prozessmanagements ist Teil der Aufgabenfelder (vgl. 1. Greulich, T., Thiex - Kreye; 1997; S. 5).
• OP-Bereich als kostenintensiver Bereich
Der OP-Bereich ist das Kernstück des Krankenhauses und wenn der Motor ins „stottern “kommt, kann er stehen bleiben (vgl. 2. Prof. Busse T.; S. 4-5).
Im Krankenhaus ist der operative Funktionsbereich der kostenintensivste Bereich überhaupt und ist mit anderen Stationen oder Bereichen nicht zu vergleichen. Bei einem Klinikum mit einem umfangreichen zentralen Operationsbereich verbergen sich unvorstellbar hohe Kosten. Diese sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Das Management und die Koordination solcher Bereiche sind sehr komplex und beinhalten viele unterschiedliche Aufgaben. Die zu erarbeitenden Kernaufgaben können nur durch die Integration aller betroffenen Berufsgruppen erfüllt werden, die gewillt sind diese zu unterstützen und zu realisieren (vgl. 3 Greulich, T., Thiex-Kreye; 1997; S. 45).
Die Personal- und Sachkosten des OP-Bereichs liegen bei über 30% der
Michel Fassbinder
Gesamtausgaben der operativen Medizin (vgl. Macario 1995; S. 1138- 1144) und ist unter der Bezeichnung der OP-Kapazität umfasst. Darunter sind jedoch nicht nur die unterschiedlichen Kostenfaktoren gemeint, sondern insbesondere die Betriebszeit.
• Struktur des OP-Bereichs
Um eine medizinische Behandlung im operativen Funktionsbereich eines Krankenhauses leisten zu können, ist eine geeignete Struktur Grundvoraussetzung. Die Bedeutung der daraus resultierenden Krankenhausproduktion kann als interaktiver Prozess mit komplexen Beziehungen, steuernden und abgegrenzten Mitteleinsatz gesehen werden. Damit verfügt der Prozess über einen differenzierten Charakter (vgl. Morra 1996; S. 33 f.).
Die Struktur für die Prozessgestaltung wird mit dem Sekundär-Input erstellt. Unter dem Sekundär-Input sind die einzusetzen Produktionsfaktoren (z.B. Arbeitszeiten der Ärzte und Pfleger, Material) zu verstehen und gelten als Ressourcenverbrauch von Mitteleinsatz. Dazu werden, unter Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für den Prozess der zu erstellenden Dienstleistung die Produktionsfaktoren Betriebsmittel, Material und Personal unterschieden.
Das Material (z.B. Spritzen, Drainagen, Pflaster) wird in der Anwendung nach der Art und Höhe und des Einsatzzeitpunktes unterschieden. Es gehört wie die nachfolgenden Ressourcen zu den Aufgaben der Arbeitsplanung. Unter der Ressource Anlagen versteht man die betriebliche Ausstattung mit ihren räumlichen Voraussetzungen (z.B. Gebäude, Geräte wie Röntgenapparate, Intranet). Es hat eine geringere Verbrauchsgeschwindigkeit bzw. einen geringeren Verschleiß als das Material. Die personelle Ressource ist mit ihrer Anzahl, den speziellen Kenntnissen und Qualifikationen und ihrem zeitlichen Einsatz die wichtigste Ressource und der kostenintensivste Produktionsfaktor zugleich (vgl.http://www.gruenderleitfaden.de)
In der Aufbauorganisation sind verschiedene Berufsgruppen eingeteilt. Diese sind als sogenannte Strukturgruppen in die einzelnen Fachdiziplinen Chirurgie, Anästhesie und Pflegedienst unterteilt. Die jeweilige Abteilungsleitung (Chefärzte, PDL) hat ihre Fachdisziplin nach Absprache mit dem OP-Management sinnvoll einzusetzen. Die Aufgaben
Michel Fassbinder
des OP-Managers wiederum richten sich nach dem Rationalprinzip (siehe Glossar).
Abbild 1: Strukturgruppen im OP-Bereich
b. Forschungsstand
Die Beurteilung von OP-Prozessen mittels der Kennzahlen „Auslastung
“und „Wechselzeit “
Durch geplante OP-Zeiten entstehen fixe Kosten, gleichgültig ob sie für die Operation genutzt werden oder nicht (vgl. Freytag 2005; S. 71-79). Damit wird u. a. das Vorhaben eines effizienten Prozessablaufs für ungenutzte OP-Zeiten begründet. Beispiele für nicht genutzte OP-Zeiten sind erhöhte Wechselzeiten zwischen den OP-Eingriffen oder verspätete Schnittzeiten der ersten OP. Durch derartige Verzögerungen kann der Arbeitsablauf eines ganzen OP-Teams, mit circa sechs qualifizierten Fachkräften, zum Stocken kommen. Zur Aufklärung der verursachten Verzögerung von Wechselzeiten ist eine genaue manuelle Datenerfassung zur Dokumentation erforderlich. Dies bedeutet einen weiteren Arbeitsaufwand für die vor Ort betroffenen Mitarbeiter.
Mit einer umfangreichen Literaturrecherche wurden mehrere Studien und Methoden ermittelt, die den Untersuchungsgegenstand verdeutlichen. In einem Verfahrensbeispiel wurden ausschlaggebende Gründe für Wartezeiten im OP identifiziert (vgl. Overdyk 1998; S. 896- 906). Daraufhin wurde ein Training für alle Mitarbeiter im OP für die Gegenmaßnahmen der Ursachen gegenwärtigen Situation eingeführt. Durch einen früheren Beginn von 22 Minuten der OP 1. wurden schließlich die Wechselzeiten um 16 Minuten verkürzt. In einer anderen Studie (vgl. Truong 1996; S. 1233-1236) wurde den Mitarbeitern
Michel Fassbinder
innerhalb einer Diskussionsrunde sowie in Briefform die Bedeutung des pünktlichen Beginns am Morgen nähergebracht. Durch den Einsatz weiterer Anästhesiefachkräfte wurden überlappende Einleitungen ermöglicht. Das bedeutet, den nachfolgenden Patienten während der Operation des vorherigen Patienten einzuleiten, um parallel zu arbeiten und dadurch nicht operative Zeiten, die Anästhesiezeit sowie die Wechselzeiten zu verkürzen (vgl. Torkki 2005; S. 401-405, Hanss 2005; S. 391-400). In einer anderen Studie von Denz (2007; S. 580-590) ist eine Notwendigkeit der Verbesserung in der Organisation von OP-Abläufen dargestellt. Erreicht werden kann dies durch optimierte, direkte Steuerung und Koordination von Arbeitsabläufen mit Hilfe von Kennzahlen. Zu entwickeln sind diese objektiv und für alle Beteiligten nachzuvollziehen. Die Kennzahlen dienen der Messung effizienter bzw. ineffizienter Abläufe.
Mit der retrospektiven Studie wird primär der Ist-Zustand aus objektiven Kennzahlen untersucht (Auslastung, Wechselzeiten und erste OP-Zeit). Der vorgesehene Untersuchungszeitraum beläuft sich auf das gesamte Jahr 2022. Bei Stichprobenuntersuchungen wurden die Monate Oktober und November 2022 ausgewählt. Es wird davon ausgegangen, dass eine hohe ungenutzte Zeit besteht und die OP-Auslastung geringer ausfällt als erwünscht. Der Zugang zu der Datenquelle ist im Kapitel 4.1 Datenmaterial ausgewiesen. Die Methode der Berechnung für die OP- Kapazitätsauslastung wird unter Kapitel 4.2. Methode aufgeführt.
c. Grundlagen in den OP-Bereichen des Untersuchungsobjektes
I Fachdisziplinen
Das Klinikum XL umfasst die medizinischen Disziplinen Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Chirurgie, Kopfklinik, Neurologie mit Schlaganfallheit, Dermatologie, Urologie und Gynäkologie. Davon sind 6 internistische-, 10 herzchirurgische und 12 chirurgische Intensivbetten. Im Ganzen hat das Klinikum XL 1000 Betten zur Verfügung. Die stationäre Fallzahl pro Jahr beträgt über 36.000 Patienten, die ambulanten Fallzahlen belaufen sich im Jahr auf ungefähren 50.000 Patienten. Das sind circa 30.000 Operationen jährlich. Die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten