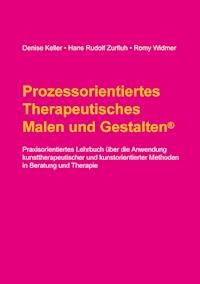
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kunst in Beratung und Therapie? Was heisst das? Wie soll das funktionieren? In diesem Buch erfahren Sie es! Gleichzeitig lernen Sie eine praxiserprobte, radikale und gleichsam intuitive Methode kennen, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zielgerichtet zu begleiten. Sie erfahren in allen Details, was das Prozessorientierte Therapeutische Malen und Gestalten® ausmacht. Und Sie bekommen einen praktischen Einblick, wie unsere Klienten mithilfe der PTM-Methode erfolgreich Krisen gemeistert, bohrende Fragen geklärt und einschneidende Situationen aufgearbeitet haben. Kurzum, Sie erhalten das gebündelte Wissen, das wir seit über zehn Jahren an unsere Auszubildenden weitergeben. Dieses Buch richtet sich an angehende und erfahrene Kunsttherapeuten ebenso wie an Coaches, Berater, Supervisoren und Therapeuten anderer Disziplinen, die sich für kunstorientierte Methoden begeistern. Doch auch Neugierige und Interessierte werden etwas für sich und ihren Alltag mitnehmen. Davon sind wir überzeugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wichtige Hinweise
Sämtliche in diesem Buch vorgestellten Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft worden. Dennoch übernehmen die Autoren und der Verlag keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der hier beschriebenen Anwendungen ergeben. Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall oder bei ernsthaften Beschwerden immer professionelle ärztliche oder naturheilärztliche Hilfe in Anspruch.
Zur besseren Lesbarkeit wurden personenbezogene Bezeichnungen, die sich auf Frauen und Männer beziehen, im Buch generell in der männlichen Form angeführt. Dies soll keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. Frauen sind immer auch mitgemeint.
Die Fallberichte in diesem Buch basieren auf wahren Gegebenheiten, die wir gemeinsam mit den Klienten in Settings bearbeitet haben. Alle persönlichen Daten sind zum Schutz der einzelnen Personen verändert worden. Unter anderem wurden in den Fallbeispielen personenbezogene Bezeichnungen gewählt, die nicht zwingend mit der Realität übereinstimmen müssen. Daher möchten wir darauf hinweisen, dass die von uns vorgestellten Mittel und Methoden bei beiden Geschlechtern angewandt werden können.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben! Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.» So lauten die ersten Zeilen von Johann Wolfgang von Goethes Gedicht Der Zauberlehrling. Sie beschreiben ganz wunderbar, mit welchen Gefühlen und Gedanken ich in dieses Buchprojekt startete. Dass mich der damit verbundene Prozess so an meine Grenzen bringen würde, war für mich zunächst unvorstellbar. Zwar verspürte ich von Anfang an grossen Respekt vor den Themen «Kunsttherapie» und «Beratung / Coaching mit kunstorientierten Methoden». Doch hätte ich mir nie träumen lassen, wie hochkomplex und detailreich, herausfordernd und radikal, rational und gleichsam intuitiv sie tatsächlich sind.
Bereits von den ersten Zeilen an glich das Aufspüren, Übersetzen und Aufschreiben der Besonderheiten des Prozessorientierten Therapeutischen Malens und Gestaltens (PTM) für mich dem Präparieren und Konservieren eines Exponats. Zunächst unbewusst und mit innerem Widerstand, irgendwann gewollt und einem tiefen Ja zur Aufgabe, begann ich in einer Art Fernstudium die von Denise Keller und Hans Rudolf Zurfluh angebotene Ausbildung theoretisch – ja, rein theoretisch – zu durchlaufen. Das betone ich, weil mir die Mitarbeit an diesem Buch sehr deutlich gezeigt hat, welche Höchstleistung von seriös kunsttherapeutisch arbeitenden Menschen verlangt wird. Wissen allein nützt hier wenig. Erst in der Umsetzung zeigt sich das wahre Können von Kunsttherapeuten. Viel zu leicht und viel zu schnell würden sich sonst selbst erfahrene Coaches und Berater auf den Lebenslandkarten ihrer Klienten verirren. Deshalb sind Kunsttherapeuten für mich auch mehr als wegweisende Taschenlampen. Sie sind im wahrsten Sinne Prozessbegleiter – mit gut gefütterten Wanderschuhen an den Füssen, einem bis zum Rand und darüber hinaus gefüllten Methodenrucksack und einer schier unendlich grossen Picknickdecke, auf der aufgestaute Gefühle, kreisende Gedanken, angesammelte Erlebnisse und emotionale Handlungen aller Art platziert und bei Bedarf abgeschüttelt werden können. Ab und an zücken sie auch einfach einen Spiegel. Meist dann, wenn ihr Gegenüber Klarheit sucht. Daraufhin wird ihnen aus Trotz vielleicht die Zunge rausgestreckt oder eine gehässige Grimasse entgegengebracht. Doch selbst das halten sie mit einer irritierenden Selbstverständlichkeit aus. Von den allfälligen psychosomatischen Reaktionen oder echten Härtefällen ganz zu schweigen.
Kurzum, Kunsttherapeuten und mit kunstorientierten Methoden arbeitende Berater müssen jede Menge können, sich jeder Menge stellen und vor allem jede Menge individuelle Persönlichkeitsarbeit leisten. Das unterscheidet sie von den meisten anderen mir bekannten Berufsgruppen, die sich mit ähnlichen Themen befassen.
Es geht mir hier aber keinesfalls um die oberflächliche Beweihräucherung und Huldigung der kunsttherapeutischen Arbeit. Im Gegenteil! Dieses Vorwort richtet sich vielmehr an diejenigen, die nach dem Lesen dieses Buches und der darin vorgestellten Methoden womöglich meinen, das sei alles ganz einfach. Meine eigenen Erfahrungen zeigen: Nein, ist es nicht! Ganz und gar nicht! Eine solche Einstellung ist aus meiner Sicht sogar gefährlich. Dabei können alle Beteiligten nur verlieren. Denn machen wir uns nichts vor: Eine kunsttherapeutische Ausbildung mit Erlangung eines eidgenössischen Diploms dauert in der Schweiz (glücklicherweise) nicht umsonst zwischen fünf und sechs Jahren. Insofern ersetzt das Lesen dieses Buches definitiv keine Ausbildung auf dem Gebiet.
Dennoch zeigt es, was in der Therapie und Beratung möglich ist, wenn unterschiedlichste Theorien und Ansätze miteinander verknüpft werden. Das ist für mich das Schöne an der PTM-Methode. Sie ist aufgrund ihrer Vielfalt hochvariabel, individuell erweiterbar und offeriert fast automatisch und jederzeit frische Ansatzpunkte für neue oder bestehende Lebensphasen von Klienten. Die PTM-Methode ist wie ein unsichtbar mitlaufender roter Faden, den jeder Mensch an einem x-beliebigen Punkt in seinem Leben aufnehmen, weiterspinnen und wieder fallen lassen kann. Aus Klientensicht schätze ich zudem die Nachhaltigkeit. Selbst jetzt, fünf Jahre nach meinem ersten Kontakt mit der Kunsttherapie und der PTM-Methode, profitiere ich von den gewonnenen Erkenntnissen aus meinen Gestaltungsprozessen. Und immer wieder bin ich überrascht, was ich im Nachhinein noch alles verstehen durfte.
Nun gut, vielleicht sind Sie ähnlich kritisch wie ich und denken gerade: «Die kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist» oder «Das muss die ja sagen». In dem Fall hilft nur eins: Sie probieren die Kunsttherapie – und hoffentlich die PTM-Methode – einmal live aus oder lassen sich von jemandem, der mit kunstorientierten Methoden arbeitet, beraten oder coachen. Danach werden Sie wissen, was ich meine. Davon bin ich überzeugt.
Romy Widmer
im Herbst 2016
1 | Mensch, erkenne dich selbst!
Wenn Verstimmungen plötzlich aus dem Nichts auftauchen, sich in unserem etablierten Leben breitmachen, sich die Anzeichen von Unlust mit der «Delete»-Taste nicht mehr aus unserer Gefühlsdatenbank löschen lassen oder wir uns wiederholt in den gleichen Situationen wiederfinden, die wir vermeiden wollten, werden unweigerlich Selbstzweifel und Ohnmachtsgefühle wach und drehen schrittweise den Lebensenergiehahn zu. Dauert dieser Zustand so lange an, bis es nur noch tröpfelt, schwinden die Lebensgeister fast ganz. Dies kann zu psychischen oder körperlichen Veränderungen und letztlich sogar zu Krankheit führen. Das Leben verliert an Farbigkeit. Gleichzeitig fordert uns dieser Prozess dazu auf: Mensch, erkenne dich selbst!
Zwei Wege zur Farbigkeit
Bereits vor mehr als zwanzig Jahren war es dieser Satz, der uns unabhängig voneinander dazu animierte, uns näher mit dem Menschsein zu beschäftigen.
Denise Keller
Der Zugang zu den Farben wurde mir im wahrsten Sinn in einen Kinderwagen mit blauer Sonnenblende gelegt. Dieses Blau muss einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben. Nur so kann ich es mir erklären, warum ich mich nach über vierzig Jahren noch daran erinnere. Gleiches gilt für einen moosgrünen Teppich, auf dem ich als Vierjährige sass und heimlich ein Streichholz anzündete. Als es mir gelang, erschrak ich sehr und liess das brennende Zündholz fallen. Es blieb ein Brandloch im Teppich zurück, das meine Eltern bemerkten. Vielleicht ist das der Grund, warum Moosgrün in mir bis heute ein Unwohlsein auslöst.
Doch auch viele Jahre später, während meiner ersten Berufsjahre, spielten Farben eine wichtige Rolle. Beim Gestalten von Räumen und Produkten ebenso wie beim künstlerischen Schaffen konnte ich mich auf mein Farbengefühl verlassen. So entwickelte ich mich schrittweise zu einer Fachfrau für Farbgestaltung.
Nach einiger Zeit erfüllten mich diese Tätigkeiten jedoch immer weniger, und ich begann, nach einer neuen Aufgabe zu suchen. Ich besuchte eine Weiterbildung an einer Kunst- und Gestaltungsschule. Dort begegnete ich einem Körpertherapeuten und Künstler, der mir einen neuen Zugang zu den Farben vermittelte. Er leitete uns Studierende an, Farben mit allen Sinnen wahrzunehmen. Unter anderem mussten wir Rot in einer Körperbewegung darstellen, Grün in Worte fassen und Gelb als Persönlichkeit zu Papier bringen. Nach einer intensiven Woche voller Aha-Erlebnisse und Neuentdeckungen war mir meine Aufgabe klar: Ich würde künftig eine Lebensgestalterin sein und die Kunst und Gestaltung mit einer therapeutischen Tätigkeit verbinden.
Mit dieser Vision im Herzen begab ich mich auf einen langen Ausbildungsweg. Dieser brachte mich mit verschiedenen Therapieformen in Kontakt. Schliesslich liess ich mich zur Kunsttherapeutin ausbilden, da die Kunsttherapie meine therapeutischen und beratenden Fachkompetenzen am besten mit meiner gestalterischen Basisausbildung vereinte.
In 2002 gründete ich das atelier farbton und konnte während vieler Gestaltungsprozesse erleben, welch grosse Wirkung Farben auf Menschen haben. Deshalb spielen sie in meiner Arbeit bis heute eine zentrale Rolle und dienen mir als wichtige Wegweiser.
Als ich vor rund vierzehn Jahren meinem Partner und heutigen Ehemann Hans Rudolf Zurfluh begegnete, bekam auch das Material Ton einen Stellenwert in meiner kunsttherapeutischen Arbeit. Hans Rudolf arbeitete schon damals als Keramiker, Kunsttherapeut und Therapeutic-Touch-Praktiker. Er besass eine Töpferschule und eine Praxis für Energiemedizin.
Das atelier farbton bekam eine neue Bedeutung, denn wir beschlossen, unsere Kompetenzen – Farben und Ton – zu vereinen. Diese Fusion brachte uns beruflich und persönlich weiter. In uns erwuchs der Wunsch, unsere Methode anderen Menschen zugänglich zu machen. Gemeinsam entwickelten wir einen Kunsttherapielehrgang und gründeten 2010 unsere Firma magenta – schule für farbiges lernen.
Seither bereichern wir die Bildungslandschaft Schweiz mit unserer Farbigkeit. Sie wird inzwischen zum siebten Mal von unseren Auszubildenden an ihre Klienten weitergetragen. Diese Entwicklung ist für mich in der Farbe Magenta verankert. Sie zeigt sich, wenn das Alte nicht mehr greift. Victor Hugo drückte dies einst so aus: «Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.» Genauso ist es!
Hans Rudolf Zurfluh
Im Gegensatz zu Denise nahm ich als Kind zwar die Farben in meiner Umgebung wahr, doch sie waren entweder schön oder weniger schön. Dafür malte ich in meiner Schulzeit, so of ich konnte. Die Wasserfarben oder Malstifte, die ich dazu verwendete, waren meist Reste in Näpfen oder ausrangierte Stummel. Richtige Farben konnten sich meine Eltern nicht leisten, genauso wenig wie Papier. Dieses erbettelte ich meist in der nahen Druckerei.
Nachdem mir meine Eltern als Teenager untersagt hatten, Grafiker geschweige denn Künstler zu werden, schlug ich zunächst eine Karriere im Management ein. Mit dieser verdiente ich zwar Geld, sie machte mich aber auch krank. Deshalb stieg ich im Alter von dreissig Jahren schrittweise aus dem regulären Berufsleben aus.
Erst danach traten die Farben wieder in mein Leben. Ich besuchte eine Kunstgewerbeschule, nahm Unterricht bei Künstlern und belegte in Basel Töpferkurse. Dabei erkannte ich, dass die Arbeit mit Ton mich stabilisiert und fasste den Entschluss, eine Töpferschule zu eröffnen.
Die Töpferschule verwandelte sich nach und nach in einen Begegnungsraum, in dem die Auseinandersetzung mit dem Ton, dem Brennen, den Farben und dem Papier wichtiger wurden als das Endprodukt. Gleichzeitig gewann für mich die Vertiefung mit den Menschen und mir selbst an Bedeutung. Ein von mir getexteter Satz, den ich als Aufhänger für eine meiner ersten Ausstellungen wählte, begann sich mehr und mehr in meinem Leben auszuwirken. Er lautet: «Nur wer sich im Laufe seines Lebens sich selber nähert, nähert sich auch seinen Mitmenschen.» Erst heute beginne ich, ihn tief in mir zu verstehen und zu begreifen.
Der Satz startete gleichsam eine Suche nach Antworten auf die Frage: Und was noch? Denn die Erkenntnis, was alles in mir und meinen Mitmenschen an Potenzial brachlag, liess mich unzufrieden mit dem in Ausbildungen Erlernten werden. Sehr oft stand ich ratlos vor Bildern oder Objekten und fragte mich: Was soll ich zu diesem Bild, zu dieser Form, zu dieser Farbe sagen? Obwohl die psychologischen Erklärungsmodelle interessant und spannend waren, halfen sie mir nicht weiter. In den künstlerischen Erklärungsmodellen und Arbeitsmethoden fand ich zwar erste Ansätze, aber sie liessen mich die Bilder und Objekte zu wenig erspüren, erkennen und erleben.
Als Denise Keller an einem von mir geleiteten Meditationskurs teilnahm, wurde ich fündig. Ich hatte Denise bereits zuvor einige Male getroffen. Doch erst im Verlaufe des Kurses kamen wir näher ins Gespräch. Sie erzählte mir, sie sei Kunsttherapeutin, coache mit kunstorientierten Methoden und arbeite regelmässig mit Kindern und Erwachsenen. Schon damals bezeichnete sie ihre Methode als Prozessorientiertes Therapeutisches Malen (PTM). Auch berichtete sie mir von Farben als Wesenheiten, den ihnen zugeordneten Formen und Zahlen, von Farbtests, von lebensgrossen Körperbildern, von Collagen, von den neun Lebensbereichen und so weiter.
Schnell war Denise und mir klar, dass wir unsere Kompetenzen verbinden möchten, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. So fügten wir allmählich meine Fachkompetenzen als Plastiker, meine erlernten kunsttherapeutischen Methoden und mein Wissen über die Energiemedizin mit dem Wissens- und Erfahrungspaket von Denise zusammen. Geboren war die neue PTM-Methode, wie wir sie heute unterrichten.
Für mich ist unsere angebotene Ausbildung noch immer wie aus einem Guss. Obwohl sich seit Beginn des ersten Lehrgangs vieles entwickelt hat und sich weiter entwickeln wird, hat unser Grundkonzept Bestand. Dieses Buch ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg im Ausleben und Entdecken meiner Farbigkeit.
Gestalten Sie Ihr Leben farbig?
Wie ist das bei Ihnen? Gestalten Sie Ihr Leben farbig? In unserer modernen Gesellschaft hat die Suche nach dem Finden der eigenen Farben in den letzten Jahren an Aktualität gewonnen. Immer mehr Menschen empfinden das Leben als Qual der Wahl statt als Quelle der Fülle. Sie erleben einen Mangel an Zeit, vermissen echte Begegnungen und fühlen sich von den allgegenwärtigen Reizen überflutet. Sie leiden an seelischem Hunger und unter starker innerer Leere. Die wiederkehrenden Entwertungen und Bewertungen im persönlichen oder beruflichen Umfeld verstärken diese Gefühle. Erst wenn das Mass übervoll ist und im seelischen Vakuum die Luft knapp wird, suchen sie nach neuen, stimmigeren Lebensentwürfen.
Hier setzt die Kunsttherapie an und bietet den Suchenden einen wohltuenden Schutzraum, um sich auf die Spurensuche nach der individuellen Farbigkeit zu begeben. Sie ermöglicht:
das Hinterfragen alter Denkmuster (um neuen, positiveren Ideen Platz zu geben),
das Fördern der Eigenverantwortlichkeit (Hilfe-zur-Selbsthilfe-Prinzip),
die Begegnung von Mensch zu Mensch,
das Neuentwerfen der eigenen Persönlichkeit,
die Gestaltung neuer Lebensentwürfe,
das Lernen von Achtsamkeit (hinsehen, hinhören, wertschätzend kommunizieren),
das Üben im / am Bild oder Objekt (bevor es im Alltag ernst wird),
das Beleuchten von Verhinderungsstrategien,
das Erkennen und Erleben der Selbstwirksamkeit (je nach persönlicher Machbarkeit),
die Stärkung gesundheitsfördernder Prozesse auf körperlicher und seelischer Ebene.
Kurzum, die Kunsttherapie interveniert dort, wo der Lebensfluss von Menschen ins Stocken gerät und die grosse Frage nach dem «Wie weiter?» unüberhörbar ist. Die Art der Begleitung erfolgt mit allem, was persönlichen Themen Ausdruck verleiht: dem Malen von Bildern, dem Kleben von Collagen oder dem Gestalten von Objekten. Auf diese Weise soll die innere Farbigkeit des Menschen (wieder) entfacht und nach aussen sichtbar werden.
Farbige Prozessarbeit
Um Menschen ihrer Farbigkeit näherzubringen, begannen wir 2004 damit, unsere eigene kunsttherapeutische Methode zu entwickeln. Basierend auf unseren Erfahrungen und unserem Wissen kombinierten wir alte mit neuen Theorien, probierten Werkzeuge anderer Disziplinen aus, adaptierten sie für unsere kunsttherapeutische Arbeit und überprüften die Ergebnisse mit unseren Studierenden und Klienten. Entstanden ist daraus, was wir Prozessorientiertes Therapeutisches Malen und Gestalten (PTM) nennen.
Die PTM-Methode fusst auf zwei Fundamenten: dem Prozess und der (Kunst-)Therapie. Dabei steht das Wort Prozess oder prozessorientiert für jedes kunsttherapeutische Setting, in dem über Farben oder Objekte eine Auseinandersetzung mit der Innenwelt stattfindet. Diese Vertiefung geschieht unabhängig von Zeit und Dauer, da in jenen Momenten alles Ergebnisorientierte in den Hintergrund rückt. Die Klienten sollen in ihre Gestaltungsarbeit eintauchen und sich vom Geschehen am Bild oder Objekt berühren lassen können. Nur so bekommt das Unvorstellbare einen Erlebnisraum, und nur so wird ein Selbsterleben möglich. Beides ist für ein erfolgreiches (kunst-)therapeutisches, ganzheitliches Arbeiten essenziell.
Therapie oder therapeutisch stammt aus dem Griechischen und wurde ursprünglich mit dienen übersetzt. Im heutigen Sprachgebrauch steht es für Heilbehandlung (vgl. Duden, 2013). Wir verstehen darunter die vom Kunsttherapeuten angeregte Aktivierung der Selbstheilungskräfte der Klienten. Diese erfolgt primär über das Malen und Gestalten, denn der experimentelle Umgang mit Farben, Ton, Holz, Speckstein oder anderen Materialien stimuliert die Entwicklung von eigenständigen Lösungsstrategien. Sie motiviert die Klienten zu förderlicheren Lebensentwürfen.
Beim PTM geht es also um mehr als darum, ein Bild zu malen, sich auszudrücken und dadurch etwas zu erkennen. Das Ziel ist es, die gewonnenen Erkenntnisse über die Arbeit am Bild oder Objekt ins Leben zu integrieren. Deshalb wird dasselbe Bild oder Objekt auch so lange vom Klienten bearbeitet, bis es wirklich stimmig und unterstützend ist.
Eine Methode in der Kunsttherapie?
Vielleicht fragen Sie sich gerade, weshalb wir ein Buch über das PTM schreiben und wieso wir es als Methode bezeichnen. Fangen wir mit der ersten Frage an: Was sind die Gründe für dieses Buch?
Der wichtigste Grund ist unser tiefer Wunsch, für unsere Studierenden, alle Kunsttherapie-Interessierten und letztlich uns endlich ein kompaktes Hilfsmittel zu schaffen. Denn wir haben eine funktionierende und nachhaltige Methode gefunden, die es unseren Klienten und Studierenden erlaubt, in einem gestalterischen Prozess selbstverantwortlich zur eigenen Genesung beizutragen. Somit sehen wir in diesem Buch ein fundiertes und erprobtes Instrumentarium. Es ist ein wirkungsvolles, methodisches Verfahren, das auch nach über zehn Jahren weiter von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen profitiert. – Doch was bedeutet das Wort Methode überhaupt?
Der Begriff Methode stammt aus dem Griechischen und bezeichnet ein zielgeleitetes, planmässiges und systematisches Vorgehen, das zu einer anwendbaren Fähigkeit bei der Lösung einer theoretischen oder praktischen Aufgabe führt (Lorenz, 1995). Wann immer wir die PTM-Methode nutzen, entsprechen wir dieser Definition. Das kann man sich wie folgt vorstellen:
Zu Beginn jedes Settings erfolgt zunächst eine ausführliche kunsttherapeutische Anamnese. Sie soll zur Klarheit über die Befindlichkeiten des Klienten und zur Festlegung erster Therapieziele führen. Erkenntnisleitende Beurteilungskriterien wie Farbtests, Collagen oder andere Mittel unterstützen diesen Einstieg und sensibilisieren den Klienten für seine schöpferischen Kräfte. Erst danach wird ihm der erste konkrete Farb- oder Objektauftrag erteilt. Vielleicht folgt der Klient an diesem Punkt sehr schnell seinem inneren Impuls, ein klares Bild zu malen oder bestimmtes Objekt zu formen. Es ist ebenso möglich, dass sich dieser Prozess langsamer entwickelt.
Die daran anschliessenden Phasen wechseln zwischen freier Gestaltung und richtungsweisenden Interventionen ab. Dieser Pendelbewegung wird im PTM Rechnung getragen, indem der Prozess – statt die Lösung – therapeutisch eingesetzt wird. Das heisst, der Klient darf sich malend und gestaltend treiben lassen. Gleichzeitig erfährt er Anleitung und Begleitung, damit sich die Bewusstwerdung einstellt, brachliegende Ressourcen aktiviert werden und der Klient selbstwirksam werden kann. Beide Schritte erfolgen in Form einer Aufforderung an den Klienten, verbindlich zu werden und abstrakte Bilder oder Objekte zu konkretisieren, da «Fantasiegebilde» erst dann zu wegweisenden Kräften werden, wenn sie sich auf einer Realitätsebene zeigen. Darum ist es wichtig, Dingen einen Namen zu geben, sie eingehender zu beleuchten und zum Dialog herauszufordern. Kurzum, die PTM-Methode verfolgt das klare Ziel, das Freigewordene zu bündeln und den Klienten zu seinem Werk Stellung nehmen zu lassen.
Oft kommt es dabei zu Konfliktsituationen zwischen dem Klienten und dem Kunsttherapeuten. Häufig zeigt sich sogar die ganze Palette menschlicher Verhaltensformen, die für alle Beteiligten zu einer grossen Belastungsprobe werden kann. Doch genau diese Reibungen sucht die PTM-Methode, um den im Vorlauf definierten Therapiezielen gerecht zu werden. Das heisst, Bilder und Objekte müssen geklärt und die daraus resultierenden Gefühle mit entsprechenden achtsamen Interventionen seitens des Kunsttherapeuten zuerst gelebt und danach umgewandelt werden können. Der Klient soll sich als selbstwirksame Person erfahren und sich neue Realitäten ermalen / erformen. Es werden die fünf klassischen Schritte einer jeden Therapie durchlaufen: Erinnern, Bewüten, Beweinen, Begreifen und Beenden.
Die PTM-Methode ist somit ein wandelbares, dynamisches und überprüfbares Werkzeug, das systematisch, zielgerichtet und planmässig ist und gleichzeitig neue Wege in der kunsttherapeutischen Begleitung offenhält. Entsprechend verstehen wir sie auf der einen Seite als Rahmenbedingung und Leitlinie und auf der anderen Seite als Mittel und Zweck, um unsere Klienten im kunsttherapeutischen Setting dazu zu motivieren, die Grenzen zu sprengen und sich neu zu entwerfen. Jede einzelne Prozessphase während der kunsttherapeutischen Settings reflektiert diese Wechselbewegung. Sie ist mit dem Ein- und Ausatmen vergleichbar. Einatmen bedeutet, den Klienten mit richtungsgebenden Leitlinien methodisch zu begleiten. Ausatmen bedeutet, Freiraum zu gewähren, so dass sich der Klient als selbstwirksam erfahren kann. Der Kunsttherapeut fungiert in diesem Kreislauf als Regler, der jederzeit kompetent auf den Prozessverlauf einwirken kann.
Kurz und bündig: Die PTM-Methode in Buchform
Die folgenden Kapitel bringen Ihnen die PTM-Methode auf vielfältige Weise näher. Sie gewähren Ihnen Einblicke in die Kunsttherapie im Allgemeinen und die fünf PTM-Pfeiler im Besonderen. Gleichzeitig erzählen sie in Wort und Bild die Geschichten verschiedener Menschen, die sich in den letzten Jahren auf die herausfordernde, aber erfolgreiche Suche nach ihrer Farbigkeit gemacht haben. So erhalten sie einen hautnahen Einblick in die Wirkungsweise der PTM-Methode und unsere Arbeit als Kunsttherapeuten.
Wenn Sie es danach kaum erwarten können, tiefer in die Welt der Kunsttherapie einzutauchen oder die Methode direkt testen wollen, haben wir unser Ziel erreicht, Ihnen ein praxisorientiertes Buch in die Hand zu geben.
Übrigens: Obwohl die PTM-Methode bislang hauptsächlich in der Kunsttherapie angewendet wurde, lässt sie sich ebenso hervorragend in andere beratende und begleitende Tätigkeiten integrieren. Es ist also egal, ob Sie dieses Buch als Experte, Fachkundiger oder Interessierter lesen. Sie werden etwas für sich und Ihren Alltag mitnehmen können. Da sind wir uns sicher.
2 | Denn was innen, das ist aussen.
Wie startet eine Suche nach der inneren Farbigkeit? Was genau steckt hinter der Methode des Prozessorientierten Therapeutischen Malens und Gestaltens (PTM)?
Genau diese Fragen beantwortet dieses Kapitel. Sie erfahren, worauf die PTM-Methode fusst, was sie ausmacht und wie sie sich im weiten Feld der theoretischen und praktischen Kunsttherapie platziert. Hierzu definieren wir den Begriff Kunsttherapie und beschreiben den wissenschaftlichen Rahmen der PTM-Methode in Form der fünf Grundpfeiler. Ein erstes Fallbeispiel liefert Ihnen zudem Einblicke in unsere praktische Arbeit.
Kunst, System oder beides?
Um die Methode des Prozessorientierten Therapeutische Malen und Gestalten (PTM) nachzuvollziehen, ist es wichtig, den Begriff Kunsttherapie zu verstehen. Spannenderweise herrscht noch immer Uneinigkeit darüber, wie er zu definieren ist. So beschreibt Leuteritz (1997) die Kunsttherapie kurz und knapp als Behandlung durch künstlerisches Gestalten. Mayer-Brennenstuhl (1999) sagt darüber:
«Das Anliegen der Kunsttherapie ist der Mensch im schöpferischen Prozess – im äusseren Gestaltungsprozess von Bildern und im inneren Wandlungsvorgang seiner Psyche. Kunsttherapie verwendet dabei die Mittel und Materialien der Bildenden Kunst – Farben Formen, Bildinhalte. Sie will jedoch keine Kunstwerke hervorbringen, vielmehr ist das Bildnerische Arbeiten Medium des therapeutischen Prozesses.» (S. 23)
Menzen (2000) wiederum definiert die Kunsttherapie als einen inneren, psychischen Entwicklungsprozess, der durch gestalterische Mittel einen Ausdruck findet, während Trüg und Kersten (2013) sie als einen strukturierten Gestaltungsvorgang ansehen, «in dem sowohl der innere wie der äussere Raum individuell zum Ausdruck gebracht werden kann» (S. 5). Das heisst, für die genannten Wissenschaftler stehen die kreativen Handlungen im Vordergrund, die der therapeutisch begleiteten Selbstreflexion dienen sollen.
Mechler-Schönach (2005) hingegen bietet eine ganzheitlichere Betrachtungsweise an. Für sie ist die Kunsttherapie eine vielfältige und tiefgründige Methode. Diese kann als
«[…] ein ressourcen-, erlebnis-, handlungs- und beziehungsorientiertes therapeutisches Verfahren bezeichnet werden, bei dem alle Potenziale der bildenden Kunst zur Entfaltung kommen und eine Hilfe bei der Bewältigung von Leiden, Krisen, Krankheit darstellen. Kunsttherapie zielt darauf ab, die schöpferischen Kräfte eines Menschen in der therapeutischen Begegnung zu (re-)aktivieren – zur Stärkung von Selbstheilungskräften und einer identitätsstiftenden Selbstregulierung. Die ästhetische Produktivität, in unterschiedlichem Material erfahrbar, erweitert die therapeutische Beziehung und enthält Chancen zu Erkenntnisprozessen und Kompetenzgewinn.» (S. 465)
Der gesamtschweizerische Dachverband für Therapien mit künstlerischen Medien, seit Sommer 2016 OdA ARTECURA (ehemals KSKV | CASAT), beschreibt die Kunsttherapie als eine Methode, welche die von Mechler-Schönach angesprochene Entwicklung und Bereicherung mit den Mitteln der bildenden und der darstellenden Kunst umfasst. Sie schliesst alle Kunstrichtungen oder mit künstlerischen Medien arbeitenden Fachrichtungen ein: die Bewegungs- und Tanztherapie, die Drama- und Sprachtherapie, die Gestaltungs- und Maltherapie sowie die Intermediale Therapie und die Musiktherapie. Gemäss dem OdA ARTECURA hat die Kunsttherapie zum Ziel:
«Kunsttherapie aller Fachrichtungen stützt sich auf humanistische, medizinische, künstlerische, psychologische und anthroposophische Konzepte und Menschenbilder. Ihnen gemeinsam ist die Integration einer somatischen, psychischen, spirituellen und sozialen Dimension bei der Klientenbeurteilung und Therapiefindung. […]
Ziel kunsttherapeutischen Handels ist die Stärkung der Fähigkeiten zur Selbstregulation auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene. Kunsttherapie aktiviert Selbstheilungskräfte und unterstützt persönliche Entwicklungsprozesse. Sie sensibilisiert und fördert die Wahrnehmung innerer und äusserer Vorgänge und die Kreativität.
Kunsttherapeutische Interventionen verhelfen zu Einsichten und erweitern die Kenntnis der eigenen Ressourcen und der Wirkung auf andere Menschen. Der Transfer kunsttherapeutischer Erfahrungen in den Alltag ist ein zentrales Anliegen.» (OdA ARTECURA, 2016)
Ganz schön viele Beschreibungen für eine Therapieform, die nach wie vor sehr vielen Menschen unbekannt ist, oder? Lassen Sie uns das Thema darum herunterbrechen.
Stark vereinfacht ausgedrückt, ist die Kunsttherapie eine mehrdimensionale, vielschichtig arbeitende und wirkende therapeutische Arbeitsform. Sie gehört zu den triadischen Therapieformen. Dies bedeutet, sie bezieht das künstlerische Bild oder Objekt in die gemeinsame Arbeit mit dem Klienten ein und macht es zu einem unterstützenden dritten Partner. Hierzu nutzt die Kunsttherapie zusätzliche Mittel (z.B. Farben, Ton, Naturmaterialien etc.). Damit unterscheidet sie sich von klassischeren, dyadischen Therapien, in denen die Interaktion primär zwischen Klient und Therapeut stattfindet.
Zudem, und hier folgen wir den Definitionen von Mechler-Schönach und Co., ist die Kunsttherapie aus Sicht der Klienten hochgradig eigendynamisch und selbstbestimmt. Unserer Meinung nach steht allen Menschen zu jeder Zeit ein riesiger Topf ihrer vergangenen, aktuellen und zukünftigen Gefühle, Gedanken und Erfahrungen zur Verfügung. Schöpfen sie aus diesem, überschreiten sie die Grenzen des scheinbar Machbaren. Sie nehmen alle Arten von Denk- und Handlungsmodellen an oder adaptieren sie so, dass sie sich für ihre momentane Lebenssituation als optimal erweisen. Im Grunde müssten wir unserer Kurzdefinition somit das Adjektiv systemisch hinzufügen, da wir unsere Art der kunsttherapeutischen Arbeit mit den Grundsätzen der Systemik verknüpfen.
Systemische Kunsttherapie
Das systemische Denken wird schon länger in die Kunsttherapie einbezogen. Vor allem Gisela Schmeer und Gertaud Schottenloher waren in diesem Bereich wahre Vorreiterinnen. Beide Frauen publizierten bereits in den 1980er und 1990er Jahren diverse Fachartikel über psychodynamische und psychoanalytisch-systemische Ansätze in der Kunsttherapie. – Doch wie passen die Begriffe Systemik und Kunsttherapie überhaupt zusammen?
Konstruktivismus
Die systemische Kunsttherapie basiert auf einem konstruktivistischen Weltbild. Laut Heinz von Foerster (1992) lässt sich ein konstruktivistisch denkender Mensch wie folgt erkennen:
«Fragen Sie einen Menschen, ob die folgenden Begriffe Entdeckungen oder Erfindungen sind:
Ordnung
Zahlen
Formeln
Symmetrien
Naturgesetze
Gegenstände
Taxonomien
usw.
Neigt er dazu, diese Begriffe als Erfindungen zu bezeichnen, so haben Sie es mit einem Konstruktivisten zu tun.» (S. 45)
Der bekannte Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick liefert ein wertvolles, praktisches Beispiel wie sich eine konstruktivistische Sichtweise im Alltag zeigt:
«Am Ende einer erfolgreichen Kurzbehandlung umreisst die Patientin, eine junge Frau, die grundsätzliche Änderung in der konfliktreichen Beziehung zu ihrer Mutter mit den Worten: ‹So wie ich die Lage sah, war es ein Problem; nun sehe ich sie anders, und es ist kein Problem mehr.› Von dieser Äusserung liesse sich einerseits sagen, dass sie die Quintessenz therapeutischen Wandels darstellt; andererseits könnte man sehr wohl einwenden, dass sich nichts ‹wirklich› verändert habe – ausser bestenfalls etwas so Subjektives wie eine ‹Ansicht› oder eine ‹Einschätzung›.» (Watzlawick, 1992, S. 89)
Beide Beschreibungen zeigen, dass ein konstruktivistisch denkender Mensch seine Wirklichkeit konstruiert. Er nimmt Anpassungen vor, wenn eine Fehlermeldung auftaucht oder ein neuer Weg verlangt wird. Dabei geht es weniger darum, ob diese Veränderung reell oder tatsächlich eingetreten ist, sondern um die innere Haltung. Das Innenleben passt sich dem Aussenleben an – und umgekehrt.
Fürstenau (2002) beschreibt dieses Phänomen als beidäugiges Sehen, da jedes Thema ein Problem und gleichzeitig eine Ressource beinhaltet. Diese Einstellung findet sich auch in der Psychoanalyse nach Carl Gustav Jung wieder. Seine Erkenntnisse sind in vielerlei Hinsicht die Basis des heutigen mal- und gestaltungstherapeutischen Schaffens.
Mal- und Gestaltungstherapie auf den Grundlagen der Analytischen Psychologie von C.G.Jung
In der systemischen Psychotherapie, und vor allem in der Mal- und Gestaltungstherapie auf den Grundlagen der Analytischen Psychologie nach Carl Gustav Jung, ist der Konstruktivismus zentral. Gerade weil «wir in tausend Verkleidungen uns selber auf dem Pfade des Lebens immer wieder begegnen» (Jung in Kast, 2014, S. 73), sehen Jungianer ihre Aufgabe darin, Menschen bei der Individuation (= Ganzwerdung) zu begleiten. Das heisst, sie wollen das in anderen keimen, reifen und erblühen lassen, was tief in ihrem Inneren als Schatz verborgen liegt. Hierzu nutzen sie alles, was sich ihnen bietet: Unbewusstes, Träume, Fantasien, Symbole, Mandalas, alchemistische Texte, Märchen und so weiter. Die bekannte Jungianerin Verena Kast (2014) sagt dazu:
«Wenn ein eignes Problem etwa mit der Darstellung und der Lösung eines ähnlichen Problems in einem Märchen in Verbindung gebracht werden kann, löst das die Idee aus, das eigene Problem könnte auch gelöst werden – ein Annäherungs-Priming1 findet statt: Man wendet sich nicht vom eigenen Problem ab, sondern diesem zu.» (S. 91)
Diese Erkenntnisse finden sich auch in Jungs Aussagen zu den Archetypen, der Synchronizität und so weiter wieder, die auf den Erfahrungen des von Jung beschriebenen und wissenschaftlich anerkannten kollektiven Unbewussten basieren. Letzteres kann als ein unsichtbares und unfassbares Netz bezeichnet werden, das in allen Menschen angelegt ist und diese vereint. Ohne zu tief in die Thematik einzusteigen, möchten wir verdeutlichen, was damit gemeint ist.
Anima und Animus
Widmen wir uns zunächst den von Jung beschriebenen Archetypen Anima und Animus. Sie gelten als zwei im kollektiven Unbewussten verankerte und von persönlichen Erfahrungen autonome Urbilder.
Gemäss Jung vereint jeder Mensch Anima und Animus in sich. Die Natur und das persönliche Umfeld beeinflussen, wie sich diese individuell ausprägen und im Alltag sichtbar werden. Ein sehr eindrückliches Beispiel für die Tragweite von Anima und Animus sind Sätze wie «Buben weinen nicht», «Nur Mädchen spielen mit Puppen» oder «Männer sind die Versorger, Frauen gehören an den Herd». Die kennen Sie, oder? Doch wussten Sie, dass sie grösstenteils das Resultat der Unterdrückung der Anima-Seiten im Mann und der Animus-Seiten in der Frau sind? Und verstehen Sie nun, warum sie sich schon so lange in den Köpfen der Menschen, dem kollektiven Unbewussten, halten? Super! Denn ja, Sie vermuten richtig: Nur das Ausleben und Zusammenwirken der männlichen und weiblichen Wesensanteile führt zur von Jung beschriebenen Individuation. Entsprechend sind Männer gefordert, auch (!) ihre weibliche, verletzliche Seite und Frauen, ihre männliche Durchsetzungs- und Tatkraft zu entwickeln und zu leben.
Synchronizität
Das von Jung thematisierte Synchronizitätsprinzip basiert ebenfalls auf den Grundlagen des kollektiven Unbewussten. Es bezeichnet das Aufeinandertreffen von zwei oder mehr Ereignissen, die einzig durch die Gleichzeitigkeit miteinander verbunden sind und keine alternative oder ursächliche Erklärung zulassen (Vogel, 2008). Gerne geben wir Ihnen ein Bespiel. Stellen Sie sich vor, Sie denken an Ihren Liebsten und greifen zum Telefon. In diesem Moment beginnt es zu klingeln. Sie schauen auf das Display und sehen den Namen Ihres Partners. Das bedeutet, es hat ein gleichzeitiges Erleben und Handeln stattgefunden, ohne dass konkrete Abmachungen oder plausible Erklärungen zu Grunde gelegt werden können. – Genau das beschreibt das Synchronizitätsprinzip.
Jungs Erkenntnisse in der Praxis
Insbesondere in der Psychoanalyse, aber ebenso in zahlreichen Feldern der Kunsttherapie bilden Jungs Erkenntnisse bis heute die theoretische und praktische Grundlage. Neben dem Rollenspiel sowie der Arbeit mit Märchen und Symbolen dienen Kunsttherapeuten vor allem die Traumarbeit und die aktive Imagination als wertvolle Werkzeuge der Selbsterfahrung. Auch im Prozessorientierten Malen und Gestalten nehmen sie einen hohen Stellenwert ein. Immer wieder orientieren wir uns an Jungs Gedankengut. Zwar nutzen wir in unserer Arbeit erkenntnisleitende Beurteilungskriterien zur Unterstützung unserer Klienten. Die eigentlichen therapeutischen Methoden passen wir jedoch stets an ihre jeweiligen Bedürfnisse an. Hierzu dient uns alles, was unseren Klienten und uns an Ausdrucksmitteln zur Verfügung steht. – Aber was ist nun die (systemische) Kunsttherapie?
Kunsttherapie auf den Punkt gebracht
Um die (systemische) Kunsttherapie kurz und bündig zusammenzufassen, bedienen wir uns der Definition des Instituts für Kunst und Therapie München (IKT), das unter der Leitung von Prof. Dr. Gertraud Schottenloher steht. Sie und ihr Team haben sehr treffende Worte für das gefunden, was wir als den Kern unserer Arbeit betrachten.
«In der [systemischen] Kunsttherapie stehen die gesunden Ich-Anteile der Klienten und Patienten im Vordergrund. Der Therapeut unterstützt diese im aktiv-bildnerischen Prozess. Nicht der Mangel, nicht die Krankheit steht im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit, sondern die kreativen Fähigkeiten, die es dem Menschen ermöglichen, eigenverantwortlich und autonom seine Ideen darzustellen. So findet der Gestaltende einen neuen Zugang zu sich selbst und seinen Möglichkeiten. Er findet neue Verarbeitungs- und Ausdrucksformen, die ihn nicht stigmatisieren, sondern seine Problematik oder Krise in ihrem schöpferischen Potenzial sichtbar werden lassen. Gleichzeitig tritt er durch die bildnerische Arbeit aus seiner Isolierung heraus. Er kommt in Kontakt mit Betrachtern und auch mit seiner eigenen Geschichte, die ebenso Teil der Bilder ist wie die Gegenwart. Das Selbstvertrauen wächst. Unsagbares kann ausgedrückt werden und damit seine krankmachende Wirkung verlieren. Was in der bildnerischen Arbeit an Ausdauer, Einfühlung, Vertrauen, Einsicht, Gefühl für Kompetenz, Neugierde, Unternehmungsgeist etc. entwickelt wird, lässt sich in das Alltagsleben übertragen.» (IKT, online)
Die systemische Kunsttherapie ermöglicht es den Klienten also, Unverhofftes / Unerklärliches in einem sehr persönlichen Rahmen und mithilfe einer individuell gefundenen Gestaltungssprache aufzuarbeiten. Gemäss Schmeer (1994) können die dabei entstehenden Bildelemente in einer klaren, rätselhaften oder zunächst völlig bedeutungslos scheinenden Verbindung zueinander stehen. Erst wenn sie in einen Kontext oder Dialog miteinander gebracht werden, lassen sich Schlüsse über die Lebenssituation und die Blockaden des Malenden ziehen. Das heisst, der Prozess steht im Vordergrund. Er ist der Entwicklungshelfer des Inhalts, des Problems und der Ressourcen. Genau deshalb beschreiben wir unsere spezifische, eigens entwickelte Arbeitsmethode als Prozessorientiertes Therapeutisches Malen und Gestalten.
Prozessorientiertes Therapeutisches Malen und Gestalten
Wie Sie bereits wissen, geht die Systemik davon aus, dass jeder Mensch alle Arten von Denk- und Handlungsmodellen annehmen oder adaptieren kann, die sich für seine momentane Lebenssituation als optimal erweisen. Hierzu brauchen wir andere, die unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten spiegeln. Nur so erkennen und finden wir uns selbst. Nur so treten wir in Resonanz mit anderen. Nur so können Raum und Zeit zu einem grossen Ganzen verschmelzen, und nur so können gleichzeitig zwei oder mehr Ereignisse eintreten.
Sie können sich diese Vorgänge als ein Mobile oder ein Windspiel vorstellen. Alles steht mit allem in Verbindung, weshalb ein simpler Impuls, ein kurzer Anstoss oder ein leiser Luftzug ausreichen, die Einzelteile in Bewegung zu setzen. Johann Wolfgang von Goethes drückt dies in seinem Gedicht Epirrhema wie folgt aus:
«Nichts ist drinnen, nichts ist draussen; denn was innen, das ist aussen.»
(Goethe in Eibl, 1988, S. 498)
Diese zwölf Worte sind die Essenz des prozessorientierten, therapeutischen Malens und Gestaltens. Stark verallgemeinert und auf die Kunsttherapie übertragen besagen sie, dass die PTM-Methode die Klienten dazu auffordert, ihr Inneres im Aussen als Bild oder Objekt darzustellen und es danach so zu verändern, dass eine Weiterentwicklung der Einstellung und des Verhaltens möglich wird. Dazu nutzen wir das Wissen und die Werkzeuge diverser Disziplinen.
Grundlagen des PTM
Sämtliche PTM-Grundlagen und -Werkzeuge basieren auf interdisziplinären, wissenschaftlich erprobten Erkenntnissen. Sie stammen aus der Kunst- und Maltherapie, der Farb- und Gestalttherapie, der Psycho- und Gesprächstherapie, den Naturwissenschaften sowie einer Vielzahl weiterer östlicher und westlicher Konzepte. Im Verlaufe des Buches werden wir darauf verweisen, damit Sie konkrete Einblicke in unser theoretisches und praktisches Fachwissen erhalten.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es beim PTM – analog zu anderen Therapieformen – darum geht, einen Menschen in seiner momentanen Situation zu begleiten. Der Prozess am Bild / Objekt steht im Zentrum. Er ist Angebot und Ausdrucksmittel zugleich. Dabei ist es nebensächlich, ob ein Klient ein schönes Bild oder Objekt gestaltet. Viel wichtiger ist es uns, einen Ausdruckskanal zu aktivieren, den der Klient nur bedingt über das kognitive Wissen kontrollieren kann. Dadurch offenbart er uns ein umfassendes und authentisches Abbild seines Gefühlszustandes und erlaubt uns einen Blick auf das Spiegelbild seiner Seele. Hier erkennen wir oft mehr, als der Klient meint, denn erfahrungsgemäss vereinigen sich in jedem Bild / Objekt bewusste und unbewusste Anteile. Dieser Vorgang ist mit dem Versenden einer Postkarte zu vergleichen.
Die zwei Fundamente des PTM
Stellen Sie sich vor, Sie erhalten eine Postkarte von einem fremden Menschen. Worauf achten Sie, um herauszufinden, wer die Person ist und wo sie sich aktuell befindet? Auf den Poststempel? Auf den Grusstext? Auf die Unterschrift? Oder alles zusammen?
Sinnbildlich durchleben wir genau diese Situation, wenn wir mit unseren Klienten arbeiten. Ihr initiales Bild oder Objekt ist die Postkarte. Es liefert uns erste Hinweise, wer unsere Klienten sind und an welchem Platz sie sich in ihrem Leben befinden. Doch erst durch den Austausch mit ihnen erfahren wir mehr und können das eigentliche, oft versteckte Thema mit ihnen erarbeiten.
Sind diese Punkte klar, leiten wir in einem zweiten Schritt gemeinsam mit den Klienten weiterführende Prozesse ein. Dann verändern die Klienten ihre Postkarte so, dass eine neue, stimmigere Karte entsteht, die sie in ihrer momentanen Lebenssituation nachhaltig stärkt.
Kurzum, die PTM-Methode fusst auf zwei Fundamenten:
das Innere im Äusseren abbilden, und
das Innere über das Äussere so verändern, dass es stimmig wird.
Diese Fundamente spiegeln den Kern der PTM-Arbeit wider: «Nichts ist drinnen, nichts ist draussen, denn was innen, das ist aussen.» Sie erklären gleichzeitig, weshalb therapeutisch begleitete Veränderungen überhaupt stattfinden können.
Machen Sie sich hierzu bewusst, dass niemand einfach so in das Innere eines Menschen hineinsehen kann. Dazu bedarf es der Person selbst und eines von ihm gestalteten Platzes im Aussen. Nur wenn der Klient diesen mit uns teilt, kann in ihm ein Nährboden für seinen innerlichen Wandel entstehen. Erst dann ist die Voraussetzung gegeben, dass eine Veränderung des Aussen von seinem Inneren an- und aufgenommen werden kann. Dieser Ablauf ist, wie in Kapitel 1 erwähnt, mit der Bewegung eines Pendels vergleichbar. Es schwingt so lange, bis es seine Mitte gefunden hat. Deshalb benötigen manche Klienten auch mehrmalige Anpassungen ihres «Aussenplatzes», bevor eine längerfristige Verbesserung eintritt.





























