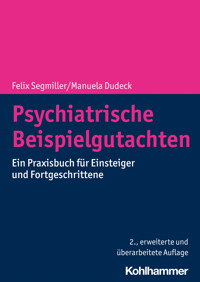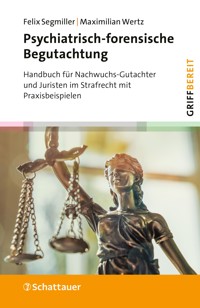
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: griffbereit
- Sprache: Deutsch
Forensik und Strafrecht für Einsteiger Kompakt: Hoher Praxisbezug, überschaubarer Umfang, erschwinglicher Preis Fokussiert: Grundlagen der Begutachtung und Vertiefung ins Strafrecht Grundlegend: Perfekter Berufseinstieg in Forensik, Strafrecht und Psychiatrie Sie sind Psychiater und erhalten den Auftrag für ein forensisch-psychiatrisches Gutachten? Ihnen wurde als Staatsanwältin ein Fall zugeteilt, bei dem Zweifel an der Schuldfähigkeit des Beschuldigten aufkommen? Dieses strukturierte Nachschlagewerk erläutert überblicksartig und prägnant die forensisch-psychiatrische Begutachtungspraxis und richtet sich sowohl an Nachwuchs-Gutachter als auch Juristen im Strafrecht. Das interdisziplinäre Handbuch liefert zudem praxisnahe Ratschläge für den Umgang mit eigenen Gutachten anhand von realen Praxisbeispielen zu Fragen der Schuldfähigkeit oder der Kriminalprognose. Die Autoren beschreiben wichtige Grundlagen, praxisnahe Herausforderungen und Fallstricke insbesondere für Einsteiger. Mit Textbausteinen aus Beispielgutachten, Literaturtipps und weiterem nützlichen Onlinematerial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Felix Segmiller | Maximilian Wertz
Psychiatrisch-forensische Begutachtung
Handbuch für Nachwuchs-Gutachter und Juristen im Strafrecht mit Praxisbeispielen
Schattauer
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs
Schattauer
www.schattauer.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Gestaltungskonzept: Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von © iStock/audioundwerbung
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Marion Drachsel
Projektmanagement: Ulrike Albrecht
ISBN 978-3-608-40197-4
E-Book ISBN 978-3-608-12431-6
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20711-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Danksagung
Einleitung
1 Die forensische Psychiatrie
1.1 Womit beschäftigt sich die forensische Psychiatrie?
1.2 Woher kommt der Begriff »forensisch«?
1.3 Welche Stellung nimmt die psychiatrisch-forensische Begutachtung ein?
1.4 Aus welchen Rechtsgebieten ergeben sich psychiatrisch-forensische Begutachtungsaufträge?
1.5 Mit welchen konkreten Fragestellungen befasst sich die psychiatrisch-forensische Begutachtung?
Weiterführende Literaturempfehlungen
2 Psychiatrisch-forensische Begutachtung
2.1 Welche Stellung hat die psychiatrisch-forensische Begutachtung im Strafrecht?
2.1.1 Wann muss und kann im Strafrecht ein Sachverständiger hinzugezogen werden?
2.1.2 Wie und durch wen erfolgt die Auswahl des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen?
2.1.3 Was sind typische strafrechtsrelevante Fragestellungen?
2.1.4 Was sind Aufgaben und Anforderungen eines psychiatrisch-forensischen Gutachtens?
2.1.5 Wie ist die Abgrenzung zu einer Stellungnahme bzw. Beurteilung?
2.1.6 Wie ist die Stellung eines psychiatrischen Sachverständigen?
Weiterführende Literaturempfehlungen
2.2 Was sind die Prinzipien einer psychiatrisch-forensischen Begutachtung?
2.2.1 Gilt die ärztliche Verschwiegenheitspflicht auch bei Begutachtungen?
2.2.2 Ist die zu begutachtende Person ein Proband oder ein Patient?
2.2.3 Worüber muss ich Probanden vor einer Begutachtung aufklären?
2.2.4 Worin unterscheidet sich der juristische vom medizinischen Krankheitsbegriff?
2.2.5 Bin ich als Sachverständiger gleichzeitig auch Zeuge?
2.2.6 In welcher Form hafte ich als psychiatrisch-forensischer Sachverständiger?
2.2.7 Kann ich ein Gutachten ablehnen bzw. zurückgeben?
Weiterführende Literaturempfehlungen
2.3 Welche Kompetenzen muss ich als Sachverständiger mitbringen?
2.3.1 Was muss ich als Sachverständiger für Qualifikationen mitbringen?
2.3.2 Welche Paragrafen muss ich als Sachverständiger kennen?
2.3.3 Kann man auch als Psychologe strafrechtsrelevante Gutachten erstatten?
Weiterführende Literaturempfehlungen
2.4 Wie läuft eine psychiatrisch-forensische Begutachtung ab?
2.4.1 Was ist vor Annahme eines Gutachtenauftrags zu beachten?
2.4.2 Wie läuft die Auftragsstellung ab?
2.4.3 Wie läuft die Auftragsannahme ab?
2.4.4 Sollte ich Privatgutachten annehmen?
2.4.5 Welche Akteninhalte sind für mich relevant?
2.4.6 Kann ich über die Aktenlage hinausgehende Informationsquellen heranziehen?
2.4.7 Wie sehen die Durchführungsbedingungen aus?
2.4.8 Welche Befunde sollten bei einer Begutachtung erhoben werden?
2.4.9 Darf ich fremdanamnestische Informationen bzw. Zusatzinformationen einholen?
2.4.10 Welche weiteren Zusatzuntersuchungen können relevant sein?
2.4.11 Wann sind testpsychologische Untersuchungen sinnvoll?
2.4.12 Was passiert, wenn der Proband die Begutachtung verweigert oder abbricht?
2.4.13 Was mache ich, wenn der Proband kein Deutsch spricht?
2.4.14 Was ist bei der Begutachtung von Jugendlichen/Heranwachsenden zu berücksichtigen?
2.4.15 Informiere ich den Probanden über das Gutachtenergebnis?
Weiterführende Literaturempfehlungen
2.5 Wie ist ein schriftliches psychiatrisch-forensisches Gutachten aufgebaut?
2.5.1 Welche Informationen beinhalten die ersten Seiten eines Gutachtens?
2.5.2 Wie werden die relevanten Akteninformationen dargestellt?
2.5.3 Wie werden die eigenen Angaben des Probanden dargestellt?
2.5.4 Wie werden die Untersuchungsbefunde dargestellt?
2.5.5 Wie werden zusätzliche Untersuchungsbefunde dargestellt?
2.5.6 Wie werden die Untersuchungsbefunde zusammengefasst?
2.5.7 Wie werden die Untersuchungsbefunde beurteilt?
2.5.8 Wie werden die konkreten Fragestellungen des Auftraggebers beantwortet?
Weiterführende Literaturempfehlungen
2.6 Wie geht es nach dem schriftlichen Gutachten weiter?
2.6.1 Wie verhalte ich mich adäquat vor Gericht?
2.6.2 Wie läuft eine mündliche Erstattung vor Gericht ab?
2.6.3 Wie läuft die anschließende Befragung des Sachverständigen ab?
2.6.4 Wie werden psychiatrisch-forensische Gutachten abgerechnet?
Weiterführende Literaturempfehlungen
3 Strafrechtsrelevante Begutachtung – Allgemeiner Teil
3.1 Was sind strafrechtsrelevante Fragestellungen?
Weiterführende Literaturempfehlungen
3.2 Wie beurteile ich die Schuldfähigkeit nach §§ 20, 21 StGB?
3.2.1 Was ist Einsichtsfähigkeit?
3.2.2 Was ist Steuerungsfähigkeit?
3.2.3 Was sind Eingangsmerkmale?
3.2.4 Was sind Maßregeln der Besserung und Sicherung?
3.2.5 Was bedeutet Unterbringung nach § 63 StGB und was sind die Voraussetzungen?
3.2.6 Was bedeutet Unterbringung nach § 64 StGB und was sind die Voraussetzungen?
3.2.7 Was versteht man unter der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO?
Weiterführende Literaturempfehlungen
3.3 Was umfasst eine kriminalprognostische Beurteilung?
3.3.1 Wie beurteile ich die Frage nach der Sicherungsverwahrung gemäß § 66 StGB?
3.3.2 Wie beurteile ich die Fortdauer und Aussetzung der Unterbringung nach § 67 StGB?
Weiterführende Literaturempfehlungen
3.4 Weitere strafrechtsrelevante Fragestellungen?
3.4.1 Was bedeutet Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen?
3.4.2 Was umfasst die Reifebeurteilung?
3.4.3 Was bedeutet Verhandlungsfähigkeit?
3.4.4 Was bedeutet Haftfähigkeit?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4 Strafrechtsrelevante Begutachtung – Spezieller Teil
4.1 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei organischen Störungen?
4.1.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.1.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.1.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.2 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei Suchterkrankungen und Intoxikationen?
4.2.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.2.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.2.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.3 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei schizophreniformen und wahnhaften Störungen?
4.3.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.3.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.3.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.4 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei affektiven Erkrankungen?
4.4.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.4.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.4.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.5 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei neurotischen und Belastungsstörungen?
4.5.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.5.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.5.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.6 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen?
4.6.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.6.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.6.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.7 Wie begutachtet man die Schuldfähigkeit bei Intelligenzminderungen, Entwicklungsstörungen und hyperkinetischen Störungen?
4.7.1 Welches Eingangsmerkmal?
4.7.2 Wie bewertet man hier die Fragen nach Einsichts- und Steuerungsfähigkeit?
4.7.3 Wie/wann ist eine potenzielle Unterbringung zu diskutieren?
Weiterführende Literaturempfehlungen
4.8 Sonderfall »Affekttat« – wie bewerten?
Weiterführende Literaturempfehlungen
5 Tipps für den Praxiseinstieg
5.1 Wie bilde ich mich im psychiatrisch-forensischen Begutachtungskontext fort?
5.1.1 Welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
5.1.2 Welche Mindestanforderungen sind bei strafrechtsrelevanten Begutachtungen zu berücksichtigen?
5.2 Wie gehe ich mit Medien und der Öffentlichkeit um?
5.3 Welche Fehler werden bei Begutachtungen häufig gemacht?
5.4 Was ändert sich mit der ICD-11?
Weiterführende Literaturempfehlungen
Weiterführende Internetquellen
Nachwort
Literatur
Paragrafenverzeichnis
Sachverzeichnis
Vorwort
Vor vielen Jahren bekam ich im Rahmen meiner Assistenzarzttätigkeit am psychiatrischen Universitätsklinikum der Ludwig-Maximilians-Universität von der Abteilung für Forensische Psychiatrie mein erstes forensisch-psychiatrisches Gutachten zugeteilt. Überrascht und überfordert von dem Aktenberg in meinem Fach begann ich, die ersten Seiten und den Gutachtenauftrag durchzublättern. Sofort schossen mir viele Fragen in den Kopf: Worum geht es eigentlich genau? Was ist die konkrete Fragestellung an mich? Habe ich nun eigentlich einen Patienten, einen Probanden oder einen Klienten1? Gilt überhaupt die ärztliche Verschwiegenheitspflicht? Was darf ich und was muss ich berücksichtigen? Und wie sieht denn so ein schriftliches Gutachten überhaupt aus? Ein erster hektischer Blick in die mehrhundertseitigen Lehrbücher zur Forensischen Psychiatrie schreckten mich erst einmal ab.
Dr. med. Felix Segmiller
Bereits im Rahmen meines Psychologiestudiums interessierte ich mich für rechtspsychologische Inhalte und lernte im Rahmen diverser Praktika nicht nur den Justizvollzugs- sowie Maßregelvollzugsalltag kennen, sondern erhielt auch einen ersten Einblick in die forensisch-psychiatrische Begutachtungspraxis. Nach dem Studienabschluss wollte ich mein Wissen begleitend zur Promotion zunächst an der Abteilung für Forensische Psychiatrie der Universität Regensburg und schließlich am Münchner Universitätsklinikum vertiefen und mein erstes eigenes Gutachten unter Supervision erstellen. Zeitnah kam die erste Anfrage für ein testpsychologisches Gutachten. Zügig suchte ich meine Unterlagen aus dem Studium zusammen, auch die gängigen Lehrbücher sammelten sich auf meinem Schreibtisch. Doch womit anfangen? Was aus den Akten ist für mich wichtig? Einen Untersuchungsplan brauche ich auch noch.
Dr. phil. Maximilian Wertz
Als frisch gebackener Staatsanwalt bekam ich es bereits nach wenigen Wochen zum ersten Mal mit einem mutmaßlichen Täter mit psychischen Auffälligkeiten zu tun: einem jungen Beschuldigten, der nicht nur eine ganze Serie von Kellereinbruchsdiebstählen begangen, sondern auch in der niedrigschwelligen Jugendpension, in der er gelegentlich übernachtete, wild randaliert und dabei einen Feuerlöscher ausgeleert hatte; zudem hatte er offenbar willkürlich und ohne nachvollziehbaren Grund Passanten auf offener Straße angegriffen. Nachdem ich einen Haftbefehl gegen den jungen Mann erwirkt hatte, meldete sich schon bald die JVA mit dem Hinweis, dass sich der Beschuldigte psychisch auffällig verhalte. Das war eine Information, mit der ich zunächst wenig anfangen konnte. Gute vier Jahre Studium, einige Jahre an einem strafrechtlichen Lehrstuhl und zwei Jahre Referendariat hatten mich zwar materiell-rechtlich und prozessual soweit einigermaßen geschult und ich konnte immer noch fünf verschiedene Theorien zur Behandlung des Erlaubnistatbestandsirrtums auswendig runterrattern, aber außer der vagen (und wie ich dann bald lernte: grob falschen) Formel: »Ab 3 Promille ist man schuldunfähig, bei Tötungsdelikten 3,3 Promille wegen der erhöhten Hemmschwelle«, hatte ich über Schuld(un)fähigkeit noch nicht viel gelernt. Auch die Ausgestaltung der Maßregeln der Besserung und Sicherung der (1)§§ 63 f. StGB hatten in meiner Ausbildung keine Rolle gespielt. Zumindest so viel hatte ich aber gelernt: Wenn ich keine Ahnung habe, muss ich halt nachfragen. Und so führte ich ein längeres Gespräch mit einem Psychiater in der JVA, der dringend anregte, den Beschuldigten psychiatrisch zu begutachten. Er könne mir auch ein vorläufiges Gutachten »zur Frage des (1)§ 126a« schreiben. Aus seiner Sicht müsse der Beschuldigte nämlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Unauffällig blätterte ich während des Gesprächs in meinem Gesetz und entdeckte eine weitere Vorschrift, die mir zuvor noch nie begegnet war. Nach kurzer Rücksprache mit Kollegen erteilte ich den Gutachtensauftrag und beantragte kurz darauf meinen ersten Unterbringungsbefehl. Bis zur Erstellung der Antragsschrift hatte ich mir mit einer recht wilden Mischung aus Tipps von erfahreneren Kollegen, Kommentierungen der einschlägigen Vorschriften und Aufsätzen ein Grundwissen angeeignet, mit dem ich mich dann auch in die Hauptverhandlung traute. Zu einer ernsthaften und kritischen Überprüfung des schriftlichen Sachverständigengutachtens reichte das damals aber noch nicht. Zu meinem Glück waren sowohl der Gutachter als auch die erkennenden Richter sehr erfahren. Dennoch weiß ich noch gut, dass ich bei aller Überzeugung von der Richtigkeit meiner Ausführungen doch ein recht mulmiges Gefühl hatte, als ich abschließend den Antrag stellte, den Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. »Die grundsätzlich unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß (2)§ 63 StGB ist eine außerordentlich belastende Maßnahme, die einen besonders gravierenden Eingriff in die Rechte des Betroffenen darstellt« – so der BGH in ständiger Rechtsprechung. Im Laufe der Zeit hat mich das Thema der forensischen Psychiatrie nicht mehr losgelassen und in all meinen bisherigen Funktionen in der Justiz eine bedeutende Rolle gespielt. Gerade mit der heutigen Perspektive bin ich allerdings immer wieder über die – fragwürdige – Qualität mancher Gutachten erschrocken und stelle zudem fest, dass die heutigen Dienstanfänger auch nicht mehr über die Materie wissen als ich damals.
Dr. jur. Laurent Lafleur, Pressesprecher und Leiter der Pressestelle sowie Richter am Oberlandesgericht München
Auch wenn wir – ebenso wie der hochgeschätzte Kollege Herr Dr. Lafleur – mittlerweile erfahren(er) sind und die forensisch-psychiatrische Begutachtung Routine in unserem Berufsalltag darstellt, können wir uns gut an die oben dargestellten Situationen und die Überforderung erinnern, die damals damit einherging. Im Rahmen unserer Autorentätigkeit zum Zwecke des Beitrags zur Qualitätssicherung in der forensischen Psychiatrie entstand so unter anderem die Idee, ein strukturiertes Nachschlagewerk zur Klärung initial aufkommender Fragen von angehenden oder frisch tätigen Psychiaterinnen und Psychiater, Psychologinnen und Psychologen sowie auch Juristinnen und Juristen zu erstellen. Aus dem Projekt entstand schließlich das vorliegende interdisziplinäre Handbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene im forensisch-psychiatrischen Berufskontext.
Dieses Praxisbuch adressiert insbesondere Nachwuchs-Gutachter und -Juristen (im Strafrecht) und erläutert überblicksartig und prägnant die psychiatrisch-forensische Begutachtungspraxis im Allgemeinen. Es zielt auf die Wissensvermittlung für Einsteiger verschiedener Disziplinen ab und dient als strukturiertes Handbuch in der Praxis/für Praktiker. Darüber hinaus werden praxisnahe Ratschläge geboten. Es kann und soll kein Lehrbuch über forensische Psychiatrie bzw. psychiatrische Begutachtung ersetzen. Dennoch stellt es aus Sicht der Autoren ein Überblick vermittelndes Nachschlagewerk für den Einstieg und zur Vertiefung dar, sozusagen ganz im Sinne der Verlagsreihe »griffbereit« für den Nachwuchs-Gutachter oder -Juristen. Anhand der Veranschaulichung der Inhalte an Praxisbeispielen soll die fachliche Weiterentwicklung ebenso einprägsam wie kurzweilig gelingen.
Dieses Handbuch wurde in erster Linie so gestaltet, dass insbesondere unerfahrene Psychiater, Psychologen und Juristen von diesem profitieren und es gewinnbringend einsetzen können, was durch das übersichtliche Frage-Antwort-Format unterstützt wurde. Aber auch Fortgeschrittene können ihr Wissen vertiefen oder es anhand der spezifischen Kapitel besser strukturieren. Zudem werden Ratschläge für die Begutachtungspraxis sowie konkrete Beispiele samt Musterformulierungen und -vorlagen anhand von Auszügen aus Gutachten angeboten. Im Anschluss an jedes Kapitel sind zudem jeweils weiterführende Literaturempfehlungen zu finden, die auf die einschlägigen Lehrbücher und relevanten Veröffentlichungen zu den entsprechenden Inhalten der einzelnen Kapitel hinweisen und es dem Leser so ermöglichen, das Wissen themenspezifisch zu erweitern. Neben diesem »Service« der konkreten Literaturvorschläge zu jedem Kapitel befindet sich am Ende des Buches ein Gesamtliteraturverzeichnis, in welchem nochmals alle zitierten Referenzen des Handbuchs vorzufinden sind.
Das Buch ist so aufgebaut, dass es zunächst für den Einsteiger allgemeingültige Informationen über die Disziplin der forensischen Psychiatrie sowie den Inhalt und den Ablauf einer psychiatrisch-forensischen Begutachtung an sich liefert. Zudem werden Aufbau und Struktur des schriftlichen Gutachtens dargestellt. Im Folgenden wird spezifisch auf die strafrechtsrelevante Begutachtung eingegangen, wobei auch hier zunächst allgemein die Grundprinzipien erklärt werden, bevor die Beurteilung konkreter strafrechtsrelevanter Fragestellungen an Sachverständige (Beurteilung der Schuldfähigkeit, Unterbringung im Maßregelvollzug, Kriminalprognose etc.) in Abhängigkeit verschiedener Störungsbilder anhand realer praktischer Fälle mit Auszügen aus Gutachten aufgezeigt wird.
Der Großteil der forensisch-psychiatrischen Lehrbücher ist dergestalt gegliedert, dass im Rahmen der Abhandlung des jeweiligen Krankheitsbildes und dessen strafrechtlicher Bewertung zunächst die Erkrankung beschrieben wird mit z. B. Informationen zu pathogenetischen Erklärungsmodellen, Inzidenzen und Prävalenzen sowie diagnostischen Manualen. Meist wird weiter beschrieben, wie sich die jeweilige Erkrankung am besten therapieren lässt. Sodann folgt im nächsten Schritt die Bewertung dieses Krankheitsbildes im Rahmen einer strafrechtlichen Begutachtung mit Fragen der Zuordnung zum Eingangsmerkmal und potenziellen Auswirkungen auf Einsichts- und Steuerungsfähigkeit.
Das vorliegende Buch lässt bewusst den umfangreichen ersten Bereich des beschriebenen Vorgehens weg: Es beschäftigt sich also nicht mit der Charakteristik und Diagnostizierung der jeweiligen Krankheitsbilder, sondern steigt gleich auf der zweiten Ebene ein, nämlich der gutachterlichen Bewertung der jeweiligen Krankheitsbilder. Dieses Vorgehen wurde bewusst gewählt, um als direkter gutachterlicher Praxisbegleiter zu fungieren.
Zu Ende der ersten drei einführenden Kapitel werden stets die wesentlichsten Inhalte für den Leser in Form von »take-home messages« zusammengefasst. Darauf aufbauend werden konkrete Tipps für den Praxiseinstieg in die Thematik angeboten. Abschließend dient das letzte Kapitel der gebündelten Zusammenfassung und verdichteten Darstellung der wesentlichen Inhalte als finaler Überblick für den Leser.
In diesem Sinne: »Sprich, doch bleibe kurz und klar.« (Dante Alighieri)
Die Kasuistiken, Praxisbeispiele und Gutachtenauszüge erheben insbesondere aufgrund der großen Individualität der zu begutachtenden Fälle nicht den Anspruch von allgemeingültigen Musterbewertungen. Die Heterogenität der Stile von Sachverständigen in der Praxis ließe das auch nicht zu. Es stellt aus Sicht der Autoren aber kein Argument gegen eine Sammlung von Beispielen dar. Den Kasuistiken liegen zwar ähnliche Sachverhalte und Ausarbeitungen wie in bearbeiteten realen Gutachtenaufträgen der beiden Autoren zugrunde, kein einziges Gutachtenbeispiel ist aber kongruent mit einer realen Fallkonstellation. Die Daten sowie enthaltenden Namen von Personen oder Einrichtungen sind stets vollständig anonymisiert, Eckdaten zur Biografie, dem Tatablauf und weitere relevante Sachverhalte zudem stets verfremdet, ohne die Plausibilität der finalen Beurteilung infrage zu stellen. Rückschlüsse auf reale Personen sind somit nicht möglich. Eventuell vermeintliche Ähnlichkeiten zu realen Fällen sind insofern zufälliger Natur.
Felix Segmiller und Maximilian Wertz,
Augsburg und München im Frühjahr 2025
Danksagung
Herzlichen Dank an Dr. Christina Segmiller-Kohler für die gründliche Durchsicht des Manuskripts und die vorgebrachten Anregungen sowie an Dr. Laurent Lafleur für das Einbringen der juristischen Perspektive im Vor- und Nachwort.
Einleitung
Sie erhalten im Rahmen Ihrer psychiatrischen Tätigkeit Ihren ersten Auftrag für ein forensisch-psychiatrisches Schuldfähigkeitsgutachten eines Gerichts und sitzen vor dem Aktenberg auf Ihrem Schreibtisch. – Was nun? Was bedeutet Schuldfähigkeit und was verbirgt sich hinter den Paragrafen (1)20 und (1)21 StGB? Worauf muss ich bei der Erstellung achten? Wie ist so ein Gutachten aufgebaut und was kommt eigentlich nach der schriftlichen Gutachtenerstellung?
Sie sind psychologisch tätig, interessieren sich für die forensische bzw. Rechtspsychologie und möchten gern einen ersten Einblick in die psychologische Begutachtung von Straftäterinnen und Straftätern erhalten. – Was sind typische Fragestellungen? Welche psychischen Störungsbilder erwarten mich? Welche Probleme gibt es beim Einstieg in die Begutachtungspraxis? Wo finde ich Tipps für den Praxiseinstieg? Und wie erhalte ich überhaupt meinen ersten Auftrag?
Ihnen wurde als zuständige Staatsanwältin bzw. zuständiger Staatsanwalt ein neuer Fall zugeteilt, bei dem Ihnen bereits bei der Haftbefehlseröffnung Zweifel an der Schuldfähigkeit der Beschuldigten bzw. des Beschuldigten kommen. Es gibt lebensgeschichtliche Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung und erste Anhaltspunkte, dass diese möglicherweise einen konkreten Einfluss auf die mutmaßliche Tat gehabt haben könnte. – Was nun? In welchen Fällen ist ein psychiatrischer Sachverständiger heranzuziehen? Welche konkreten Fragen sind an diesen zu richten? Und wen beauftrage ich womit?
Diese drei Fallkonstellationen sind typische Beispiele für Berufsgruppen unterschiedlicher Disziplinen, die sich im strafrechtlichen Berufskontext erstmalig mit der Beauftragung und Durchführung forensisch-psychiatrischer Begutachtungen auseinandersetzen. Um diesen den Einstieg in die Begutachtungspraxis zu erleichtern, wurde dieses Handbuch geschrieben. Es soll als strukturiertes Nachschlagewerk zur Klärung initial aufkommender Fragen in der Praxis/für Praktiker fungieren und praxisnahe Ratschläge für eigene Gutachten bzw. den Umgang mit Gutachten im Verfahren anhand von realen Praxisbeispielen zu Fragen wie der Schuldfähigkeit oder der Kriminalprognose liefern. Es erläutert überblicksartig und prägnant die forensisch-psychiatrische Begutachtungspraxis und beschreibt wichtige Grundlagen, praxisnahe Herausforderungen sowie Fallstricke insbesondere für Einsteiger. Nah an der Begutachtungspraxis gibt dieses Handbuch eine griffbereite Orientierung für Einsteiger im forensisch-psychiatrischen Berufskontext und enthält Auszüge aus Gutachten mit Beispielbewertungen, Literaturtipps und weiteres, nützliches Material zur Vertiefung.
Auch wenn das vorliegende Handbuch bereits im Titel die psychiatrische Profession adressiert, sei an dieser Stelle vorab angemerkt, dass Psychologen grundlegend genauso wie Psychiater strafrechtsrelevante Gutachten erstellen und vor Gericht erstatten können. Laut Bundesgerichtshof liegt es im Ermessen des Gerichts, ob im strafrechtlichen Kontext ein Psychiater oder Psychologe hinzuzuziehen ist. Auf Grundlage der Stärken beider Disziplinen empfiehlt sich aus Sicht der Autoren ohnehin das arbeitsteilige interdisziplinäre Zusammenwirken von Psychiatern und Psychologen. Aus ökonomischen Gründen wird in diesem Handbuch stets auf die psychiatrisch-forensische Begutachtung eingegangen; die entsprechenden Inhalte lassen sich aber selbstverständlich genauso auf von Psychologen erstellte Gutachten anwenden. Ohnehin ist aber aus Sicht der Autoren für die Qualität eines Gutachtens nicht die Profession an sich, sondern die durch Fortbildungen und Zertifizierungen erlangte individuelle Kompetenz eines Sachverständigen entscheidend.
1 Die forensische Psychiatrie
1.1 Womit beschäftigt sich die forensische Psychiatrie?
Die forensische Psychiatrie beschäftigt sich als Teildisziplin der Psychiatrie neben der Erfassung, Betreuung und Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher zudem mit fachspezifischen Begutachtungsfragen aus sämtlichen relevanten Rechtsgebieten wie dem Straf-, Zivil- oder Sozialrecht (Müller & Nedopil 2017). Als interdisziplinäre Wissenschaft integriert sie mehrere Teilbereiche und dient somit als Schnittstelle mehrerer Disziplinen. So bringen unter anderem die Rechtswissenschaften, die (Rechts-)Medizin, die Psychologie, die Kriminologie, die Neurologie und die Soziologie ihre fachspezifischen Kompetenzen mit ein und ergänzen sich zur eigenständigen Teildisziplin.
1.2 Woher kommt der Begriff »forensisch«?
Das eingrenzende Adjektiv »forensisch« leitet sich vom lateinischen forum ab und bezeichnet den Platz, das Theater oder auch das Gericht. Ein Forum war im alten Rom der Marktplatz, auf dem unter anderem gerichtliche Verhandlungen abgehalten und öffentliche Rechtsstreitigkeiten ausgetragen wurden. »Forensisch« bezieht sich demnach auf die Anwendung einer Wissenschaft zur Beantwortung von gerichtlichen Fragen verschiedener gutachterlicher Bereiche (Müller & Nedopil 2017).
1.3 Welche Stellung nimmt die psychiatrisch-forensische Begutachtung ein?
Die forensisch-psychiatrische Begutachtung übernimmt innerhalb der Disziplin eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, indem psychowissenschaftliche Sachverständige den juristischen und behördlichen Entscheidungsträgern anhand ihres spezifischen Fachwissens die wissenschaftliche Erkenntnisgrundlage für juristische Entscheidungen liefern (Wertz et al. 2023). Regelmäßig werden somit Sachverständige(1) verschiedener Professionen herangezogen, um juristische Entscheidungen auf eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zu stellen (Dahle 2010). Die Aufgabe eines Sachverständigen besteht darin, dem Auftraggeber die medizinischen und psychologischen Voraussetzungen der gestellten Fragestellungen darzulegen und vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Expertise zu erläutern, sodass der Auftraggeber auf dieser Grundlage eine eigenständige Entscheidung treffen kann.
1.4 Aus welchen Rechtsgebieten ergeben sich psychiatrisch-forensische Begutachtungsaufträge?
Aufgabenstellungen an die forensische Psychiatrie ergeben sich grundlegend aus allgemeinen rechtlichen Problemen im Umgang mit psychisch Kranken sowie aus den Auswirkungen der psychischen Probleme dieser Menschen auf ihre Fähigkeit zu rechtsrelevantem Handeln (Müller & Nedopil 2017). Entsprechende Auswirkungen können häufig Rechtsfragen(1) in unterschiedlichen Bereichen nach sich ziehen (Dreßing & Förster 2021a). Bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung geht es dabei nicht um das Treffen allgemein überdauernder gültiger und abstrakter Feststellungen bezüglich rechtlicher Fragen, sondern immer um die konkrete Beantwortung einer psychiatrisch-juristischen Fragestellung anhand eines konkreten Einzelfalls (Dreßing & Foerster 2021a). Aufträge für Begutachtungen sind somit in allen Rechtsgebieten denkbar und kommen regelhaft vornehmlich im Straf-, Zivil- und Sozialrecht vor (Segmiller & Dudeck 2023).
1.5 Mit welchen konkreten Fragestellungen befasst sich die psychiatrisch-forensische Begutachtung?
Fragestellungen werden aus den verschiedenen Rechtsbereichen an psychiatrische Sachverständige geleitet. Typische zivilrechtliche Fragestellungen umfassen unter anderem die Begutachtung der Geschäfts-, Testier- oder Prozessfähigkeit oder im Rahmen des Familien- und Vormundschaftsrechts die elterliche Sorge bzw. die Gefährdung des Kindeswohls. Auch die Frage des Leistungsbezugs einer Berufsunfähigkeitsversicherung fällt mittlerweile seit einer Gesetzesänderung zum 01. 01. 2001 in das Zivilrecht. Im Sozialrecht geht es in der Regel um die Beurteilung einer Arbeitsunfähigkeit, der Rente und Minderung der Erwerbsfähigkeit oder der vollen bzw. teilweisen Erwerbsminderung. Typische strafrechtsrelevante Fragestellungen beinhalten die Frage nach der Schuldfähigkeit (oftmals) in Verbindung mit der sich anschließenden Frage nach der Unterbringung in einer Maßregelvollzugseinrichtung oder Entziehungsanstalt, der Kriminalprognose, Fragen zur Sicherungsverwahrung, der Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der Reifebeurteilung von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden oder der Verhandlungs- oder der Haftfähigkeit. Weitere Gebiete der Sachverständigentätigkeit sind das Verwaltungsrecht(1) (z. B. die Frage nach der Zulassung zu einem Studium über eine Härtefallregelung), das Verkehrsrecht(1) (z. B. Untersuchung der Fahreignung), das Waffenrecht(1) (z. B. zur Frage der Eignung zur Benutzung einer Schutzwaffe) und Kausalitätsprüfungen nach dem Opferentschädigungsgesetz(1) (Hänert 2023).
Vor dem Hintergrund der Vielzahl an dargestellten Fragestellungen an psychowissenschaftliche Sachverständige wird im Folgenden konkreter auf die strafrechtsrelevante Begutachtungspraxis eingegangen, die im Fokus dieses Handbuchs liegt.
Take-home Messages
Die interdisziplinäre Teildisziplin der forensischen Psychiatrie beschäftigt sich mit der Erfassung, Betreuung, Behandlung und Begutachtung psychisch kranker Rechtsbrecher.
Die Namensgebung leitet sich vom lateinischen forum (= Marktplatz) ab; das Adjektiv forensisch bezieht sich auf die Anwendung einer Wissenschaft zur Beantwortung von gerichtlichen Fragen.
Forensisch-psychiatrische Begutachtungen zielen auf die Beantwortung medizinischer Voraussetzungen juristischer Fragestellungen ab.
Aufgabe eines psychiatrischen Sachverständigen ist die Beratung des Gerichts vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Expertise, sodass der Auftraggeber auf dieser Grundlage eine eigenständige Entscheidung treffen kann.
Aufträge für Begutachtungen sind in allen Rechtsgebieten denkbar und kommen regelhaft vornehmlich im Straf-, Zivil- und Sozialrecht vor.
Typische zivilrechtliche Fragestellungen umfassen unter anderem die Begutachtung der Geschäfts-, Testier- oder Prozessfähigkeit.
Sozialrechtliche Fragestellungen zielen in der Regel unter anderem auf die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit, der Erwerbsfähigkeit und der Erwerbsminderung ab.
Strafrechtsrelevante Fragestellungen beinhalten typischerweise die Frage nach der Schuldfähigkeit, der konsekutiven Unterbringung im Maßregelvollzug, der Kriminalprognose, der Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der Reifebeurteilung von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden oder der Verhandlungs- oder Haftfähigkeit.
Weiterführende Literaturempfehlungen
Dreßing, H & Förster, K (2021a). Forensisch-psychiatrische Untersuchung. In: Venzlaff, U., Foerster, K, Dreßing, H & Habermeyer, E (Hrsg). Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen. München: Urban & Fischer.
Häßler, F et al. (2022). Praxishandbuch Forensische Psychiatrie. Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Kröber, HL (2007). Was ist und wonach strebt Forensische Psychiatrie? In: Kröber, HL, Dölling, D, Leygraf, N & Saß, H (Hrsg). Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Band 1: Strafrechtliche Grundlagen der Forensischen Psychiatrie. Berlin, Heidelberg: Springer.
Kröber, HL et al. (2007). Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Band 1: Strafrechtliche Grundlagen der Forensischen Psychiatrie. Berlin, Heidelberg: Springer.
Kröber, HL et al. (2010). Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Band 2: Psychopathologische Grundlagen und Praxis der Forensischen Psychiatrie im Strafrecht. Berlin, Heidelberg: Springer.
Müller, JL & Nedopil, N (2017). Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht. Stuttgart: Thieme.
Venzlaff, U et al. (2021). Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen. München: Urban & Fischer.
Völlm, B & Schiffer, B (2023). Forensische Psychiatrie. Rechtliche, klinische und ethische Aspekte. Berlin: Springer.
2 Psychiatrisch-forensische Begutachtung
2.1 Welche Stellung hat die psychiatrisch-forensische Begutachtung im Strafrecht?
Das Erstellen von strafrechtsrelevanten Gutachten gehört zu den zentralen Tätigkeiten von im forensischen Kontext tätigen psychowissenschaftlichen Berufsgruppen (Hänert 2023). Der Sachverständige(2) nimmt dabei eine beratende Rolle für den Auftraggeber – vornehmlich das Gericht – ein. Seine Aufgabe besteht darin, die medizinischen Voraussetzungen für die Beantwortung juristischer Fragestellungen zu erläutern, sodass der Auftraggeber auf dieser Grundlage eine eigenständige Entscheidung treffen kann. Hierbei geht es stets um konkrete individuelle psychiatrisch-forensische Fragestellungen im Einzelfall und keine allgemein überdauernden, umfassenden Beurteilungen von Menschen (Dreßing & Förster 2021b; Hänert 2023). Strafrechtsrelevante Fragestellungen an psychiatrisch-forensische Sachverständige sind vielfältig und können im Ermittlungs-, Zwischen-, Haupt- und Erkenntnisverfahren vorkommen.
2.1.1 Wann muss und kann im Strafrecht ein Sachverständiger hinzugezogen werden?
Ob und in welcher Form ein Sachverständigengutachten(1) in Auftrag gegeben wird, obliegt weitestgehend dem Ermessen des Gerichts. Eine Verletzung der Aufklärungspflicht liegt vor, wenn es bei relevanten fachfremden Fragen auf Sachverständige verzichtet. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen ist immer dann notwendig, wenn das Gericht nicht selbst die erforderliche Sachkenntnis für die Feststellung von Tatsachen oder die Beurteilung von Fragen besitzt.
Merke
Das Gericht hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu befinden, ob es selbst die erforderliche Sachkunde besitzt oder nicht.
Bei psychiatrisch-forensischen Fragestellungen sieht die Rechtsprechung die Einholung eines Gutachtens meist als erforderlich und damit als zwingend geboten an (Müller & Nedopil 2017). In welchen Fällen ein psychiatrisch-forensischer Sachverständiger hinzuzuziehen ist, ist in der Strafprozessordnung(1) (StPO) jedoch nur fragmentarisch geregelt. Manche Gutachten im Strafrecht sind gesetzlich vorgeschrieben, andere stehen im Ermessen des Gerichts. Hängt die richterliche Beurteilung juristischer Fragestellungen von der Feststellung psychiatrischer Erkrankungen und deren diagnostischer Beurteilung oder bestimmten psychischen Zuständen ab, so ist im Allgemeinen ein Sachverständiger heranzuziehen. Die Notwendigkeit für die Einholung eines psychiatrisch-forensischen Gutachtens im Strafrecht ergibt sich nicht aus der Schwere der Straftat oder der zu erwartenden Verurteilung, sondern aus den konkreten Umständen des Einzelfalls.
Im Hauptverfahren ist ein Sachverständiger(3) verpflichtend heranzuziehen, wenn mit der Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, in einer Entziehungsanstalt oder in der Sicherungsverwahrung zu rechnen ist oder die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (nach (1)§ 67e StGB) geprüft werden soll. Vor der Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung(1) sind sogar zwei voneinander unabhängige Sachverständige heranzuziehen. Unter denselben Umständen soll auch im Ermittlungs- sowie Sicherungsverfahren ein Sachverständiger hinzugezogen werden (Rosenau 2021a; Rössner 2007; Schmidt & Habermeyer 2023; Wolf & Nedopil 2005).
2.1.2 Wie und durch wen erfolgt die Auswahl des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen?
Die Auswahl von Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl sowie der Fachrichtung erfolgen im Strafprozess gemäß Strafprozessordnung in der Regel durch den Richter. Bedenken gegen die Auswahl des Sachverständigen können jedoch von sämtlichen Verfahrensbeteiligten unter Angabe von Gründen (z. B. Misstrauen gegen die Unparteilichkeit(1) oder Neutralität(1)) vorgebracht werden (Hänert 2023). Aus diesem Grund ist der Verteidiger vor der Auswahl des Sachverständigen zu hören (Rössner 2007). Sachverständige(4) haben kein eigenes grundlegendes Recht zur Selbstablehnung, die Pflicht zur Erstellung von Gutachten(1) ist generell eine staatsbürgerliche Aufgabe (Rössner 2007). Sie können aber aus denselben Gründen wie Zeugen (z. B. Verwandtschaft), der Verschwiegenheitsverpflichtung aufgrund einer früheren Behandlung des Probanden oder aufgrund persönlicher Aspekte wie Arbeitsüberlastung oder fehlender Kompetenzen einen Gutachtenauftrag ablehnen (Franke 2022; Hänert 2023). Im Hauptverfahren(1) wird der Auftrag in der Regel vom Gericht vergeben, im Ermittlungsverfahren(1) können Sachverständige bereits von der Staatsanwaltschaft mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden. Auch der Beschuldigte bzw. Angeklagte selbst oder seine Verteidigung können eigenständig ein psychiatrisch-forensisches Sachverständigengutachten, ein sogenannte Privatgutachten(1), in Auftrag geben (mehr zur Erstellung von Privatgutachten siehe Abschn. 2.4.4) (Kaspar 2022). Festgelegte Kriterien für die Auswahl von Sachverständigen lassen sich nicht finden (Rosenau 2021a). Die tatsächliche Auswahl der Sachverständigen hat sich primär an deren fachlicher Eignung zur Beantwortung der konkreten Gutachtenfrage zu orientieren (fachspezifische Kompetenzen, wissenschaftliche Offenheit und Neutralität). Von verschiedenen Institutionen wie z. B. Landesärztekammern, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) oder dem Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) bzw. der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPS) werden aktualisierte Listen mit Sachverständigen zur Verfügung gestellt, welche über ein Zertifikat bei den entsprechenden Gesellschaften oder Verbänden verfügen (mehr zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen siehe Kap. 5.1) (Segmiller 2022b).
2.1.3 Was sind typische strafrechtsrelevante Fragestellungen?
Psychiatrisch-forensische Sachverständige werden in der strafgerichtlichen Praxis für vielfältige Fragen herangezogen (Rosenau 2021b). Typische strafrechtsrelevante Probleme umfassen zunächst die Frage nach der Schuldfähigkeit gemäß (2)§§ 20 und 21 StGB(1) und die (oftmals) damit in Verbindung stehende Frage nach der Unterbringung im Maßregelvollzug(1) – entweder in einem psychiatrischen Krankenhaus (gemäß (3)§ 63 StGB) oder in einer Entziehungsanstalt (gemäß (1)§ 64 StGB). Bei einer Maßregelindikation ist zwangsläufig auch eine Beurteilung zukünftiger Gefährlichkeit unabdingbar. Zudem sind kriminalprognostische Beurteilungen(1) unter anderem bei der Aussetzung von Strafen nach (1)§§ 57, (1)57a StGB und Maßregeln nach (1)§§ 67b und (1)67d Abs. 2 StGB einzuholen. Auch ergeben sich kriminalprognostische Fragestellungen unter anderem zur Vorbereitung von Sanktionsentscheidungen, bei Bestimmungen einer erforderlichen und möglichen Behandlung, der Strafaussetzung zur Bewährung und Aussetzung des Strafrestes ((1)§§ 56, (2)57, (2)57a StGB) sowie zur Anordnung der Sicherungsverwahrung(1) ((1)§ 66 StGB), der vorbehaltenen und – bei Fehleinweisung(1) in ein psychiatrisches Krankenhaus – der nachträglichen Sicherungsverwahrung ((1)§§ 66a, (1)66b StGB) (Rosenau 2021b). Darüber hinaus ergeben sich Begutachtungserfordernisse im Rahmen der Anordnung und Durchführung einer Unterbringung für gutachterliche Stellungnahmen unter anderem zur Frage der sofortigen Aussetzung zur Bewährung ((2)§ 67b StGB), zur bedingten Aussetzung ((2)§ 67d Abs. 2, (2)§ 67e StGB), zur Änderung der Vollstreckungsreihenfolge(1) ((1)§ 67 Abs. 2 und (1)3 StGB), zur Überweisung in den Vollzug(1) einer anderen Maßregel ((1)§ 67a StGB), zur Erteilung von Weisungen ((1)§ 68b StGB), zur Gewährung von Vollzugslockerungen sowie im Rahmen der Führungsaufsicht(1) zur Erteilung und Änderung von Weisungen, dem Widerruf der Aussetzung ((1)§ 67g StGB) oder im Rahmen einer befristeten Wiederinvollzugsetzung ((1)§ 67h StGB) (Eusterschulte et al. 2021). Herangezogen werden psychiatrisch-forensische Sachverständige zudem bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der Reifebeurteilung von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden oder der Verhandlungs-, Vernehmungs- oder der Haftfähigkeit (Bergmann & Köhler 2024; Rosenau 2021b). Hinzu kommen Gutachten zur Behandlungsfähigkeit sowie Aussagetüchtigkeit (Rössner 2007).
2.1.4 Was sind Aufgaben und Anforderungen eines psychiatrisch-forensischen Gutachtens?
Sachverständige(5) nehmen auf Grundlage eigener Sachkunde und Erfahrung Stellung zu Fragen, deren Beantwortung eine besondere fachliche Expertise erfordert (Hänert 2023). Die Aufgabe eines Sachverständigen ist es, auf Basis des schriftlichen Gutachtens und der mündlichen Erstattung in foro psychiatrische Sachverhalte und Schlussfolgerungen nachvollziehbar und allgemeinverständlich zu formulieren, darzustellen und an psychiatrisch-forensische Laien zu vermitteln, sodass diese sie eigenständig in ihrem Fachgebiet anwenden können. Ziel ist es, dem Auftraggeber die psychiatrisch-forensischen Voraussetzungen zu benennen und diese zu erläutern, um so das Gericht in die Lage zu versetzen, selbstständig Entscheidungen zu treffen (Müller & Nedopil 2017).
Merke
Rechtsfragen werden nie vom psychiatrisch-forensischen Sachverständigen beantwortet.
Dieser hat lediglich die (medizinischen) Voraussetzungen zugrunde zu legen, aufgrund derer der Auftraggeber die juristische Fragestellung nach selbstständiger Wertung und Würdigung beantworten kann. Psychiatrisch-forensische Sachverständige unterstützen lediglich den Beurteilungs- und Entscheidungsprozess der auftraggebenden Instanzen, geben aber keine finale Bewertung ab. Sie haben sich als Beweismittel auf die Beurteilung der Umstände zu beschränken, auf die sich ihr Fachwissen bezieht; die Beweiswürdigung obliegt dabei stets dem Gericht (Hänert 2023).
Merke
Neben der Beherrschung der eigenen Fachdisziplin samt transparenter Darlegung der persönlichen und allgemeinen Kompetenzgrenzen der Disziplin an sich sowie der Grundkenntnisse über das Rechtsgebiet lassen sich folgende weitere Anforderungen an eine gutachterliche Tätigkeit definieren:
keine Grenzüberschreitung der Beratungsaufgabe für den Auftraggeber
Unparteilichkeit
Neutralität
Objektivität
Vertrauenswürdigkeit
persönliche Integrität des Sachverständigen gegenüber allen Verfahrensbeteiligten
die Fähigkeit zur Integration sämtlicher relevanter Informationen mit Fokus auf die für die Fragestellung relevanten Anknüpfungstatsachen
Zudem sollen Sachverständigengutachten einen Nutzen für den Auftraggeber darstellen und nachprüfbar sein. Sämtliche dargestellten Anforderungen bilden die Grundlage, ein Gutachten, wie vom Gesetz gefordert, »unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen« zu erstatten (Dreßing & Foerster 2021b; Kury & Obergfell-Fuchs 2012; Segmiller 2022b). »Unparteiisch« (1)ist dabei definiert als die Unabhängigkeit gegenüber sämtlichen Verfahrensbeteiligten und den entsprechenden Erwartungshaltungen. Diesbezügliches Misstrauen kann sich z. B. dann ergeben, wenn sich Sachverständige vor der Beweisaufnahme oder während eines laufenden Prozesses öffentlich hinsichtlich ihrer gutachterlichen Einschätzung äußern, den Gutachtenauftrag überschreiten oder falsche Angaben über das diagnostische Vorgehen machen (Hänert 2023). »Nach bestem Wissen« meint die Kompetenz bzw. Qualifikation des Sachverständigen. Er muss sein Fachgebiet beherrschen, die Gesamtheit aller diagnostischen und psychopathologischen Aspekte beurteilen sowie fachliche Fragen erkennen und benennen können. »Nach bestem Gewissen« zielt auf die Vertrauenswürdigkeit des Sachverständigen und umfasst die Objektivität(1) in der Beurteilung, die Transparenz in seinen Feststellungen und die Nachvollziehbarkeit in seinen Schlussfolgerungen. Vom psychiatrisch-forensischen Sachverständigen wird verlangt, ein wissenschaftlich begründetes, kriterienorientiertes Gutachten als wichtige Entscheidungshilfe rechtlicher Fragestellungen vorzulegen (Dreßing & Foerster 2021b).
2.1.5 Wie ist die Abgrenzung zu einer Stellungnahme bzw. Beurteilung?
Ein psychiatrisch-forensisches Sachverständigengutachten(2) ist eine umfassende Darstellung selbst erhobener und fremder Befunde. Das Ziel ist die nachvollziehbare Beantwortung einer konkreten Fragestellung auf Basis wissenschaftlich anerkannter Methoden und Kriterien unter Zugrundelegung des aktuellen Forschungsstandes. Es stellt eine wissenschaftliche Leistung dar, aufgrund wissenschaftlich anerkannter Methoden und Kriterien nach festgelegten Kriterien der Gewinnung und Interpretation von Daten fundierte Feststellungen zu konkreten Fragestellungen zu treffen. Es beinhaltet stets eine eigenständige Untersuchung samt Exploration des Probanden. Wird diese seitens des Probanden abgelehnt oder abgebrochen und erfolgt die Bitte des Auftraggebers, nur anhand der Akteninformationen Aussagen und Beurteilungen zu tätigen, ist von einer Beurteilung nach Aktenlage oder einer Stellungnahme(1) zu sprechen. »Fehlt eine Untersuchung z. B. bei Ablehnung der Exploration durch den Probanden mit folgender Bitte des Auftraggebers, nur anhand der Aktenlage Aussagen zu tätigen, sollte von einer Stellungnahme oder(1) einer Beurteilung nach(1) Aktenlage gesprochen werden. Damit betont man, dass – zumindest aus psychiatrischer Sicht – kein Gutachten im eigentlichen Sinn vorliegt.« (Segmiller & Dudeck 2023, S. 19) Gutachterliche Stellungnahmen können (z. B. ergänzend zu anderen Gutachten) ebenso konkrete (Detail-)Fragestellungen des Auftraggebers auf Basis empirischer und theoretischer Erkenntnisse beantworten, die entsprechenden sachverständigen Verfasser erheben dafür aber keine eigenen Befunde. Während aus psychowissenschaftlicher Sicht ohne eigene Untersuchung des Probanden durch den Sachverständigen somit kein Gutachten im eigentlichen Sinne vorliegt, stellen aus juristischer Perspektive neben Gutachten auch ärztliche Stellungnahmen, Zeugnisse oder anderweitige ärztliche Beurteilungen unabhängig von der eigenen Untersuchung des Probanden bzw. Patienten zumindest Beweismittel dar (Hänert 2023; Kury & Obergfell-Fuchs 2012).
2.1.6 Wie ist die Stellung eines psychiatrischen Sachverständigen?
Die Stellung des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen(1) ist grundlegend auf eine Gehilfenrolle festgelegt, weshalb er mitunter als »Berater des Gerichts« bezeichnet wird. Die Aufgabe des Sachverständigen besteht darin, dem Auftraggeber die Sachverhalte derart darzustellen und zu erläutern, sodass dieser diese nachvollziehen und eine eigenständige, begründete Meinung bilden kann. Dafür bedarf es der besonderen Berücksichtigung von Sachverständigen, sämtliche Sachverhalte, Schlussfolgerungen und Interpretationen laiengerecht in allgemein verständlicher Sprache zu vermitteln. Die eigentliche Beantwortung der Rechtsfrage erfolgt nicht durch den Sachverständigen, er dient lediglich als Beweismittel. Er bietet auf Basis seiner fachlichen Kompetenz Hinweise, Anhaltspunkte und Schlussfolgerungen, die dem Auftraggeber als Hilfe bei der Entscheidungsfindung dienen. Ein Sachverständiger(6) hat dabei nur solche Fragen zu beantworten, zu deren Beantwortung er unter Wahrung der Kompetenzgrenzen fachlich geeignet ist. Die eigenständige Beurteilung juristischer Begrifflichkeiten, wie z. B. die Schuldfähigkeit, Aussagetüchtigkeit oder die Prozessfähigkeit, deren Feststellung nicht zu den Aufgaben eines Sachverständigen gehört, ist als inadäquat anzusehen. Er hat nichts weiter als die psychiatrisch-forensischen Voraussetzungen für die entsprechenden juristischen Termini zu beurteilen (Dreßing & Foerster 2021b; Müller & Nedopil 2017; Rosenau 2021a). Trotz der exklusiv beratenden Stellung des Sachverständigen im Strafrecht ist er in seiner Ausübung selbstständig und unabhängig. Er kann grundsätzlich alle Ermittlungsunterlagen einsehen und anfordern und ebenso anregen, weitere Personen für einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu befragen (Segmiller 2022b). Psychiatrisch-forensische Sachverständige müssen im Rahmen der Begutachtung nicht alle erforderlichen Untersuchungen in Gänze persönlich durchführen; die Hinzuziehung von namentlich benannten Gehilfen ist erlaubt, solange er sich von den Untersuchungsbefunden selbst überzeugt und diese eigenständig verantwortet. Unter die untergeordneten Hilfsdienste können z. B. Schreibarbeiten oder quantitative Testauswertungen fallen. Begutachtungen, die unter Supervision erstellt werden (z. B. um einen Neuling einzuarbeiten), sind in jedem Rechtsgebiet vorab dem Auftraggeber mitzuteilen bzw. ist dessen explizite Zustimmung einzuholen. In jedem Falle ist der Sachverständige jedoch verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers Akten, Mitschriften, Auswertungsdokumente und Untersuchungsergebnisse herauszugeben (Hänert 2023; Müller & Nedopil 2017).
Take-home Messages
Das Erstellen von strafrechtsrelevanten Gutachten gehört zu den zentralen Tätigkeiten von im forensischen Kontext tätigen psychowissenschaftlichen Berufsgruppen.
Die Hinzuziehung eines Sachverständigen im Strafrecht ist immer dann notwendig, wenn das Gericht nicht selbst die erforderliche Sachkenntnis für die Feststellung von Tatsachen oder die Beurteilung von psychiatrisch-forensischen Fragen besitzt.
Der Auftrag wird in der Regel vom Gericht vergeben; im Ermittlungsverfahren(2) können Sachverständige jedoch bereits von der Staatsanwaltschaft mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden. Auch der Beschuldigte bzw. Angeklagte selbst kann eigenständig ein sogenanntes Privatgutachten(2) in Auftrag geben.
Die konkrete Auswahl von Sachverständigen erfolgt im Strafprozess gemäß Strafprozessordnung im Allgemeinen durch den Richter und orientiert sich primär an der fachlichen Eignung zur Beantwortung der konkreten Gutachtenfrage.
Strafrechtsrelevante Fragestellungen beinhalten typischerweise unter anderem die Frage nach der Schuldfähigkeit, der konsekutiven Unterbringung im Maßregelvollzug, der Kriminalprognose, der Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der Reifebeurteilung von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden bzw. der Verhandlungs- oder Haftfähigkeit.
Die Aufgabe eines Sachverständigen ist es, psychiatrische Sachverhalte nachvollziehbar und allgemeinverständlich an psychiatrisch-forensische Laien zu vermitteln.
Rechtsfragen werden nie vom psychiatrisch-forensischen Sachverständigen beantwortet. Dieser hat lediglich die (medizinischen) Voraussetzungen zugrunde zu legen, aufgrund derer der Auftraggeber die juristische Fragestellung nach selbstständiger Wertung und Würdigung beantworten kann.
Die Stellung des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen im Strafrecht ist grundlegend auf eine Gehilfenrolle festgelegt. Trotz der exklusiv beratenden Stellung ist er in seiner Ausübung selbstständig und unabhängig.
Ein psychiatrisch-forensisches Sachverständigengutachten beinhaltet stets eine eigenständige persönliche Untersuchung des Probanden. Kann diese nicht erfolgen oder erfolgt die Bitte des Auftraggebers, nur anhand der Akteninformationen Aussagen und Beurteilungen(1) zu tätigen, ist von einer Beurteilung nach Aktenlage(2) oder einer Stellungnahme zu sprechen.
Weiterführende Literaturempfehlungen
Bergmann, B & Köhler, D (2024). Rechtspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Bliesener, T et al. (2023). Lehrbuch Rechtspsychologie. Bern: Hogrefe.
Dohrenbusch, R (2023). Psychologische Begutachtung. Berlin, Heidelberg: Springer.
Dreßing, H & Förster, K (2021b). Aufgaben und Stellung des psychiatrischen Sachverständigen. In: Venzlaff, U, Foerster, K, Dreßing, H & Habermeyer, E (Hrsg). Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen. München: Urban & Fischer.
Franke, I (2022). Stellung des Gutachters zum Begutachteten. In: Häßler, F, Nedopil, N & Dudeck, M (Hrsg). Praxishandbuch Forensische Psychiatrie. Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Häßler, F et al. (2022). Praxishandbuch Forensische Psychiatrie. Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Hänert, P (2023). Rechte und Pflichten der psychologischen Sachverständigen und allgemeine Grundlagen der Begutachtung. In: Bliesener, T, Lösel, F & Dahle, KP (Hrsg). Lehrbuch Rechtspsychologie. Bern: Hogrefe.
Kröber, HL et al. (2007). Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Band 1: Strafrechtliche Grundlagen der Forensischen Psychiatrie. Berlin, Heidelberg: Springer.
Kury, H & Obergfell-Fuchs, J (2012). Rechtspsychologie. Forensische Grundlagen und Begutachtung. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer.
Müller, JL & Nedopil, N (2017). Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht. Stuttgart: Thieme.
Segmiller, F (2022b). Stellung des Gutachters im Prozess. In: Häßler, F, Nedopil, N & Dudeck, M (Hrsg). Praxishandbuch Forensische Psychiatrie. Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Venzlaff, U et al. (2021). Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen. München: Urban & Fischer.
Völlm, B & Schiffer, B (2023). Forensische Psychiatrie. Rechtliche, klinische und ethische Aspekte. Berlin: Springer.
2.2 Was sind die Prinzipien einer psychiatrisch-forensischen Begutachtung?
Psychiatrisch-forensische Begutachtungen unterliegen einigen grundlegenden Prinzipien, die von der klassischen medizinischen Tätigkeit eines Psychiaters abweichen und zu Rollenkonfusionen führen können. In der Regel wird von einem bei einem Psychiater vorstellig werdenden Patienten nicht nur die selbstverständliche Respektierung der ärztlichen Schweigepflicht erwartet, sondern auch die ärztliche Verpflichtung, für den Patienten da zu sein, alle nachteiligen Entwicklungen von ihm fernzuhalten und das Bestmögliche für ihn zu tun. Ein Aufsuchen ist üblicherweise mit der unausgesprochenen Erwartung verbunden, dass das Wohl, die Hilfeleistung und die Unterstützung des Patienten im Vordergrund stehen. Insofern muss ein psychiatrisch-forensischer Sachverständiger sich selbst und vor allem dem Probanden (man beachte schon die abweichende Bezeichnung des zu Untersuchenden; mehr dazu siehe Abschn. 2.2.2) mit größtmöglicher Klarheit den Unterschied zwischen den Rollen als Psychiater/Therapeut und als Sachverständiger deutlich machen (Rössner 2007). Zudem unterliegt die psychiatrisch-forensische Sachverständigentätigkeit weiteren Anforderungen wie unter anderem der Neutralität bzw. Unparteilichkeit oder der Abgrenzung von medizinischen zu juristischen Krankheitsbegriffen.
2.2.1 Gilt die ärztliche Verschwiegenheitspflicht auch bei Begutachtungen?
Bei einem gerichtlich bestellten psychiatrisch-forensischen Sachverständigen besteht gegenüber dem Auftraggeber keine ärztliche oder therapeutische Verschwiegenheitspflicht(1). Er besitzt zudem auch kein Zeugnisverweigerungsrecht(1). Es besteht sogar eine Aussagepflicht, sprich Informationen, nach denen der Sachverständige unter anderem in der Hauptverhandlung befragt wird, dürfen nicht zurückgehalten werden. Gegenüber Dritten (ausschließlich nur dem Auftraggeber gegenüber nicht) ist er jedoch zur Verschwiegenheit(1) verpflichtet (Segmiller & Dudeck 2023).
2.2.2 Ist die zu begutachtende Person ein Proband(1) oder ein Patient(1)(1)?
Während man im therapeutischen und Behandlungssetting vom Patienten spricht, wird die zu begutachtende Person im Rahmen einer psychiatrisch-forensischen Sachverständigentätigkeit stets Proband genannt (Segmiller & Dudeck 2023).
2.2.3 Worüber muss ich Probanden vor einer Begutachtung aufklären?
Die Aufklärung(1) hat unmittelbar nach Begrüßung zu erfolgen – sie ist also der erste Teil einer Begutachtung.
Merke
Ablauf und Inhalt einer Aufklärung
Der psychiatrisch-forensische Sachverständige sollte den Probanden zunächst über den gutachterlichen Auftrag, die konkreten Fragestellungen sowie die Durchführungsbedingungen informieren, was auch den Zweck der Untersuchung, die Verwendung der Befunde, die Grenzen gutachterlicher Kompetenzen sowie die möglichen Auswirkungen und abstrakten Konsequenzen des Gutachtens umfassen sollte. Zudem sollte die zu begutachtende Person initial über die fehlende Verschwiegenheitspflicht sowie weitere Rechte und Aufgaben des Sachverständigen sowie über die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung aufgeklärt werden. Weiterhin ist der Proband darauf hinzuweisen, dass er ein Schweigerecht besitzt und dass ihm aus diesem kein Nachteil entstehen darf. Auch die Freiwilligkeit der Mitwirkung an einer Begutachtung sollte hervorgehoben werden (Müller & Nedopil 2017).
Zuletzt sind Probanden zu fragen, ob sie die Erklärungen und Ausführungen des Gutachters inhaltlich verstanden haben, ob noch Fragen an den Gutachter bestehen und ob sie sich mit den Begutachtungsmodalitäten einverstanden erklären (Bergmann & Köhler 2024). Die Aufklärung sollte – wie folgend beispielhaft angeführt – auch unbedingt im schriftlichen Gutachten dokumentiert werden (Segmiller & Dudeck 2023).
Fallbeispiel
Der Proband wurde zu Beginn der Untersuchung über Fragestellung, Sinn und Zweck sowie Ablauf und Inhalt der Begutachtung aufgeklärt. Er wurde darauf hingewiesen, dass seine Angaben und die Untersuchungsergebnisse nicht der (ärztlichen) Schweigepflicht des Untersuchers unterliegen und er im Rahmen seines Schweigerechts nicht verpflichtet ist, Angaben zu machen. Er wurde zudem über die Grenzen gutachterlicher Kompetenzen sowie die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung aufgeklärt. Er erklärte sich zur Untersuchung bereit und damit einverstanden, dass sämtliche Untersuchungsergebnisse, Befunde und Beobachtungen in dem Sachverständigengutachten Erwähnung finden können.
Es kann sinnvoll sein, zusätzlich eine Erklärung vom Probanden unterschreiben zu lassen, dass er umfassend aufgeklärt worden ist:
Fallbeispiel
Aufklärung für ein psychiatrisch-forensisches Sachverständigengutachten durch den Sachverständigen Sachmann
Herr Mustermann, geb. am 01. 01. 1990, wurde darauf hingewiesen, dass er im Auftrag der Staatsanwaltschaft Musterstadt untersucht wird und dass seine Angaben nicht der Schweigepflicht unterliegen. Er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ihm als Proband dem Gutachter gegenüber Schweigerecht zusteht, ohne dass ihm aus seinem Schweigen ein rechtlicher Nachteil erwachsen darf.
Herr Mustermann erklärte sich mit der Begutachtung einverstanden.
Musterstadt, den 01. 01. 2025
Auch empfiehlt es sich, sich die Identität des Probanden mittels Ausweises bestätigen zu lassen, sobald der Proband nicht vorgeführt wird (Dreßing & Förster 2021) oder er nicht inhaftiert/im Maßregelvollzug ist.
Fallbeispiel
Identität des Probanden
Der Proband wies sich mit seinem Personalausweis (Personalausweisnummer LF1234ABC) aus.
2.2.4 Worin unterscheidet sich der juristische vom medizinischen Krankheitsbegriff?
Der juristische Krankheitsbegriff unterscheidet sich grundsätzlich vom medizinischen. Während der medizinische Terminus auf Erkrankungen bzw. Störungen abzielt, die durch Ursache, Symptomatik, Verlauf und Therapierbarkeit determiniert und durch eine eindeutige Beschreibung von Symptomen sowie eine differenzialdiagnostische Abgrenzbarkeit von anderen Störungsbildern definiert sind, verfolgt der juristische Krankheitsbegriff einen anderen Ansatz. Er zielt unabhängig von Ursache oder Therapierbarkeit auf den Ausprägungsgrad einer Störung ab. Im Vordergrund steht dabei das Ausmaß von Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne eines Überschreitens einer festgelegten, normativ gesetzten Schwelle. Ein psychiatrisch-forensischer Sachverständiger muss sich mit den in den verschiedenen Gesetzestexten verwendeten Bezeichnungen für den juristischen Krankheitsbegriff auskennen und zudem wissen, welche klinischen Diagnosen unter welche juristischen Termini (vgl. z. B. Eingangsmerkmale der (3)§§ 20 und (2)21 StGB) zu subsumieren sind. Hierfür hat sich ein mehrstufiges Beantwortungsschema etabliert (Müller & Nedopil 2017). Sollte in einem ersten Schritt der Diagnosestellung keine psychiatrische Erkrankung gemäß gängigen Klassifikationssystemen festgestellt werden, erübrigen sich weitere psychiatrisch-forensische Schlussfolgerungen (einzige mögliche Ausnahme stellen »Affektdelikte« dar; siehe Kap. 4.8). Ausschlaggebend ist dabei oftmals nicht die Diagnose zum Untersuchungszeitpunkt, sondern zu einem bestimmten zu beurteilenden Zeitraum bzw. Zeitpunkt in der Vergangenheit, was eine retrospektive Beurteilung bedingt. Die Diagnosen sind zu beiden Zeitpunkten darzustellen, also sowohl zum aktuellen wie insbesondere zum beurteilungsrelevanten Zeitpunkt. In einem zweiten Schritt erfolgt die Zuordnung der Diagnosen zu den jeweiligen Rechtsbegriffen im Sinne einer Übersetzung in juristische Begrifflichkeiten. Der letzte Schritt umfasst die konkrete Beantwortung der Begutachtungsfragen in Form der Benennung der (medizinischen) Voraussetzungen aus psychiatrisch-forensischer Sicht, aufgrund derer der Auftraggeber dann eigenständig über die Rechtsfrage entscheiden kann. Hierbei stehen insbesondere konkrete psychopathologische Symptome und die Quantifizierung der rechtsrelevanten psychosozialen Funktionsbeeinträchtigungen im Vordergrund (Dreßing & Foerster 2021).
2.2.5 Bin ich als Sachverständiger gleichzeitig auch Zeuge?
Ein psychiatrisch-forensischer Sachverständiger kann auch als Zeuge(1) vernommen werden. Dies kommt z. B. vor, wenn der Angeklagte oder Beschuldigte gegenüber den ermittelnden Behörden keine Angaben macht, jedoch im Rahmen der Begutachtung gegenüber dem Sachverständigen. Daher empfiehlt es sich, die in der Untersuchung gewonnenen eigenen Angaben des Probanden, sogenannte Zusatztatsachen, deutlich von der weiteren Gutachtensdarstellung zu trennen, um sich selbst und auch das Gericht vor der Rollenkonfusion zwischen »Ermittlungstätigkeiten« und der Befunderhebung psychopathologischer Befunde zu schützen. Darüber hinaus können psychiatrisch-forensische Sachverständige als sachverständige Zeugen(1) vom Gericht geladen werden. Dann haben sie als Zeuge über klinische Beobachtungen zu berichten, die sie im Rahmen ihrer klinischen Tätigkeit gemacht haben. Sie sind angehalten, wie jeder Zeuge Beobachtungen zu schildern, aber darüber hinaus auch Schlussfolgerungen aufgrund ihrer Fachkenntnis zu ziehen (Müller & Nedopil 2017).
2.2.6 In welcher Form hafte ich als psychiatrisch-forensischer Sachverständiger?
Obwohl der psychiatrisch-forensische Sachverständige lediglich eine beratende Stellung im Strafverfahren innehat, so kann er doch unter gewissen Umständen in Haftung genommen werden. Ein Sachverständiger kann z. B. vom Auftraggeber oder vom Probanden für ein vermeintlich falsches Gutachten auf Schadensersatz(1) in zivilrechtlichen Anspruch genommen werden oder es können gegen ihn im Zusammenhang mit seiner gutachtlichen Tätigkeit strafrechtliche Vorwürfe erhoben werden (Gaidzik 2021). Die zivilrechtliche Haftung der gerichtlichen Sachverständigentätigkeit ist im BGB gesetzlich geregelt. Sachverständige müssen Schadensersatz(2) leisten, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig ein unrichtiges Gutachten erstattet haben und Verfahrensbeteiligten dadurch ein Schaden entstanden ist. Beispiele für ein unrichtiges Gutachten können eine unzureichende Berücksichtigung des aktuellen Wissenstandes, Fehler bei den eigenen Schlussfolgerungen aus herangezogenen Befunden und Anknüpfungstatsachen, die fehlende Ausschöpfung von Erkenntnismöglichkeiten oder das Vorspiegeln von Sicherheit, wo allenfalls ein Wahrscheinlichkeitsurteil möglich erscheint, sein (Gaidzik 2021; Hänert 2023). Unrichtig ist ein Sachverständigengutachten zudem, wenn es nicht der objektiven Sachlage entspricht, von einem unzutreffenden Sachverhalt ausgeht, festgestellte Tatsachen nicht existent sind, die Befunderhebung fehlerhaft oder unvollständig ist oder wenn falsche Schlüsse gezogen werden (Nedopil et al. 2021). Über die »Unrichtigkeit« hinaus muss dem Sachverständigen zudem der Vorwurf des Vorsatzes(1), zumindest aber der groben Fahrlässigkeit(1) gemacht werden können (Gaidzik 2021).
Merke