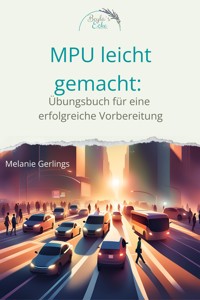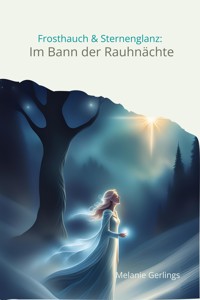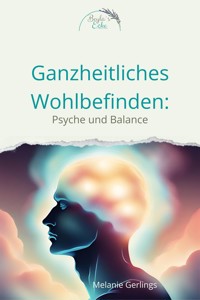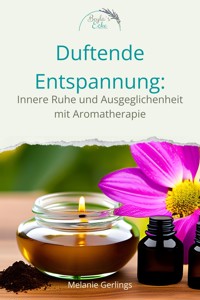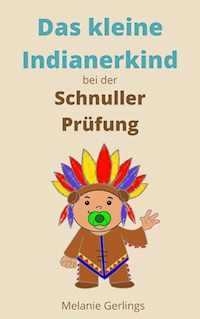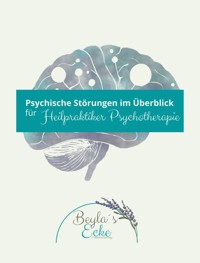
44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Nachschlagewerk bietet eine systematische und übersichtliche Darstellung der psychischen Erkrankungen nach ICD-10 – speziell aufbereitet für die Vorbereitung zur Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie (HPP). Alle Störungen sind einheitlich und lernfreundlich gegliedert: - Definitionen auf den Punkt gebracht - Symptome, Verlauf und Differenzialdiagnosen verständlich erklärt - Komorbiditäten, Risiken und Therapieoptionen im Überblick - Relevante rechtliche Hinweise für HPPs Diese Zusammenfassung wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt – als wertvolle Lernhilfe, kompaktes Nachschlagewerk und strukturierte Grundlage für Prüfung und Beruf. Ob zur Wiederholung, Vertiefung oder schnellen Orientierung: Dieses Buch bietet dir alles, was du über psychische Störungen im Rahmen der HPP wissen musst – klar, prüfungsrelevant und praxisnah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Melanie Gerlings
Psychische Störungen im Überblick für Heilpraktiker Psychotherapie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
F00 – Demenz bei Alzheimer-Krankheit
F01 – Vaskuläre Demenz
F02 – Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
F03 – Nicht näher bezeichnete Demenz
F04 – Organisches amnestisches Syndrom
F05 – Delir, nicht durch Alkohol oder psychotrope Substanzen bedingt
F06 – Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
F07 – Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
F09 – Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung
F10 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide
F12 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide
F13 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika
F14 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain
F15 – Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein
F16 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene
F17 – Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak
F18 – Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel
F19 – Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen
F20 – Schizophrenie
F21 – Schizotype Störung
F22 – Anhaltende wahnhafte Störung
F23 – Akute vorübergehende psychotische Störung
F24 – Induzierte wahnhafte Störung
F25 – Schizoaffektive Störung
F28 – Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F29 – Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose
F30 – Manische Episode
F31 – Bipolare affektive Störung
F32 – Depressive Episode
F33 – Rezidivierende depressive Störung
F34 – Anhaltende affektive Störungen
F38 – Andere affektive Störungen
F39 – Nicht näher bezeichnete affektive Störung
F40 – Phobische Störungen
F41 – Andere Angststörungen
F42 – Zwangsstörung
F43 – Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
F44 – Dissoziative (Konversions-)Störungen
F45 – Somatoforme Störungen
F48 – Andere neurotische Störungen
F50 – Essstörungen
F51 – Nichtorganische Schlafstörungen
F52 – Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit
F53 – Psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert
F54 – Psychische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
F60 – Spezifische Persönlichkeitsstörungen
F61 – Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
F62 – Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns
F63 – Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle
F64 – Störungen der Geschlechtsidentität
F65 – Störungen der Sexualpräferenz
F66 – Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung oder Orientierung
F70 – Leichte Intelligenzminderung
F71 – Mittelgradige Intelligenzminderung
F72 – Schwere Intelligenzminderung
F73 – Schwerste Intelligenzminderung
F78 – Sonstige Intelligenzminderung
F79 – Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F80 – Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache
F81 – Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten
F82 – Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen
F83 – Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen
F84 – Tiefgreifende Entwicklungsstörungen
F85 – Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörungen
F88 – Sonstige Entwicklungsstörungen
F89 – Nicht näher bezeichnete psychische Entwicklungsstörung
F90 – Hyperkinetische Störungen
F91 – Störungen des Sozialverhaltens
F92 – Kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen
F93 – Emotionale Störungen des Kindesalters
F94 – Störungen des Sozialverhaltens mit Beginn in der Kindheit
F95 – Ticstörungen
F98 – Sonstige Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
F99 – Nicht näher bezeichnete psychische Störung
Impressum neobooks
Vorwort
F00 – Demenz bei Alzheimer-Krankheit
Definition:
Eine primär degenerative, progredient verlaufende Erkrankung des Gehirns, die durch Gedächtnisverlust und zunehmende kognitive, emotionale sowie soziale Einschränkungen gekennzeichnet ist.
Synonyme:
Alzheimer-Demenz
Morbus Alzheimer
Primäre Demenz
Zahlen:
Kategorie
Angabe
Epidemiologie BRD
Ca. 1,6 Millionen Betroffene
(Stand 2020)
Geschlechterverhältnis
Frauen > Männer
(u. a. höhere Lebenserwartung)
Prävalenz
5–8 % bei über 65-Jährigen
Lebenserwartung
Ø nach Diagnose: 7–10 Jahre
Ersterkrankungsalter
meist > 65 Jahre
(seltener früh beginnend ab 50)
Zeitkriterien:
Gedächtnisstörung seit mind. 6 Monaten
Beginn schleichend und fortschreitender Verlauf
Beeinträchtigung von mindestens zwei kognitiven Bereichen
ICD-10-Kriterien:
Abnahme des Gedächtnisses, insbesondere des Kurzzeitgedächtnisses
Weitere Störungen: Urteilsvermögen, Denkvermögen, Sprache (Aphasie), Orientierung
Alltagsfunktionen sind beeinträchtigt
Keine Bewusstseinsstörung
Ausschluss anderer Ursachen (z. B. Delir, Depression)
Hauptsymptome:
Gedächtnisstörung
Orientierungsstörung
Sprachstörung (Aphasie)
Störung exekutiver Funktionen
Affektverflachung oder Reizbarkeit
Verlauf:
Frühstadium: Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen
Mittelstadium:Alltagshandlungen werden unsicher, Persönlichkeitsveränderung
Spätstadium: Bettlägerigkeit, Inkontinenz, schwere Orientierungsstörungen
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
Ja
Rückfallquote
Keine Rückfälle, kontinuierlicher Verlauf
Suizidrate
Frühstadium leicht erhöht
Gefahren:
Selbstvernachlässigung
Sturzgefahr
Weglauftendenz („Hinlauftendenz“)
Verkennen von Situationen
Medikamentenmissbrauch
Komorbiditäten:
Depression
vaskuläre Erkrankungen
Schlafstörungen
Delir im Akutstadium (z. B. durch Infekte)
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
Depression („Pseudodemenz“)
vaskuläre Demenz (F01)
Delir (F05)
F02 (z. B. Parkinson-Demenz)
Hypothyreose, Vitamin-B12-Mangel
Ätiologie / Pathogenese:
Amyloid-β-Plaques (extrazellulär)
Tau-Protein-Ablagerungen (intrazellulär → Neurofibrillen)
Verlust cholinerger Neuronen im Hippocampus
Genetische Prädisposition (ApoE4-Gen)
Neuroanatomie:
Degeneration vor allem im Hippocampus, parietalen und temporalen Kortex
Reduktion des Gehirnvolumens (Atrophie)
Verminderte Aktivität im präfrontalen Kortex
Diagnostik / Tests:
Mini-Mental-Status-Test (MMST)
Uhrentest, DemTect, CERAD
MRT: Atrophie, v. a. im medialen Temporallappen
Labor: Vitamin-B12, TSH, CRP, Elektrolyte zum Ausschluss somatischer Ursachen
Stadieneinteilung (vereinfachte Darstellung):
Leichte Demenz: Alltagskompetenz erhalten, Gedächtnisstörung
Mittelgradige Demenz: zunehmende Orientierungslosigkeit, Persönlichkeitsveränderung
Schwere Demenz: vollständige Pflegebedürftigkeit, Sprachverlust, Immobilität
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
neurodegenerative Erkrankung, cholinerge Hypofunktion
Verlustangst, Regression, narzisstische Kränkung
Verlust von Routinen → Unsicherheit → Rückzug oder Unruhe
hohe Belastung für pflegende Angehörige
Rechtliche Aspekte für HPP:
Patient kann oft nicht mehr geschäftsfähig sein → keine gültige Einwilligung
Zusammenarbeit mit Betreuer notwendig
Pflicht zur Beurteilung von Eigen- und Fremdgefährdung (z. B. bei Weglauftendenz)
Dokumentation der kognitiven Defizite → ggf. Empfehlung zur Diagnostik
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- Acetylcholinesterase-Hemmer (Donepezil, Rivastigmin)
- Memantin bei mittlerer bis schwere Demenz
- Antidepressiva bei komorbider Depression
- Milieutherapie
- Biografiearbeit
- Validation (nach Naomi Feil)
- Angehörigengespräche
- Strukturierung des Tagesablaufs
- Erinnerungsarbeit & Realitätsorientierung
- Aufklärung & Begleitung von Angehörigen
- Krisenintervention bei Überforderung
F01 – Vaskuläre Demenz
Definition:
Eine durch zerebrovaskuläre Erkrankungen verursachte Demenz. Sie entsteht infolge von Durchblutungsstörungen des Gehirns, etwa durch Schlaganfälle oder Mikroangiopathie, und ist meist schubweise oder stufenförmig im Verlauf.
Synonyme:
Multiinfarktdemenz
arteriosklerotische Demenz
vaskuläre kognitive Störung
Zahlen:
Kategorie
Angabe
Epidemiologie BRD
Zweithäufigste Demenzform (ca. 15–20 %)
Geschlechterverhältnis
Männer ≥ Frauen (durch höhere vaskuläre Risiken)
Prävalenz
1–2 % bei über 65-Jährigen
Lebenserwartung
Deutlich reduziert, häufig durch Begleiterkrankungen
Ersterkrankungsalter
meist über 65 Jahre
Zeitkriterien (ICD-10):
Kognitive Störung über mindestens 6 Monate
Zeitlicher Zusammenhang mit zerebralen Infarkten oder Gefäßerkrankungen
ICD-10-Kriterien (inhaltlich):
Gedächtnisstörung + mindestens ein weiteres kognitives Defizit
Nachweis einer zerebrovaskulären Erkrankung (z. B. CT, MRT)
Zeitlicher Zusammenhang zwischen vaskulärem Ereignis und Symptombeginn
Ausschluss anderer Ursachen wie Alzheimer, Depression oder Delir
Hauptsymptome:
Gedächtnisstörungen, jedoch oft besser als bei Alzheimer
Verlangsamung des Denkens (bradyphren)
emotionale Labilität, Apathie
fokale neurologische Ausfälle: Lähmungen, Sprachstörung
Gangstörung, Sturzrisiko erhöht
Verlauf:
Stufenförmig bei wiederholten Infarkten
Schubweise nach akuten Ereignissen (z. B. Schlaganfall)
Phasen der Stabilität möglich
Schnellerer Verlust alltäglicher Funktionen als bei Alzheimer
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
Ja
Rückfallquote
Hoch bei unbehandelter Grunderkrankung
Suizidrate
gering bis mittel (v. a. im Frühstadium)
Gefahren:
weitere Schlaganfälle
Stürze und Frakturen
Fehlmedikation bei eingeschränktem Urteilsvermögen
soziale Isolation
Inkontinenz im Verlauf
Komorbiditäten:
arterielle Hypertonie
Diabetes mellitus
Hyperlipidämie
koronare Herzkrankheit
Depression
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
Alzheimer-Demenz (F00)
frontotemporale Demenz
Parkinson-Demenz (F02)
Delir
Pseudodemenz bei Depression
Ätiologie / Pathogenese:
chronisch-hypoxische Hirnschädigung durch Mikroangiopathie
Embolien und Thrombosen
arterielle Hypertonie, Arteriosklerose
unzureichende Kollateralversorgung im Gehirn
Neuroanatomie:
Infarktareale meist im subkortikalen Bereich und den Basalganglien
häufig diffuse weiße Substanzläsionen (Leukoenzephalopathie)
Hirnatrophie bei chronischer Hypoxie
Diagnostik / Tests:
MMST, Uhrentest, DemTect
MRT/CT zur Darstellung vaskulärer Schäden
Labor: Ausschluss behandelbarer Ursachen (TSH, B12, Folsäure)
Duplex-Sonographie der Halsgefäße
internistische Abklärung (EKG, Blutdruck, Diabetes-Screening)
Stadien:
Keine international einheitliche Stadieneinteilung. Verlauf meist ungleichmäßig:
Anfangsstadium: leichte kognitive Defizite, v. a. Aufmerksamkeit
Mittleres Stadium: Alltagsprobleme, Gangunsicherheit, Stimmungsschwankungen
Spätstadium: umfassende Pflegebedürftigkeit
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
zerebrale Durchblutungsstörung → neuronaler Funktionsverlust
Reaktionsbildung auf Kontrollverlust
reduzierte Selbstwirksamkeit → Resignation
hohes Pflegeaufkommen → Überforderung von Angehörigen
Rechtliche Hinweise für HPP:
Einwilligungsfähigkeit kann erhalten oder eingeschränkt sein → Einzelfallprüfung
Betreuungsrecht bei Pflegebedürftigkeit beachten
Aufklärung über Sturzgefahr, Medikamentensicherheit, Weglauftendenz
Pflicht zur Weitervermittlung bei somatisch begründeter Ursache
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- Risikofaktoren behandeln (Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin)
- evtl. Antidementiva (z. B.
Donepezil off-label)
- Thrombozytenaggregationshemmer (ASS)
- Antidepressiva bei Bedarf
- kognitive Aktivierung
- Biografiearbeit
- Orientierungstraining
- Angehörigenberatung
- Unterstützung bei Alltagsstrukturierung
- Aufklärung über Erkrankung und Verlauf
- Aktivierende Gespräche
- Hilfe bei Krankheitsakzeptanz und Umgang mit Defiziten
F02 – Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
Definition:
Demenzen, die im Rahmen einer anderen, primär diagnostizierten Grunderkrankung entstehen, wie z.B. bei Morbus Parkinson, Chorea Huntington, HIV, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder multipler Sklerose.
Synonyme:
Sekundäre Demenz
Demenz bei Parkinson
HIV-assoziierte Demenz
Prionenbedingte Demenz
Zahlen:
Kategorie
Angabe
Epidemiologie BRD
Deutlich seltener als Alzheimer oder vaskuläre Demenz
Geschlechterverhältnis
abhängig von der Grunderkrankung
Prävalenz
z. B. Parkinson-Demenz: ca. 30–40 % aller Parkinsonpatienten
Lebenserwartung
deutlich reduziert bei z. B. Creutzfeldt-Jakob, HIV
Ersterkrankungsalter
variabel: je nach Grunderkrankung häufig jünger als bei Alzheimer
Zeitkriterien (ICD-10):
Kognitive Defizite über mehrere Monate
Nachweisbare zugrundeliegende Erkrankung des Gehirns
Kausalzusammenhang zwischen Grunderkrankung und Demenz
ICD-10-Kriterien (inhaltlich):
Gedächtnisstörung + mindestens ein weiteres kognitives Defizit
Grunderkrankung ist nachweislich vorhanden (z. B. Parkinson, HIV)
Symptome stehen in zeitlichem Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Grunderkrankung
Ausschluss primärer Demenzformen
Hauptsymptome:
Gedächtnisstörungen (oft nicht im Vordergrund)
Denkverlangsamung, Aufmerksamkeitsdefizite
affektive Symptome (Reizbarkeit, Apathie, Depression)
motorische Auffälligkeiten (z. B. Tremor, Rigor bei Parkinson)
reduzierte Selbstständigkeit im Alltag
Verlauf:
abhängig von Grunderkrankung:
Parkinson: schleichend
HIV: schneller, teilweise reversibel bei Therapie
Huntington / CJD: rasant fortschreitend
meist kontinuierliche Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
fast immer
Rückfallquote
keine, da kontinuierliche Progression
Suizidrate
erhöht, v. a. bei früher Krankheitseinsicht (z. B. Huntington)
Gefahren:
plötzliche Verschlechterung (z. B. durch Infektion, Medikamente)
Verschlucken, Stürze
soziale Isolation
inadäquate Medikamenteneinnahme
Pflegebedürftigkeit
Komorbiditäten:
Depression
Schlafstörungen
Inkontinenz
Delir bei Infekten
Psychotische Symptome bei Dopamintherapie (Parkinson)
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
Alzheimer-Demenz (F00)
vaskuläre Demenz (F01)
Demenz unbekannter Ursache (F03)
Delir (F05)
Pseudodemenz
Ätiologie / Pathogenese:
Neurodegeneration durch Grunderkrankung:
Parkinson: Lewy-Körperchen in Stammganglien
Huntington: genetisch bedingte Atrophie im Striatum
HIV: virusinduzierte Entzündung im Gehirn
CJD: Prionen → Schwammartige Veränderungen im Gehirn
Neuroanatomie:
variabel je nach Ursache:
Parkinson: substantia nigra, Basalganglien
Huntington: Corpus striatum
CJD: diffuse kortikale Degeneration
HIV: diffuse Atrophie und weiße Substanzveränderungen
Diagnostik / Tests:
MMST, Uhrentest, MoCA
CT/MRT: strukturelle Veränderungen
EEG bei CJD (periodische Wellen)
Liquorpunktion bei HIV/CJD
Genetik bei Huntington
HIV-Test bei Verdacht auf neurokognitive Defizite
Stadien:
Abhängig von Grunderkrankung – bei vielen Formen keine standardisierte Stadieneinteilung möglich.
Typisch:
leichte kognitive Defizite → Einschränkung im Alltag → vollständige Pflegeabhängigkeit
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
direkte neuronale Schädigung durch Erkrankung
Regressive Abwehrmechanismen bei Autonomieverlust
Rückzug, Passivität als Reaktion auf Funktionsverluste
massive Auswirkungen auf Familiensystem und Betreuung
Rechtliche Hinweise für HPP:
Geschäftsfähigkeit oft früh eingeschränkt
Zusammenarbeit mit Betreuer oder Angehörigen erforderlich
genaue Abgrenzung zur Psychose, Delir, Depression notwendig
Therapie nur im Rahmen der eigenen Kompetenz; bei Bedarf Weitervermittlung
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- gezielte Behandlung der Grunderkrankung:
z. B. L-Dopa bei Parkinson, antiretrovirale Therapie bei HIV
- symptomatische Therapie der Demenz (z. B. Memantin)
- Antidepressiva bei Komorbidität
- kognitive Restaktivierung
- strukturierende Gespräche
- Biografiearbeit
- Angehörigenberatung
- Alltag strukturieren helfen
- Psychoedukation zur Erkrankung
- Gespräche zur Verarbeitung der Diagnose
- Motivation zur Therapieadhärenz
F03 – Nicht näher bezeichnete Demenz
Definition:
Eine Demenzform, bei der die diagnostischen Kriterien für spezifische Demenztypen (z.B. Alzheimer, vaskulär) nicht erfüllt sind oder keine eindeutige Ursache festgestellt werden kann. Sie ist eine Ausschlussdiagnose.
Synonyme:
Unklassifizierte Demenz
Demenz unbekannter Ursache
Demenz n.n.b. („nicht näher bezeichnet“)
Zahlen:
Kategorie
Angabe
Epidemiologie BRD
wird häufig gestellt, wenn keine genaue Diagnostik möglich ist
Geschlechterverhältnis
Frauen > Männer
Prävalenz
unbekannt, da uneinheitlich klassifiziert
Lebenserwartung
variabel, je nach tatsächlicher Ursache
Ersterkrankungsalter
meist über 65 Jahre
Zeitkriterien (ICD-10):
Gedächtnisstörungen und andere kognitive Defizite
Einschränkungen bestehen über mindestens 6 Monate
keine eindeutige Ursache erkennbar
ICD-10-Kriterien (inhaltlich):
Symptome entsprechen einer Demenz
Kriterien für Alzheimer, vaskuläre oder sekundäre Demenz werden nicht erfüllt
häufig in Pflegeeinrichtungen oder bei unvollständiger Diagnostik angewendet
Hauptsymptome:
Gedächtnisstörung (v. a. Kurzzeitgedächtnis)
Orientierungsstörung
verlangsamtes Denken
Affektverflachung oder Reizbarkeit
häufig keine neurologischen Begleitsymptome
Verlauf:
oft kontinuierlich progredient
selten stabil
Verlauf schwer prognostizierbar ohne gesicherte Ursache
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
in der Regel ja
Rückfallquote
nicht relevant
Suizidrate
leicht erhöht im frühen Stadium
Gefahren:
Gefahr der Fehldiagnose → inadäquate Therapie
Selbstvernachlässigung
soziale Isolation
Verwirrtheitszustände, Stürze
zunehmende Abhängigkeit von Pflege
Komorbiditäten:
Depression
vaskuläre Risikofaktoren
Delir
somatische Erkrankungen (z. B. Hypothyreose)
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
Alzheimer (F00), vaskuläre Demenz (F01)
Demenz bei Grunderkrankung (F02)
Delir (F05)
depressive Pseudodemenz
chronisches amnestisches Syndrom (F04)
Ätiologie / Pathogenese:
unklare Genese, multifaktoriell vermutet
unzureichende Diagnostik oder atypische Präsentation
mögliche Mischformen (z. B. Alzheimer + vaskulär)
Neuroanatomie:
häufig diffuse kortikale oder subkortikale Veränderungen
oft keine klaren radiologischen Befunde
eventuell milde Hirnatrophie
Diagnostik / Tests:
MMST, Uhrentest, DemTect
CT/MRT zum Ausschluss fokaler Läsionen
Labor: B12, TSH, Elektrolyte
evtl. EEG, Liquoruntersuchung bei klinischer Indikation
oft unvollständige oder verzögerte Diagnostik in der Praxis
Stadien:
Beginn: leichte Vergesslichkeit
Fortschritt: Alltagsprobleme, Affektstörungen
Spätstadium: Pflegebedürftigkeit, körperlicher Abbau
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
neurodegenerative Prozesse unklarer Ursache
unbewusste Konflikte, Reaktion auf Alter, Kontrollverlust
zunehmende Hilflosigkeit → Rückzug, Resignation
Belastung für Familie durch Unsicherheit über Prognose
Rechtliche Hinweise für HPP:
Geschäftsfähigkeit im Einzelfall zu prüfen
oft eingeschränkte Einsichtsfähigkeit → Zusammenarbeit mit Betreuern
bei fehlender Diagnostik ggf. Empfehlung zur Weiterleitung an Fachärzte
keine medikamentöse Therapie durch HPP möglich
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- evtl. Antidementiva (off-label)
- Behandlung komorbider Depression
- Substitution (z. B. B12)
- Biografiearbeit
- Realitätsorientierung
- Strukturierungshilfen
- Angehörigenberatung
- Aktivierende Gespräche
- Alltag strukturieren helfen
- Motivation zu Diagnostik und Therapie
- Krisenintervention bei Überforderung
F04 – Organisches amnestisches Syndrom
Definition:
Eine schwere Störung des Gedächtnisses, insbesondere des Kurzzeit- und Neugedächtnisses, infolge organischer Hirnschädigung. Bewusstsein, Intelligenz und Aufmerksamkeit sind in der Regel erhalten.
Synonyme:
Amnestisches Syndrom
Korsakow-Syndrom (bei chronischem Verlauf, v. a. alkoholbedingt)
Gedächtnisstörung organischer Genese
Zahlen:
Kategorie
Angabe
Epidemiologie BRD
selten, häufig bei chronischem Alkoholismus
Geschlechterverhältnis
Männer > Frauen (häufiger Alkoholabhängigkeit)
Prävalenz
keine genauen Angaben, meist sekundär zu anderen Erkrankungen
Lebenserwartung
abhängig von der Grunderkrankung und Therapie
Ersterkrankungsalter
meist zwischen 40 und 70 Jahren
Zeitkriterien (ICD-10):
Gedächtnisstörung besteht über Wochen oder Monate
kein akutes Delir
Störung ist anhaltend, aber reversibel bei rechtzeitiger Behandlung
ICD-10-Kriterien (inhaltlich):
deutliche Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses
Fähigkeit, neue Informationen zu lernen, ist massiv gestört
häufig Konfabulationen (Auffüllen von Gedächtnislücken mit erfundenen Inhalten)
Aufmerksamkeit und Bewusstsein sind nicht beeinträchtigt
Hinweis auf organische Ursache muss vorliegen (z. B. Mangel, Trauma, Entzündung)
Hauptsymptome:
massive anterograde Amnesie (neue Inhalte können nicht gespeichert werden)
oft auch retrograde Amnesie (Vergangenheit teilweise vergessen)
zeitliche und räumliche Desorientierung
Konfabulationen
Affektverflachung oder Apathie
Verlauf:
abhängig von der Ursache
bei frühzeitiger Therapie teilweise reversibel
bei chronischem Alkoholismus (Korsakow) meist irreversibel
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
häufig bei persistierender Schädigung
Rückfallquote
hoch bei Alkoholursache ohne Abstinenz
Suizidrate
gering, da häufig geringe Krankheitseinsicht
Gefahren:
hohe Pflegebedürftigkeit
Verletzungsgefahr durch Orientierungslosigkeit
Überdosierung von Medikamenten durch Vergessen
soziale Isolation
fehlende Krankheitseinsicht
Komorbiditäten:
Alkoholabhängigkeit
Depression
Polyneuropathie
Leberzirrhose bei Alkoholismus
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
Demenz (F00–F03)
Delir (F05)
dissoziative Amnesie (F44.0)
Schädel-Hirn-Trauma
Enzephalopathien
Ätiologie / Pathogenese:
Thiaminmangel (Vitamin B1) durch Alkoholismus (klassisch bei Korsakow-Syndrom)
Schädel-Hirn-Trauma
Enzephalitis, Tumoren, Hypoxie
Läsionen im limbischen System, v. a. Mamillarkörper und Thalamus
Neuroanatomie:
betroffen: Mamillarkörper, Hippocampus, Thalamus
häufig bilaterale Läsionen im Bereich des limbischen Systems
Läsionen sichtbar im MRT (z. B. symmetrische Veränderungen bei Korsakow)
Diagnostik / Tests:
Anamnese: Alkoholabusus, Trauma, neurologische Vorerkrankungen
Neuropsychologische Tests: massive Merkfähigkeitsstörung
MRT zur Darstellung von Hirnveränderungen
Labor: Vitamin-B1-Mangel, Leberwerte
Ausschluss anderer kognitiver Störungen
Stadien:
keine definierte Stadieneinteilung, aber:
Akutphase:plötzliches Auftreten, ggf. reversibel
Chronische Phase: Korsakow-Syndrom mit bleibendem Gedächtnisverlust
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
organisch bedingte Funktionsstörung im limbischen System
selten relevant, da Erkrankung stark organisch determiniert
Aufbau externer Gedächtnisstützen zur Alltagsbewältigung
Entlastung der Familie durch Information und Strukturhilfen
Rechtliche Hinweise für HPP:
Einwilligungsfähigkeit oft eingeschränkt
häufig fehlende Krankheitseinsicht → Schutzmaßnahmen wichtig
Therapie nur begleitend möglich, keine ursächliche Behandlung durch HPP
Aufklärung über Defizite oft nur begrenzt möglich
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- Hochdosierte Thiamin-Gabe (Vitamin B1)
- ggf. Behandlung von Begleiterkrankungen (Leber, Neuropathie)
- Antidepressiva bei komorbider Depression
- Verhaltenstraining zur Alltagsstruktur
- Biografiearbeit (wenn möglich)
- Gedächtnistraining, Erinnerungsarbeit
- Strukturierung des Alltags mit externen Hilfen (Kalender, Notizen)
- Angehörigenberatung
- Beobachtung auf Selbst- und Fremdgefährdung
- Motivation zur Abstinenz (bei Alkoholursache)
F05 – Delir, nicht durch Alkohol oder psychotrope Substanzen bedingt
Definition:
Ein akuter, meist vorübergehender Zustand mit Störung des Bewusstseins, der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, des Denkens und der Orientierung. Tritt infolge einer organischen Ursache auf (z.B. Infektion, Medikamente, Stoffwechselentgleisung).
Synonyme:
akutes organisches Psychosyndrom
Verwirrtheitszustand
nicht-alkoholisches Delir
Zahlen:
Zeitkriterien (ICD-10):
Plötzlicher Beginn innerhalb von Stunden bis Tagen
Symptome wechseln im Tagesverlauf (meist Verschlechterung abends/nachts)
Dauer: in der Regel Stunden bis wenige Tage (selten länger)
ICD-10-Kriterien (inhaltlich):
Bewusstseinsstörung (Reduktion von Aufmerksamkeit, Wachheit)
Desorientierung (zeitlich, örtlich, situativ)
Störungen des Denkens, Wahrnehmung (Halluzinationen), Gedächtnis
Psychomotorische Veränderungen: Unruhe oder Lethargie
Nachweis einer organischen Ursache (Infekt, Intoxikation, Stoffwechselstörung)
Hauptsymptome:
plötzliche Verwirrtheit
Halluzinationen (v. a. visuell), Illusionen
Orientierungsstörungen
wechselnde Bewusstseinslage (Dämmerzustand, Benommenheit)
Schlaf-Wach-Rhythmus gestört
motorische Unruhe oder Hypoaktivität
Verlauf:
plötzlich einsetzend
fluktuierend, v. a. tageszeitabhängig
bei Behandlung der Ursache reversibel
unbehandelt → hohe Letalität, Gefahr bleibender kognitiver Defizite
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
selten, aber bei älteren Patienten möglich
Rückfallquote
hoch bei erneutem Auslöser
Suizidrate
gering, aber hohe Mortalität durch Grunderkrankung
Gefahren:
Sturzgefahr durch motorische Unruhe
aggressive Verhaltensweisen
akute Selbst- oder Fremdgefährdung
Fehldiagnosen (z. B. mit Psychose verwechselt)
Pflegeabhängigkeit bei verzögerter Therapie
Komorbiditäten:
Infektionen (Harnwege, Pneumonie)
Demenz
Multimorbidität
Medikamentennebenwirkungen
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
Demenz (F00–F03)
Depression
schizophrene oder affektive Psychose
Intoxikation oder Entzug (F10.4, F10.3)
postiktaler Zustand nach Krampfanfall
Ätiologie / Pathogenese:
akute cerebrale Dysfunktion durch:
Infektionen
Elektrolytstörungen
Nieren-/Leberversagen
Hypoglykämie
Medikamente (v. a. Anticholinergika, Benzodiazepine)
Operationen, postoperativ
Neuroanatomie:
diffuse kortikale Dysfunktion
vor allem Störung im retikulären Aktivierungssystem des Hirnstamms
keine strukturellen Läsionen erforderlich
Diagnostik / Tests:
klinische Beurteilung (plötzlicher Beginn, wechselhafte Symptomatik)
CAM (Confusion Assessment Method) – international standardisiert
MMST nicht aussagekräftig bei akuten Zuständen
Labor: Elektrolyte, CRP, Leber-/Nierenwerte, Glukose
ggf. CT/MRT zur Ausschlussdiagnostik
EKG, O₂-Sättigung, Infektsuche (z. B. Urinstatus)
Stadien:
nicht klassisch eingeteilt, aber unterschieden wird:
hyperaktives Delir: Unruhe, Halluzinationen, Aggression
hypoaktives Delir: Verlangsamung, Apathie, stille Verwirrtheit
gemischtes Delir: wechselnd
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
akute Hirnfunktionsstörung durch metabolische oder toxische Ursachen
kaum relevant, da akut-organisch bedingt
Überforderung durch Reizüberflutung in Klinik/Heim
hohe Belastung für Pflege und Angehörige
Rechtliche Hinweise für HPP:
keine Behandlungskompetenz bei akuten organischen Störungen
Pflicht zur sofortigen Weiterleitung an Arzt/Krankenhaus
ggf. Einschätzung der Selbst-/Fremdgefährdung → Einweisung nach PsychKG möglich
keine eigenständige Diagnose durch HPP zulässig
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- Behandlung der Ursache (Infektion, Stoffwechselstörung)
- Flüssigkeitszufuhr, Sauerstoffgabe
- Antipsychotika bei schwerer Unruhe (z. B. Haloperidol)
- keine Benzodiazepine bei älteren Patienten
- nicht geeignet in der Akutphase
- ggf. postdelirische Nachsorge bei Ängsten oder Erklärungsbedarf
- keine Intervention durch HPP in Akutphase erlaubt
- nach Entlassung: Gesprächsangebote zur Verarbeitung
- Angehörigenberatung: Aufklärung über Delir, Prävention bei Risiko
F06 – Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
Definition:
Psychische Störungen mit eindeutig nachweisbarer organischer Ursache im Gehirn, die nicht unter Demenz (F00–F03), Delir (F05) oder amnestisches Syndrom (F04) fallen. Die Symptome ähneln primär psychischen Erkrankungen, beruhen aber auf organischer Hirnschädigung.
Synonyme:
Organisch bedingte psychische Störung
Sekundäre psychische Störung bei Hirnschädigung
Symptomatische psychische Störung
Zahlen:
Zeitkriterien (ICD-10):
keine expliziten Zeitkriterien
Symptome müssen im Zusammenhang mit einer organischen Hirnerkrankung stehen
keine demenziellen oder deliranten Merkmale im Vordergrund
ICD-10-Kriterien (inhaltlich):
Symptome ähneln psychiatrischen Erkrankungen (z. B. Depression, Wahn, Angst)
Nachweis einer Hirnerkrankung, -verletzung oder Funktionsstörung
zeitlicher Zusammenhang zwischen organischer Störung und psychischen Symptomen
keine bessere Erklärung durch F00–F05
Hauptsymptome:
depressive oder maniforme Zustände
Angstsymptome
Halluzinationen (optisch, akustisch)
Wahnideen
Persönlichkeitsveränderung
Antriebslosigkeit oder Reizbarkeit
Verlauf:
variabel
oft abhängig von der Hirnstruktur und der zugrundeliegenden Erkrankung
potenziell reversibel bei Behandlung der Ursache
Prognose:
Kategorie
Angabe
Chronifizierung
möglich, aber auch reversibel
Rückfallquote
abhängig von Ursache und Therapie
Suizidrate
erhöht bei wahnhafter Depression oder Impulskontrollverlust
Gefahren:
Selbst- oder Fremdgefährdung durch Wahn oder Impulsstörung
Fehldiagnose als primäre psychische Erkrankung → falsche Therapie
soziale Isolation, Pflegebedürftigkeit
Komorbiditäten:
Epilepsie
MS (Multiple Sklerose)
Schädel-Hirn-Trauma
Hirntumoren
endokrine Störungen (z. B. Cushing, Hypothyreose)
Differenzialdiagnosen / Ausschluss:
primäre Depression, Schizophrenie, bipolare Störung
Demenz (F00–F03)
Delir (F05)
Persönlichkeitsstörung (F60 ff.)
Intoxikation/Entzug
Ätiologie / Pathogenese:
strukturelle Läsionen des Gehirns (z. B. Tumor, Trauma, Infarkt)
Entzündliche Prozesse (z. B. Enzephalitis, MS)
Stoffwechselstörungen, endokrinologische Ursachen
postiktale Zustände bei Epilepsie
Neuroanatomie:
je nach Ursache unterschiedliche Lokalisationen
häufig betroffen: Frontalhirn, Temporallappen, limbisches System
MRT oder CT oft mit pathologischen Befunden
Diagnostik / Tests:
gründliche Anamnese (traumatisch, infektiös, medikamentös)
neurologische Untersuchung
MRT / CT zur Darstellung struktureller Veränderungen
EEG (z. B. bei Verdacht auf Epilepsie)
Labor: Leber, Niere, Schilddrüse, Elektrolyte
psychometrische Tests zur Erfassung kognitiver und affektiver Symptome
Stadien:
keine klaren Stadien – Verlauf abhängig von der Grunderkrankung:
akut (z. B. nach Schlaganfall)
schleichend (z. B. bei Tumoren oder MS)
fluktuierend (z. B. bei Epilepsie)
Erklärungsmodelle:
Biologisch
Psychodynamisch
Verhaltenstherapeutisch
Systemisch
klare organische Ursache → z. B. Läsionen, Entzündungen
nicht primär anwendbar, da biologisch determiniert
Symptome als Reaktion auf kognitive Defizite oder körperliche Einschränkungen
soziale Ausgrenzung, Unverständnis für „psychisches Verhalten“ bei organischer Ursache
Rechtliche Hinweise für HPP:
keine Diagnosekompetenz bei organischen Erkrankungen
bei Verdacht → sofortige ärztliche Abklärung
Selbst- oder Fremdgefährdung → ggf. Unterbringung nach PsychKG
begleitende psychotherapeutische Maßnahmen möglich nach Diagnosestellung
Therapie:
Medizinisch, Medikamentös
Psychotherapeutisch
Meine HPP-Interventionen
- Behandlung der Grunderkrankung (z. B. Tumor, MS)
- Antipsychotika bei Wahnsymptomatik
- Antidepressiva bei depressiven Symptomen
- Psychoedukation (nach Diagnosesicherung)
- Umgang mit Angst, Verunsicherung, Realitätsverlust