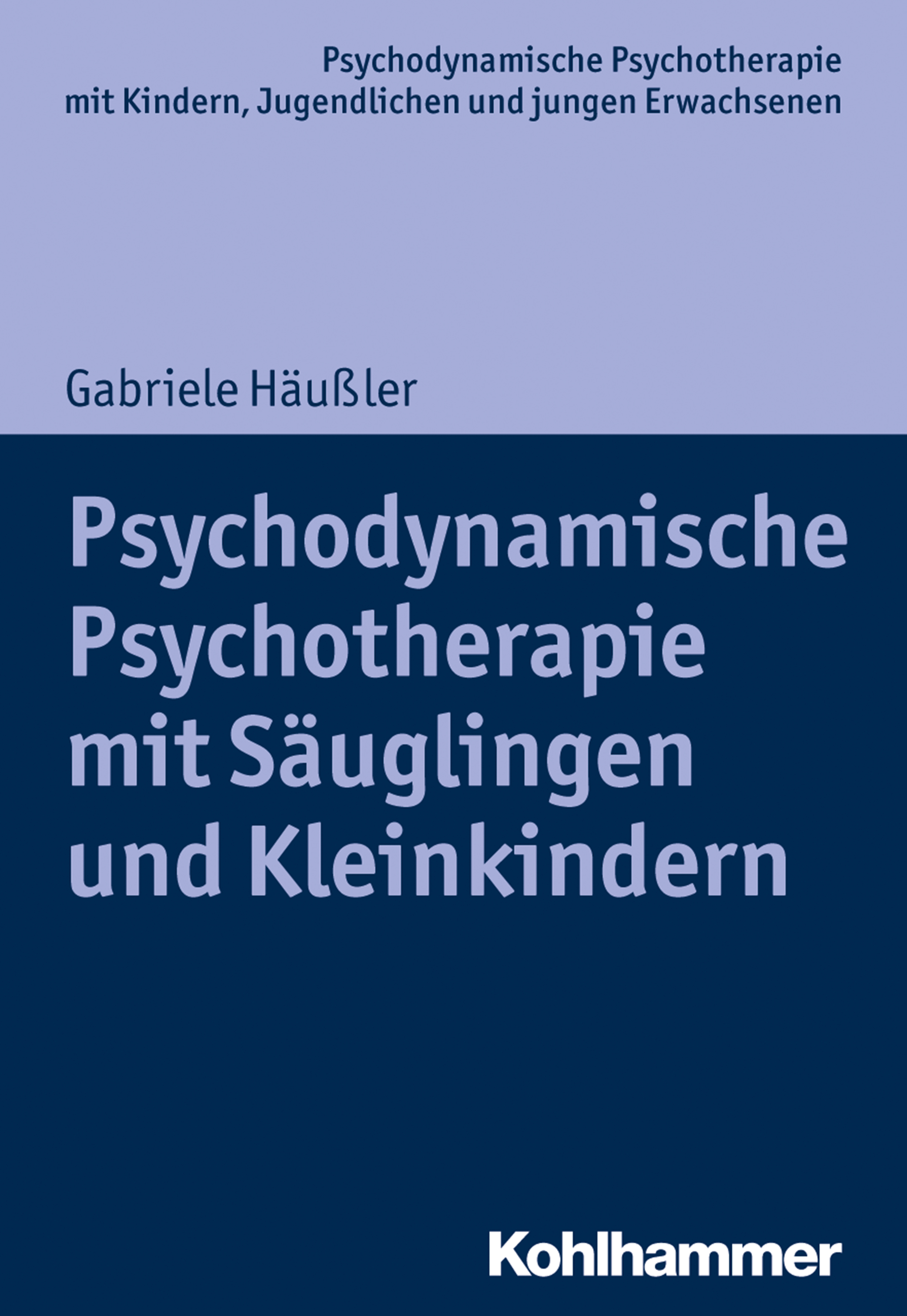
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neben Säuglingsforschung und Bindungstheorie haben insbesondere Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften das Bild vom Säugling und Kleinkind bereichert und frühe Beziehungen in den Blick gerückt. Genetische Anlagen und Umwelteinflüsse interagieren von Beginn an und prägen die Entwicklung von Säugling und Kleinkind. Dadurch hat die psychodynamische Psychotherapie bei Säuglingen und Kleinkindern ein bedeutendes Gewicht bekommen. Das Buch zeigt das Spektrum dieser Therapie unter Einbeziehung der Eltern in ihren gebräuchlichsten Ansätzen und ihrer Methodik auf. Dabei spielen sowohl aktuelle Beziehungen, insbesondere von Mutter-/Vater-Kind, aber auch frühere, transgenerationale Beziehungserfahrungen eine zentrale Rolle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Gabriele Häußler ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in eigener Praxis in Heilbronn, Dozentin am Psychoanalytischen Institut Stuttgart e. V. und am Institut für Psychoanalyse und analytische Psychotherapie Würzburg e. V.; von Juni 2002 bis März 2020 Mitarbeiterin der Psychotherapeutischen Babyambulanz Stuttgart im Psychoanalytischen Institut Stuttgart e. V.; Supervisorin am Psychoanalytischen Institut Stuttgart e. V., am Institut für Psychoanalyse und analytische Psychotherapie Würzburg e. V. sowie am Institut für analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Heidelberg e. V.; Mitherausgeberin und Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift »Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie« (KJP).
Gabriele Häußler
Psychodynamische Psychotherapie mit Säuglingen und Kleinkindern
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2020
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-029867-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-029868-2
epub: ISBN 978-3-17-029869-9
mobi: ISBN 978-3-17-029870-5
Dank
Meine Erfahrungen und mein Wissen, welche in den vorliegenden Band eingeflossen sind, verdanke ich meinen Lehrern des Psychoanalytischen Instituts Stuttgart e. V., meinen Kolleginnen der dortigen Psychotherapeutischen Babyambulanz Stuttgart, den Seminarteilnehmern dieses Instituts sowie des Würzburger Instituts für Psychoanalyse und Psychotherapie (WIPP) e. V., vor allem aber auch meinen Patienten, die mich an ihrem Leben und Leiden teilnehmen ließen.
Ich danke den Herausgebern dieser Buchreihe, Christiane Lutz, Dr. Hans Hopf und Arne Burchartz, dass sie mich mit diesem wichtigen Thema betraut und mir den vorliegenden Band zugetraut haben.
Besonders bedanken möchte ich mich bei Christiane Lutz. Sie hat mein Manuskript konstruktiv betreut. Mit Barbara Hirschmüller konnte ich einige Kapitel besprechen; auch ihr danke ich. Carola Leyh-Rieger danke ich für das Korrekturlesen der Druckfahnen, Alexandra Schäfer habe ich zu danken, wenn ich beim Formatieren am Computer Schwierigkeiten hatte. Schließlich bedanke ich mich bei einer ehemaligen Studierenden des Würzburger Instituts; sie hatte einen Fall zusammen mit mir in Co-Therapie betreut.
Mein Dank geht auch an den Kohlhammer Verlag und da insbesondere an die Lektorin, Frau Kathrin Kastl. Hier danke ich für die Geduld bei der Herausgabe dieses Bandes.
Inhaltsverzeichnis
Dank
Vorwort
1 Das Bild vom Säugling und Kleinkind früher und heute
1.1 Säugling und Kleinkind in der Nachfolge von S. Freud
1.2 Neurowissenschaften und Embodiment-Forschung
1.3 Säugling und Kleinkind unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen
2 Entwicklungsverlauf bei Säuglingen und Kleinkindern von 0–3 Jahren
2.1 Entwicklungsverlauf und Entwicklungsaufgaben der ersten drei Lebensjahre
2.1.1 Schwangerschaft und Geburt
2.1.2 Das Neugeborene und die Bedeutung von Stimme, Geruch, Blick, Hautkontakt
2.1.3 Das erste Lebensjahr
2.1.4 Das zweite Lebensjahr
2.1.5 Das dritte Lebensjahr
2.2 Psychische Entwicklung aus den Blickwinkeln verschiedener Autoren
3 Entwicklungskrisen und -risiken in den ersten drei Lebensjahren
3.1 Reproduktionsmedizin und -technologie und mögliche Risiken und Folgen
3.2 Frühgeburtlichkeit und mögliche Risiken und Folgen
3.3 Entwicklungskrisen und -risiken im ersten Lebensjahr
3.3.1 Exzessives Schreien
3.3.2 Schlafstörungen
3.3.3 Fütter-, Ess- und Gedeihstörungen
3.3.4 Frühkindliche Depression
3.3.5 Frühkindliche Ängste
3.3.6 Störungen der frühen Kommunikation und Bezogenheit
3.3.7 Störungen der Sinnlichkeit und der sich entwickelnden Geschlechtsidentität
3.3.8 Psychosomatische Störungen und psychische Faktoren bei körperlichen Erkrankungen
3.4 Entwicklungsrisiken und -krisen im zweiten Lebensjahr
3.4.1 Trennungs- und Verlustängste
3.4.2 Symbolisierungs- und Mentalisierungsstörungen
3.4.3 Schlafstörungen
3.4.4 Fehlende Objektkonstanz – Defizite in der Bindung – Unfähigkeit allein zu sein
3.4.5 Wut- und Trotzanfälle
3.4.6 Vorzeitige Progression
3.5 Entwicklungskrisen und -risiken im dritten Lebensjahr
3.5.1 Angst vor Autonomie- und Liebesverlust und vor Bloßstellung
3.5.2 Kastrationsangst
3.5.3 Spielstörung
3.5.4 Häufige Verletzungen
4 Diagnostik bei Säuglingen und Kleinkindern und deren Müttern
4.1 Beobachtende Methoden
4.2 Testverfahren und Screenings
4.3 Diagnostik bei peri- und postpartalen Krisen
5 Psychodynamische Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie
5.1 Behandlungsspektrum/Indikation
5.1.1 Symptomatik des Säuglings/Kleinkindes
5.1.2 Symptomatik der Mutter/des Vaters
5.1.3 Symptomatik bei Schwangeren
5.2 Indikation und Ziele
5.3 Das Setting
5.3.1 Im Vorfeld der Behandlung
5.3.2 Die Sitzung
5.3.3 Der Behandlungsraum
5.4 Die Technik
5.4.1 Die Signale des Kindes und die Inszenierung
5.4.2 Das Container-Contained-Modell von Bion
5.4.3 Das Aufspüren von Gespenstern im Kinderzimmer
5.4.4 Die Bedeutung von Blick, Mimik und Gestik
5.4.5 Die Bedeutung von Sprache
5.4.6 Der Fokus
5.4.7 Behandlung durch zwei Psychotherapeuten
5.5 Der Zeitpunkt psychodynamischer Psychotherapie bei Säuglingen und Kleinkindern
6 Wirkfaktoren der psychodynamischen Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie
6.1 Säuglinge und Kleinkinder als eigenständige Teilnehmer
6.2 Die »Gute-Großmutter-Übertragung«
6.3 Das Containment
6.4 Die nicht-lexikalen Aspekte von Sprache
6.5 Das triadische Beziehungsfeld
6.6 Prävention
7 Voraussetzungen für die Durchführung der psychodynamischen Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie
7.1. Säuglingsbeobachtung
7.1.1 Im Vorfeld der Säuglingsbeobachtung
7.1.2 Das Beobachten
7.1.3 Das Beobachtungsprotokoll
7.1.4 Das Seminar und die Seminargruppe
7.1.5 Eine Chance für die Familie
7.1.6 Säuglingsbeobachtung auf der Frühchenstation
7.2 Das Erlernen grundlegender Essentials und Methoden der psychodynamischen Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern
7.2.1 Fort-/Weiterbildung an psychoanalytischen Ausbildungsinstituten
7.2.2 Curriculare Weiterbildung in Eltern-, Säuglings- und Kleinkind-Psychotherapie an der International Psychoanalytic University (IPU) Berlin
7.2.3 Weiterbildungsstandards der GAIMH
7.3 Supervision/Intervision und Fortbildung
8 Wirksamkeitsforschung
9 Nützliche Internetadressen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Eine 68-jährige Patientin, die an einem Wirbelsäulensyndrom leidet, berichtet mir folgenden Traum: »Ich falle, ich falle unendlich tief. Der Aufprall wird hart sein – ich bin ein ungewolltes Kind.« Der Aufprall war hart während der ersten Lebensjahre, da die Eltern nicht in der Lage waren, auch nur annähernd so etwas wie Containment zu gewährleisten, waren sie doch selbst »fallengelassene Kinder«.
Eine andere Frau ähnlichen Alters, geboren kurz nach dem Ende des zweiten Weltkrieges erzählt: »Im Alter von 2–3 Monaten musste mich meine Mutter wegen einer Ernährungsstörung in die Kinderklinik bringen. Dort lag ich mehrere Monate, isoliert hinter einer Glasscheibe. Ich konnte nicht gesund werden, hatte ständig schwere Infekte, konnte keine Nahrung behalten, nahm kontinuierlich ab. Meine Mutter, die verzweifelt fast täglich kam, durfte mich nur durch diese Glasscheibe sehen. Dies dauerte an, bis eines Tages mein Vater meinte: Wenn ich unser Kind jetzt nicht aus der Kinderklink hole, stirbt es noch.« Der Vater musste unterschreiben, um den schwerkranken Säugling aus der Klinik nach Hause holen zu können. Dort konnte das Baby langsam gesund werden, blieb aber die nächsten Jahre infektanfällig. Später war es über lange Zeit hinweg ein trauriges Kind, das nicht lernen wollte und konnte. In der Jugendzeit erlebte sich das Mädchen als depressiv – bis es im späteren Alter, als erwachsene Frau, alles bearbeiten konnte, ähnlich der zuerst genannten Frau.
Beide Frauen, heute im Seniorenalter, haben überlebt und ihr frühkindliches Schicksal so gut sie konnten transformiert. In der heutigen Zeit geboren, wären ihre Bedingungen anders gewesen und es hätte ihnen möglicherweise einiges Leid erspart werden können, denn heute gibt es für unter schwierigen Bedingungen geborene Säuglinge und Kleinkinder vielfältige Möglichkeiten, frühe Traumata zu bearbeiten und aufzulösen, sodass späteres Leiden vermieden werden kann. Es ist erstaunlich, dass es noch Jahrzehnte dauern musste, bis in Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur, Erziehung und auch in der Psychotherapie dem Säugling und dem Kleinkind in seinen Kompetenzen, aber auch in seiner Vulnerabilität, mehr Beachtung geschenkt wurde. Und dies, obgleich schon Friedrich II., der Hohenstaufenkaiser aus Apulien, bei seinen fürchterlichen Experimenten mit Säuglingen im 13. Jahrhundert im Zuge seiner wissenschaftlichen Suche nach der Sprache des Menschen festgestellt hatte, dass Säuglinge ohne Zuwendung und Beziehung nicht überleben können. Alle Säuglinge, die damals von ihren Müttern getrennt und von fremden Ammen gestillt wurden, die aber keinerlei Beziehung zu ihnen herstellen durften, starben. So sind vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Millionen Kinder gestorben, entweder real oder psychisch, weil niemand ihnen liebevoll begegnete.
Der Religionsforscher, -philosoph und Schriftsteller Martin Buber hat mit seiner Schrift »Ich und Du« (1923) die Aussage getroffen, dass menschliches Leben – und ich denke, das gilt erst recht für das vulnerable vorgeburtliche und frühgeburtliche Leben sowie das Leben des Säuglings und Kleinkindes – für Wachstum und Reifung das Du, ein Gegenüber, den Anderen benötigt. Diese von Buber bereits in den 1920er Jahren getroffene Aussage durchzieht die aktuelle psychodynamische Psychotherapie bei Säuglingen und Kleinkindern wie ein roter Faden. In der psychodynamischen Psychotherapie bei Säuglingen und Kleinkindern – häufig wird sie auch Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie oder Eltern-Säuglings-Therapie genannt – spielt Beziehung eine bedeutende Rolle: So geht es um die Beziehung Mutter-/Vater-Kind, um die Kind-Eltern-Beziehung, um die Beziehung Kind-Therapeut und die Beziehung Mutter-/Vater-Therapeut, um aktuelle Beziehungen und auch um alte, frühere, transgenerationale Beziehungen. Immer ist die Ich-Du-Beziehung oder -Begegnung ein wichtiges Thema.
Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in der Regel die neutrale bzw. männliche Form verwendet. Diese gilt für alle Geschlechtsformen (weiblich, männlich, divers).
1 Das Bild vom Säugling und Kleinkind früher und heute
Es war das Verdienst von Sigmund Freud, das Phänomen Kindheit und damit die Rolle und die Beziehungen des Säuglings und Kleinkindes zu erforschen und daran seine Theorie zu validieren. Seine Lehre über psychosexuelle Entwicklungsstufen enthielt Annahmen zu seelischen Erkrankungen und deren Ursachen. Kleine Kinder hat Freud nach der Begründung der Psychoanalyse eher nur zufällig beobachtet. Eine seiner bekanntesten Kleinkindbeobachtungen findet sich in »Jenseits des Lustprinzips« (Freud, 1920), wo er das Garnrollenspiel seines eineinhalb Jahre alten Enkels Ernest schildert. W. Ernest Freud hatte mit Hilfe einer Garnrolle das Verlassenwerden durch die Mutter bewältigt. W. Ernest Freud wurde später, wie er es selbst in seinem Buch »Remaining in Touch« ausdrückte, »psychoanalytischer Frühchenforscher« (2003, S. 21). Er hat in dieser Funktion in Deutschland in einer bekannten Neonatologie gearbeitet und bedeutende Beiträge zur psychoanalytischen Säuglingsforschung publiziert. Bereits 1916/1917 vertrat W. E. Freud die Meinung, dass der kleine Mensch oft mit dem vierten und fünften Lebensjahr schon fertig entwickelt sei und später nur das zum Vorschein bringe, was bereits in ihm stecke.
1.1 Säugling und Kleinkind in der Nachfolge von S. Freud
Später hat Bernfeld, der »Urvater einer systematischen psychoanalytischen Beschäftigung mit dem Säugling« (Dornes, 1993, S. 12f.) in seiner »Psychologie des Säuglings« (1925) das damalige Wissen über Säuglinge und Kleinkinder zusammengefasst und mit Hypothesen aus der Psychoanalyse verglichen. Ab Beginn der 1940er Jahre haben dann René Spitz, Margarete Mahler, Peter Wolff u. a. durch Direktbeobachtung weiter geforscht. Durch René Spitz, der den emotionalen Austausch zwischen Mutter und Kind systematisch beobachtete, dokumentierte und beschrieb, rückte der Säugling nicht nur für Psychoanalytiker und Psychotherapeuten, sondern ebenso für Mütter und in der Säuglingspflege Beschäftigte in den Fokus. Spitz sah seine Studie vor dem Hintergrund des von S. Freud in den »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie« (Freud, 1905) dargelegten Begriffssystems. Wahrnehmungsforschungen zeigten auf, dass die Sinne bereits in der pränatalen Zeit in differenzierter Weise funktionieren. Dennoch wurde vom Säugling lange Zeit noch das einseitige Bild eines passiven, hilflosen und abhängigen Wesens kolportiert. Es sollte noch einige Zeit dauern, bis eine veränderte Sicht auf die ersten Lebensjahre die psychoanalytische Theorie ergänzte.
Auch Mahler hat die Sicht des passiven, undifferenzierten Säuglings beibehalten, wenn sie beim Neugeborenen von einem autistischen Säugling sprach, der innere von äußeren Reizen nicht unterscheiden könne, sich für äußere Reize auch nicht interessiere und keine getrennte Wahrnehmung von sich und seinem Primärobjekt habe. Später wurde dieses Konzept – nicht zuletzt auch von Mahler selbst und ihren Anhängern – unter dem Eindruck der Säuglingsforschung aufgegeben. Auch das Konzept einer symbiotischen Phase von Mahler et al., wonach der 2–4 Monate alte Säugling die Umwelt nur verschwommen wahrnehme und seine Interaktionen mit dem Primärobjekt undifferenziert und passiv seien, gilt heute als überholt. Dagegen hat jedoch ihre Theorie über die Entwicklung von Loslösung und Individuation einen bedeutenden Stellenwert eingenommen und auch behalten.
Immer mehr rückten im Rahmen der Objektbeziehungstheorie (Melanie Klein, Donald D. Winnicott, Sandor Ferenczi, Michael Balint u. a. und noch später Wilfred Bion) die Mutter-Kind-Beziehung und deren Konflikte in den Fokus der Aufmerksamkeit. Insbesondere die Theorien von Winnicott, Klein und Bion wurden vielfach rezipiert. Sie haben Wesentliches zum heutigen Bild des Säuglings und Kleinkindes beigetragen. Auch die 1948, auf Initiative des Bindungsforschers John Bowlby, von Esther Bick am Tavistock Centre in London entwickelte Säuglingsbeobachtung verbreitete sich. In der Folge hat das Beforschen der frühen Kindheit nicht nachgelassen und es entstanden, je nach »Schulen«-Richtung, verschiedene psychoanalytische Theoriemodelle. So entwickelten die Triebpsychologie, die Ich-Psychologie, die Objektbeziehungspsychologie und die Selbstpsychologie unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Sicht des Säuglings und Kleinkindes und deren frühen Beziehungen. In den 1960er und 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde dann mit dem Kampf der Frauen für Gleichberechtigung auch das Thema »Säugling« neu in den Blickpunkt gestellt, als über Geburtenkontrolle, Verhütungsmittel, natürliche Geburt und Rooming-in reflektiert und diskutiert wurde.
Angestoßen durch empirische Forschungen und wissenschaftliche Erkenntnisse in den USA entstand auch im deutschsprachigen Raum in der Folge ein Wechsel hin zu neuen Denkmustern und Lehrmeinungen, die die früheren entwicklungspsychologischen und psychoanalytischen Annahmen veränderten. Stufen- und Phasenmodelle sowie lineare Entwicklungsmuster traten zugunsten der Bedeutung der Affekte und der unbewussten psychischen Aktivität in den Hintergrund. So resümiert Dornes (1993, S. 100f.) in seinem bahnbrechenden Buch »Der kompetente Säugling«, dass Selbst und Objekt im ersten Halbjahr nicht undifferenziert und verschmolzen seien. Er hält auch die Theorie der Teilobjekte und Teilselbste zwischen 6 und 18 Monaten für problematisch. Dornes beruft sich auf die Theorien von Daniel Stern, deren Kern (anstatt symbiotischer Verschmelzung) die Tatsache stattfindender Gemeinschaftserlebnisse von Mutter und Kind ist (Dornes, 1993), in denen das Gefühl für die Grenze zwischen Selbst und Objekt erhalten bleibt. Neben diesem »Erleben des Miteinander« sieht Dornes – gleichberechtigt – auch noch andere Formen des Beziehungserlebens.
Bereits früh (1993) trat Martin Dornes mit seinem Buch »Der kompetente Säugling« mit einer veränderten Sicht des Säuglings, der ihm zufolge aktiv, differenziert und beziehungsfähig ist, in einen interdisziplinären Dialog ein, wodurch die Säuglings- und Kleinkindforschung und deren Ergebnisse in den letzten 20–25 Jahren zunehmend an wissenschaftlicher Akzeptanz und Beachtung in der Öffentlichkeit gewann. Dabei spricht sich Dornes sehr für die direktbeobachtende Säuglingsforschung aus, um zutreffendere Aussagen über die Entwicklung des Säuglings zu machen als die Aussagen der rekonstruktiv verfahrenden psychoanalytischen Entwicklungspsychologie, die nicht objektiv darzustellen vermag, wie die Kindheitsentwicklung tatsächlich verläuft. Damit wandte sich Dornes auch gegen einen adultomorphen und pathomorphen Mythos des Säuglings (Dornes, 1993).
Mit Dornes erhielt die Diskussion über Säuglings- und Kleinkindforschung in ihrer Relevanz für schlussfolgernde Aussagen über das Erleben des Säuglings und Kleinkindes, und damit für die Psychoanalyse, bedeutendes Gewicht. Die Frage, inwieweit sich die Psychoanalyse in einer globalisierten Welt weiterhin einseitig auf die im klinischen Setting beobachteten und gesammelten Daten stützen soll oder ob sie nicht vielmehr zu ihrer Weiterentwicklung auf den Dialog mit Nachbardisziplinen angewiesen ist, kann mittlerweile mit einer an Ansehen gewonnenen Säuglings- und Kleinkindforschung positiv beantwortet werden. So finden die Ergebnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung auch in der psychodynamischen Psychotherapie Aufmerksamkeit und können in der Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie nicht außer Acht gelassen werden. Zeitgemäße Ansätze, wie sie beispielsweise die Autoren der Intersubjektivität (Benjamin, Gergely, Dornes) vertreten, sind zu berücksichtigen und zu integrieren. Dornes versteht unter Intersubjektivität »die Beziehung zweier Subjekte, in der die Subjektivität beider, also ihr Denken, Fühlen und/oder ihre nicht-instinkthaften expressiven Äußerungen Gegenstand wechselseitiger Reaktionen oder Antworten sind«, und er betrachtet den Säugling vom zweiten Lebensmonat an als intersubjektiv (Dornes, 2010, S. 105). Auch das Konzept der Mentalisierung nach Fonagy, Target und Gergely (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2006) fand Eingang in psychodynamisches Denken.
Einer der führenden Vertreter der modernen Säuglings- und Kleinkindforschung war Daniel Stern. Ihm gelang es, vorsprachliches Erleben in Sprache zu fassen. Im Mittelpunkt seiner Forschungen stand das Selbstempfinden und dessen Entwicklung, aus dem heraus der Säugling sich selbst und seine Umwelt wahrnimmt und ordnet. Stern beschreibt in seinem bedeutenden Buch »Die Lebenserfahrung des Säuglings« vier Stufen in der Entwicklung des Selbstempfindens (1992 [1986], S. 61ff.): das auftauchende Selbstempfinden (0–2 Monate), das Kernselbstempfinden (2–3 und 7–9 Monate), das subjektive Selbstempfinden (7–9 und 15–18 Monate) und das verbale Selbstempfinden (15–18 Monate).
1.2 Neurowissenschaften und Embodiment-Forschung
In den letzten 10–20 Jahren hat sich der interdisziplinäre Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften gegenseitig befruchtet, ergänzt und bekam neue Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit sowie in den Medien. Für viele Autoren, u. a. auch den Nobelpreisträger für Neurobiologie, Eric Kandel, ist dadurch eine Vision Freuds (1895), nämlich dass die Erkenntnisse der Psychoanalyse sich mit naturwissenschaftlichen Methoden belegen lassen, zur Wirklichkeit geworden.
Die Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften haben insbesondere auch das Bild vom Säugling und Kleinkind verändert und ergänzt. Durch die Entwicklung neuer, hirnbildgebender Untersuchungsverfahren haben die Neurowissenschaften zu einem erweiterten Verständnis der frühen Entwicklung beigetragen und eine Reihe psychoanalytischer Grundannahmen belegt, wie beispielsweise die Verarbeitung von Wahrnehmungseindrücken im Hirnstamm und im limbischen System, die Bedeutung der Affekte und die Entdeckung der Spiegelneuronen (Wiegand, 2012). Spiegelneuronen sind »das neuronale Format für eine frühe, basale Form der Kommunikation und wechselseitigen sozialen Einstimmung, ohne die es für Säuglinge nicht nur keinen Zugang zur Welt, sondern auch später kein intuitives Gefühl der wechselseitigen Intuition geben könnte« (Bauer, 2008, S. 119). Insbesondere die Objektbeziehung erhielt durch die Neurowissenschaften eine Aufwertung ihrer Bedeutung.
Wenn die frühe emotionale Beziehung zwischen Kind und primärer Bezugsperson die psychische Entwicklung des Kindes deutlich beeinflusst, spielen hierbei nicht nur Umweltfaktoren (beispielsweise die mütterliche Sensitivität und Empathiefähigkeit) eine prägende Rolle, sondern auch genetische Dispositionen. Roth spricht in diesem Zusammenhang, unter Berufung auf Goodman und Gotlib, von vier Faktoren, die zum Tragen kommen: a) genetische Faktoren, b) bei der Geburt bereits vorhandene, also auf vorgeburtliche Einflüsse des mütterlichen Gehirns und Körpers zurückgehende Faktoren, c) frühkindliche Einflüsse über beispielsweise negative emotional-affektive Verhaltensweisen von Beziehungspersonen und schließlich d) mit Stress behaftete Ereignisse in der frühen Kindheit wie beispielsweise Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch (Roth, 2016).
Roth und Strüber (2012) erwähnen zudem Neuromodulatoren, deren Zusammenspiel in speziellen Hirnzentren zur Ausbildung von sechs neurobiologisch-psychischen Grundsystemen führen – einem Stressverarbeitungssystem, einem Selbstberuhigungssystem, einem Selbstbewertungs- und Motivationssystem, einem Impulskontrollsystem, einem Bindungs- und Empathiesystem und einem Realitäts- und Risikowahrnehmungssystem. Diese sechs neurobiologischen Grundsysteme interagieren auf drei limbischen und einer kognitiven Ebene und führen zur psychischen Entwicklung. Genetische Veranlagung, der Verlauf der Hirnentwicklung, prägende vorgeburtliche und frühe nachgeburtliche Umweltvariablen sowie die weitere psychosoziale Erfahrung im Säuglings- und Kleinkindalter beeinflussen die Ausbildung dieser Grundsysteme, die »ein weitverzweigtes Gerüst hochredundanter Verschaltungen zwischen den Nervenzellen« (Roth & Strüber, 2012, S. 16) darstellen, deren Muster sich in Abhängigkeit der Aktivität von Synapsen verfeinern. Diese Verfeinerung führt zur Stabilisierung aktiver und zur Eliminierung nicht aktiver Synapsen, was eine Reduzierung der Verschaltungen zwischen den Nervenzellen zur Folge hat. So können beispielsweise, wie Roth und Strüber aufzeigen, frühe soziale Erfahrungen oder deren Abwesenheit einen bedeutenden Einfluss auf »die neuronale Verschaltung, die »Einstellung« der sechs Grundsysteme und somit auf die psychische Entwicklung haben« (Roth & Strüber, 2012, S. 16). Ein störungsfreier Entwicklungsverlauf führt somit zu Risiko- und Gefahrenquellenkenntnis, zu situationsangemessener Auf- und Abregung, zum Besitz angemessener Frustrationstoleranz, zu längerfristigem Leistungs- und Zielorientierungsvermögen, zu emotionaler Impulskontrolle und letztendlich zu gutem Bindungspotential und Empathiefähigkeit. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse zeigt die Neurowissenschaft, dass sowohl genetische Anlagen als auch Umwelteinflüsse untrennbar zusammenwirken, sich quasi in einer »Gen-Umwelt-Interaktion« (Wiegand, 2012, S. 30) befinden, wobei besonders die früh erlebten Stresserfahrungen im Körpergedächtnis gespeichert werden und die Aktivität der Gene steuern.
Bereits beim Neugeborenen sind die Möglichkeiten neuronaler Verschaltungen ebenso hoch wie beim Erwachsenen und die Synapsen nehmen in den ersten drei Lebensjahren sogar doppelt so schnell zu wie beim Erwachsenen, wobei nur diejenigen synaptischen Verbindungen, die auch benutzt werden, erhalten bleiben und sich verstärken, wohingegen nicht benötigte Synapsen abgebaut werden (Wiegand, 2012). Auch nach Stern (2011) werden Körperempfinden, Gefühle, Einstellungen und Reaktionen durch unterschiedliche Erregungsmuster, die sich in bestimmten Gehirnregionen und -prozessen aufzeigen lassen, geprägt und führen in der frühen Entwicklung zur Bildung individueller Muster, auf Reize zu reagieren, sich aktivieren und motivieren zu lassen. So korrespondieren die Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften nicht nur mit den Forschungen von Stern, sondern ebenso mit der bereits von Anna Freud (1965) dargestellten Sichtweise, dass die psychische Struktur einerseits aus sukzessiven Interaktionen zwischen biologisch und genetisch determinierten infantilen Entwicklungssequenzen und andererseits aus Erfahrungs- und Umwelteinflüssen hervorgeht.
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass nachteilige frühe Erfahrungen, beispielsweise ein dyadisches Eintauchen mit einer depressiven oder einer sehr unsicheren, angstvollen Mutter oder andere nicht optimale Beziehungserfahrungen, erheblichen Einfluss auf neuronale Verschaltungen und deren Erhalt sowie auf die früh entstehenden und früh beeinflussbaren limbischen Ebenen haben. Gerade die Auswirkungen des Interaktionsverhaltens depressiver Mütter mit ihren Säuglingen sind inzwischen klinisch wie empirisch gut beforscht (vgl. Stern, 1992, Beebe & Lachmann, 2004, Feldmann, 2012, Rutherford & Mayes, 2013).
Auch bestimmen frühe Interaktionserfahrungen »als ›embodied Erinnerungen‹ die weitere Entwicklung und die spontanen (nicht kognitiven) Erwartungen und unbewussten Interpretationen neuer Interaktionssituationen« (Leuzinger-Bohleber, Böker, Fischmann, Northoff & Solms, 2015, S. 32). Unter »Embodiment« verstehen Leuzinger-Bohleber & Pfeifer (2015) das Triggern genetischer Anlagen des Säuglings durch frühe Beziehungserfahrungen, die sich im Körper niederschlagen. Embodiments »bilden die Basis für die weitere psychische und somatische Entwicklung«; sie wirken sich auf »späteres Denken, Fühlen und Handeln« aus (Leuzinger-Bohleber & Pfeifer, 2015, S. 158). So besteht, wie Leuzinger-Bohleber vielfach ausgeführt hat, eine enge Verbindung zwischen Embodiment und frühen Entwicklungsprozessen. Gerade durch die interdisziplinären Forschungen zum Embodiment ist deutlich geworden, wie vulnerabel einerseits, aber auch plastizid andererseits, die frühen Lebenswochen und -monate des Säuglings sind. So schlagen sich nach neueren empirischen und neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen (Rutherford & Mayes, 2013) die frühen »embodied« Interaktionserfahrungen mit den Primärobjekten sowohl im Körper als auch im Gehirn nieder und prägen das Stressregulationssystem. Zwar sind Eltern zunächst neurobiologisch sehr gut auf die Aufgaben der frühen Elternschaft vorbereitet, doch zeigen viele Studien, dass insbesondere die Fähigkeit zur Empathie äußerst störanfällig ist (Leuzinger-Bohleber & Rickmeyer, 2016). Überforderung und Stress, Unsicherheit und Ängste sowie Depression führen dazu, dass Eltern den empathischen Zugang zu ihrem Säugling wie auch zu sich selbst verlieren.
All diese Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der Embodiment-Forschung verlangen bei frühen defizitären und/oder ungünstigen emotionalen Umweltvariablen, wie beispielsweise Traumatisierung oder das Aufwachsen mit einer unsicheren, ängstlichen oder depressiven Beziehungsperson, nach frühen Interventionen, wie sie die psychodynamische Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie anbietet.
1.3 Säugling und Kleinkind unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen
Zu der Zeit, als S. Freud die Psychoanalyse entwickelte und vorantrieb, herrschten bei relativ klaren Werten und Normen übersichtliche Familienstrukturen. Religion und Moral hatten zu einem anerkannten und verbindlichen Wertesystem geführt, das nicht zuletzt auch Sicherheit und Halt bot. So wuchsen der Säugling und das Kleinkind unter traditionellen Bedingungen, optimalerweise in Halt, Anerkennung, Sicherheit und Anleitung gebenden Familiensystemen, auf. Allerdings erfreute sich in den Nachkriegsjahren auch die durch den Nationalsozialismus gefärbte Eltern-Ratgeberliteratur großer Beachtung, in der Eltern das Bild eines unersättlichen, in seinen Bedürfnissen unkontrollierbaren Säuglings suggeriert und ihnen geradezu empfohlen wurde, dem »tyrannischen« Säugling und Kleinkind mit Abhärtung, Strenge und Empathieverweigerung zu begegnen (Kuchinke, 2014). In den späten 1960er Jahren änderte sich dies.
Veränderte gesellschaftliche Bedingungen, neue Frauen-, Mütter- und Elternbilder sowie der Wandel von der Groß- und Mehrkindfamilie zur Kleinfamilie mit Einzelkind- und Patchwork-Familien-Situation führten dann im ausgehenden letzten Jahrhundert zu veränderten familiären Strukturen bis hin zu sogenannten Regenbogenfamilien. Durch das Aufwachsen meist ohne Geschwister ist das Einzelkind in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit seiner Eltern gerückt und fordert diese Aufmerksamkeit von seinen meist beruflich engagierten, einerseits um Flexibilität, Effizienz und Optimierung bemühten, andererseits der Effektivität, Innovation und Beschleunigung unterliegenden und dadurch auch Schuldgefühle kompensierenden Eltern ein (Haubl, Dammasch & Krebs, 2009). Unter sozial und psychisch möglichst optimalen Bedingungen geboren, wurden der Säugling und das Kleinkind in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu etwas Besonderem, nicht selten auch, »im Sinne eines Selbstobjekts« (Ludwig-Körner, 2014, S. 12), zu einem wichtigen Teil seiner Eltern. Wie Albert-Horzetzky (2017, S. 508) unter Berufung auf King (2013) schreibt, »scheint die libido-narzisstische Besetzung des ›Projektes Kind‹« zugenommen zu haben«.
Aktuell wachsen Säuglinge und Kleinkinder in sehr unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens auf. Und sie treffen auf Flexibilität und Beschleunigung fordernde gesellschaftliche Strukturen und Zeitphänomene. Säuglinge und Kleinkinder befinden sich jedoch in einer Situation körperlicher und emotionaler Bedürftigkeit und Abhängigkeit. Sie haben andere Rhythmen, ein anderes Zeitempfinden und unterliegen einer ganz eigenen Zeitlogik, die sich nicht unbeschadet beschleunigen und flexibilisieren lässt (King, 2013). Dies erzeugt in den jungen Familien – meist unvorbereitet – Konflikte zwischen der Notwendigkeit, einerseits die Bedürftigkeit und Abhängigkeit des Nachwuchses zu akzeptieren und ihm die für die zu entwickelnde Beziehungsfähigkeit erforderliche Fürsorge zukommen zu lassen, und andererseits den gesellschaftlichen Bedingungen von Flexibilität, Beschleunigung und Optimierung (Albert-Horzetzky, 2017) nachzukommen.
Die Bedeutung, ein eigenes Kind zu haben, Mutter/Vater zu werden, hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Veränderte Rollenbilder, selbstbestimmte Familienplanung und der Fortschritt in der Medizin haben dazu geführt, dass immer mehr Frauen erst spät ein erstes Kind bekommen – oftmals jenseits des 40. Lebensjahres. Hinzu kommt, dass die heutige eher technisierte Geburtsmedizin gerade diesen älteren Erstgebärenden komplizierte Pränataldiagnostiken empfiehlt, was zu zahlreichen Ambivalenzen gegenüber dem noch ungeborenen Kind führt und die Entwicklung eines emotionalen Raumes in der frühen Mutter-Kind-Einheit erschweren kann. Auch Kaiserschnittgeburten haben – gerade bei älteren Erstgebärenden – deutlich zugenommen und nehmen Mutter und Kind die Erfahrung einer gemeinsam gestalteten und erlebten »ersten Trennung« mit der Geburt. Traumatische Geburtserfahrungen, deren Anzahl bei älteren Müttern erhöht sein dürfte, können, wie aus Statistiken von Säuglingsambulanzen hervorgeht, die frühe Mutter-Kind-Homöostase färben und beeinträchtigen.
Deutlich gestiegen ist auch, durch die Entwicklung der Reproduktionsmedizin, die Bedeutung künstlicher Befruchtung, Eizellschwangerschaften und der Pränatalberatung und -diagnostik bis hin zu der als »Mutter-Embryo-Dialog« konzipierten beziehungskonstituierenden Psychotherapie als Einstieg in eine Schwangerschaft (Auhagen-Stephanos, 2017a, 2017b). Medizinisch-technische Hilfe bei der intimen und emotional besetzten Szene der Zeugung bleibt, wie Lebersorger (2017) und Metzger und Dammasch (2017) aufzeigen, nicht spurlos. Kind und Eltern müssen in der Folge mit komplexen familiären Strukturen fertig werden. Es entwickeln sich – wie beispielsweise bei Adoptiv- und Pflegschaftsverhältnissen auch – besondere Dynamiken. Projektionen unbewusst gebliebener Themen um Schuld, Scham, Verlust und Trauer können in der Säuglings- und Kleinkindzeit die Entwicklung des Sicherheit und Halt bietenden psychischen Raumes erschweren. Da unkonventionelle Partnerschaften zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz gefunden haben, dürfte in Zukunft gerade auch in diesen Lebensformen mit einem Anwachsen der Zahl von durch die Reproduktionsmedizin gezeugten Kindern zu rechnen sein (Oelsner & Lehmkuhl, 2017).
Hinzu kommt, dass die mit den aktuellen postmodernen Strukturen konfrontierten Säuglinge und Kleinkinder häufig einem nahezu unentwegten Wechsel zwischen Familie und außerfamiliärer Betreuung in Krippe oder Tagespflege unterliegen. Die von Winnicott als Basis für eine gesunde seelische Entwicklung proklamierte mütterliche oder väterliche fördernde Umwelt orientiert sich damit nicht mehr an den Bedürfnissen des Säuglings oder Kleinkindes, vielmehr müssen sich der Säugling und das Kleinkind trotz ihrer Hilflosigkeit und psychischen Verletzbarkeit an die auf Ökonomisierung und Beschleunigung ausgerichtete Umwelt anpassen. Außerfamiliäre Betreuung stellt das Thema Trennung mit all seinen expliziten und impliziten Schwierigkeiten und Erfahrungen verstärkt in den Mittelpunkt und – aktuellen neurowissenschaftlichen Forschungen zufolge – auch den Themenkomplex Stress, Stressbelastung und Stressregulation. Säuglinge und Kleinkinder haben jedoch das Recht auf Förderung einer seelisch-körperlichen gesunden Entwicklung und Beziehungsqualität – auch/und besonders in der außerfamiliären Betreuungssituation. Frühe außerfamiliäre Betreuung kann für ein überlastetes Elternpaar ein Segen sein und für den Säugling oder das Kleinkind eine protektive Funktion haben, aber sie kann für das Kind und die Eltern unter dem Aspekt der Trennung auch eine Belastung sein. »Early Life Stress«, so konstatiert Böhm (2013, S. 25), ist eine bedeutsame Hypothek für die körperliche und seelische Gesundheit, und er empfiehlt, die aktuellen gesellschaftlichen Leitbilder von Leistung, Effizienz und Wachstum zu modifizieren, damit sie mit dem kindlichen Wohlbefinden vereinbar sind.
Bei all den aufgezeigten gesellschaftlichen Veränderungen und den zum Teil erschwerten Bedingungen in der heutigen postmodernen Zeit ist in der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie der Grundsatz der »Fähigkeit zum Alleinsein in Gegenwart eines bedeutsamen Anderen« des britischen Kinderarztes und Psychoanalytikers Donald W. Winnicott (1985b) von bedeutendem Wert. Er bildet eine wichtige Voraussetzung für die mentale Fähigkeit, eigene Phantasieräume und Repräsentanzen von Objektbeziehungen zu entwickeln, Beziehungsfähigkeit, Kreativität und Individuierung zu erlangen.
Zusammenfassung
Bereits Sigmund Freud beforschte die Kindheit, indem er die seelischen Erkrankungen der von ihm behandelten Erwachsenen auf psychosexuelle Stufen der Kindheit zurückführte. Im Gesamtwerk Freuds gibt es einige Kleinkindbeobachtungen. Eine der bekanntesten ist die des Garnrollenspiels seines Enkels W. Ernest Freud. In der Nachfolge Freuds haben zunächst einige Forscher durch Direktbeobachtung über Säuglinge geforscht. Vorerst wurde der Säugling noch überwiegend als hilfloses und passives Wesen gesehen. Dieses Konzept wurde sowohl durch neue psychoanalytische Theoriemodelle als auch durch eine veränderte Sicht des Säuglings aufgegeben. Dadurch hat die Säuglings- und Kleinkindforschung in den letzten 20–25 Jahren in den Wissenschaften deutlich an Akzeptanz gewonnen. Bahnbrechender Vertreter der modernen Säuglings- und Kleinkindforschung war Daniel Stern. Er beforschte die Entwicklung des Selbstempfindens und unterteilte diese in vier Stufen. In Deutschland hat Martin Dornes zur Weiterentwicklung der Säuglingsforschung maßgeblich beigetragen. Erfreulich in den letzten 10–20 Jahren war auch der interdisziplinäre Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften. Nicht zuletzt durch diesen Dialog hat sich die Sicht auf den Säugling und das Kleinkind noch einmal verändert und ergänzt. Die Objektbeziehungen mit ihren frühen Interaktionserfahrungen





























