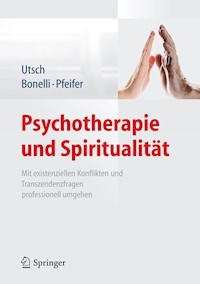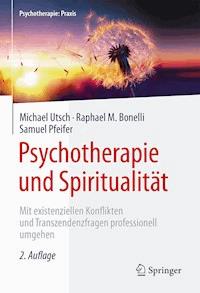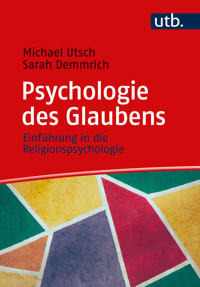
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was gibt dem Leben Sinn und Bedeutung? Die Religionspsychologen Michael Utsch und Sarah Demmrich untersuchen die menschliche Fähigkeit des Glaubens und werten dazu psychologische, psychoanalytische, neurobiologische und sozialpsychologische Befunde aus. Mit diesem Buch legen sie eine aktuelle Einführung in die Religionspsychologie vor. Dabei kommen sowohl erstaunliche Bewältigungskräfte religiöser Tugenden als auch die Schattenseiten wie Fundamentalismus, Fanatismus und Missbrauch zum Vorschein. Die systematisch angelegte und didaktisch aufbereitete Einführung eignet sich auch für benachbarte Studienfächer und ist darüber hinaus für die Selbsterforschung zur eigenen Standortbestimmung geeignet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Foto: Martin Bahr
Prof. Dr. Michael Utsch, Dipl.-Psych., ist Referent der Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Berlin, als approbierter Psychotherapeut niedergelassen und Lehrbeauftragter für Religionspsychologie an verschiedenen Hochschulen und psychotherapeutischen Weiterbildungsinstituten.
PD Dr. Sarah Demmrich, Dipl.-Psych., ist wissenschaftliche Post-doc-Mitarbeiterin am Lehrstuhl Religionssoziologie der Universität Münster und Privatdozentin für Empirische Religionsforschung und Interreligiöse Studien an der Universität Bern.
Michael Utsch und Sarah Demmrich
Psychologie des Glaubens
Einführung in die Religionspsychologie
Vandenhoeck & Ruprecht
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb.de
Mit 63 Abbildungen und 3 Tabellen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2023 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © uze/photocase.de
Umschlaggestaltung: siegel konzeption | gestaltung, Stuttgart
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Elanders Waiblingen GmbH
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
UTB-Band-Nr. 6056
ISBN 978-3-8463-6056-9
Inhalt
Vorwort von Bernhard Grom
Einführung: Warum Religionspsychologie heute bedeutsam ist
Die menschliche Glaubensfähigkeit ist psychologisch relevant
Die innere Glaubenshaltung entspricht nicht unbedingt der formalen Religionszugehörigkeit
Im Fokus: Existenzfragen und Sinnsuche, nicht theologisch verstandener Glaube
Glaube kann in einem Verschwörungsdenken münden – oder Berge versetzen
Zum Aufbau des Buchs
Dank
IGlauben ist menschlich – Religiosität und Spiritualitätaus Sicht der Psychologie
1 Religiosität, Spiritualität – oder Glaube?
1.1 Religiosität, Spiritualität und Glauben
1.1.1 Begriffsbestimmungen
1.1.2 Glaube als zentrales psychologisches Konzept der Religionspsychologie
1.1.3 Verhältnis von Religiosität, Spiritualität und Glaube
1.1.4 Glaube »von innen« und »von außen«
1.2 Die psychologische Messung von Religiosität, Spiritualität und Glaube
1.2.1 Religiositätsskalen
1.2.2 Spiritualitätsskalen
1.2.3 Die psychologische Erfassung der menschlichen Glaubensfähigkeit
1.3 Psychologische Auswirkungen der Glaubensfähigkeit
2 Existenzielle Krisen, Sinnhaftigkeit und »gläubige« Antwortversuche
2.1 Existenzielle Krisen und Sinnsuche
2.2 Spirituelle Krise
2.3 Gläubige Sinngebung kann existenzielle Fragen beantworten
2.4 Sinnfragen in der psychologischen Beratung und der Psychotherapie
2.4.1 Sinnfragen aufseiten der Therapeutinnen und Therapeuten
2.4.2 Sinnfragen aufseiten der Klientinnen und Klienten
2.4.3 Innere Stellungnahme zur Bewältigung existenzieller Krisen
2.4.4 Die Glaubensdimension der Bewältigung existenzieller Krisen
3 Glaube kann die Todesangst reduzieren
3.1 Todesangst und ihre Bewältigung durch Glaubensvorstellungen
3.2 Exkurs: Anthroposophie und Nahtodforschung
3.3 Psychologische Ansätze zur Bewältigung der Todesangst
3.4 Der Glaube kann Todesangst schüren oder mildern
3.5 Glaube in der Palliativmedizin und Glaubensbedürfnisse Sterbender
II Außenperspektiven: Glaube aus psychologischer Sicht
4 Evolutions- und neuropsychologische Zugänge
4.1 Evolutionspsychologie des Glaubens
4.1.1 Frühe evolutionspsychologische Theorien des Glaubens: Pawlow und Freud
4.1.2 Aktuelle evolutionspsychologische Zugänge
4.1.3 Kritische Würdigung des evolutionspsychologischen Ansatzes
4.2 Neuropsychologie des Glaubens
4.2.1 Zentrale Erkenntnisse
4.2.2 Kritische Würdigung des neuropsychologischen Ansatzes
5 Entwicklungspsychologie des Glaubens
5.1 Jean Piagets Stufentheorie der kognitiven Entwicklung (1926)
5.2 Theorien der moralischen Entwicklung nach Piaget (1932/2017) und Kohlberg (1973)
5.3 Stufen der religiösen Entwicklung nach Oser und Gmünder (1984)
5.4 Exkurs: Die kulturpsychologische Theorie der religiösen Entwicklung nach Lars Allolio-Näcke (2022)
6 Sozialpsychologische Ansätze
6.1 Religiöser Glaube und Vorurteile
6.1.1 Erwachsen aus der Vorurteilsforschung: Erste Ansätze mehrdimensionaler Konzepte religiösen Glaubens
6.1.2 Wieso trägt religiöser Glaube häufig zu Vorurteilen bei?
6.2 Religiöser Glaube und prosoziales Verhalten
6.2.1 Wer verhält sich prosozial gegenüber wem?
6.2.2 In welchem Kontext wird prosoziales Verhalten gezeigt?
6.2.3 Wieso führt religiöser Glaube zu prosozialem Verhalten?
6.2.4 Eine integrierte Sicht auf religiösen Glauben, Prosozialität und Vorurteile
6.3 Religiöser Glaube und Selbstwertgefühl
6.3.1 Die Rolle des Selbstwertgefühls im Gottesbild
6.3.2 Selbstwertgefühl und religiöse Attributionen
6.3.3 Rolle der religiösen Gemeinschaft und Kultur für das Selbstwertgefühl
7 Klinische Religionspsychologie
7.1 Krankheitsfaktor Glaube: Ein Fallbeispiel
7.2 Die Wiederentdeckung religiös-spiritueller Therapieansätze
7.3 Drei Phasen des Umgangs mit Glaubensfragen in der Psychotherapie
7.3.1 Phase 1: Religiöse Psychotherapie
7.3.2 Phase 2: Szientistische Psychotherapie als Gegenbewegung
7.3.3 Phase 3: Ein Spiritual Turn in der Psychotherapie
7.4 Berücksichtigung der Glaubensdimension in der Psychoanalyse, kognitiven Verhaltenstherapie und systemisch-humanistischen Psychotherapie
7.4.1 Psychoanalyse
7.4.2 Kognitive Verhaltenstherapie
7.4.3 Systemisch-humanistische Psychotherapie
7.5 Einschluss oder Ausschluss religiös-spiritueller Interventionen?
7.5.1 Die Wirksamkeit religiös-spiritueller Therapiemethoden
7.5.2 Das therapeutische Erbe der Religionen
7.5.3 Umgang mit Glaubensthemen in der Psychotherapie
8 Religiöser Glaube und psychische Gesundheit
8.1 Die Komplexität der Konstrukte Glauben und psychische Gesundheit
8.1.1 Verschiedene Gesundheitsindikatoren und ihre Beziehung zum Glauben
8.1.2 Verschiedene Glaubensindikatoren und ihre Beziehung zu psychischer Gesundheit
8.2 Die Komplexität des Zusammenhangs zwischen Glauben und psychischer Gesundheit
8.3 Theoretische Erklärungen und integrierendes Modell
9 Schattenseiten des Glaubens: Fundamentalismus, Extremismus und Missbrauch
9.1 Fundamentalismus
9.1.1 Begriffsbestimmung
9.1.2 Kognitive Perspektive auf den Fundamentalismus: Das Modell der Intratextualität von Hood et al. (2005)
9.1.3 Sozialpsychologische Sichtweise auf den Fundamentalismus
9.2 Extremismus
9.2.1 Begriffsbestimmung
9.2.2 Sind Extremisten gestört und irrational? Klinische und kognitive Ansätze
9.2.3 Die Gruppe zählt: Der sozialpsychologische Ansatz
9.2.4 Religiöser Fundamentalismus als Grundlage für Extremismus: Der endogene Ansatz
9.3 Missbrauch
9.3.1 Beispiele totalitärer Kontrolle
9.3.2 Bindungserfahrungen und die Bedeutung der Gruppe
9.3.3 Gruppen werden durch Zwang und Bindung destruktiv
9.3.4 Wie Missbrauch verhindern?
IIIInnenperspektiven: Positive und negative Glaubenserfahrungen
10 Religiöse Erfahrungen und Praktiken
10.1 Die Erforschung religiöser Erfahrungen im Wandel der Zeit
10.1.1 Die religiöse Erfahrung als emotionales Phänomen: William James und Rudolf Otto
10.1.2 Die religiöse Erfahrung als kognitives Phänomen:Karl Girgensohn
10.1.3 Forschungsboom ab den 1960er Jahren bis heute: Walter T. Stace, Ralph W. Hood, Ann Taves
10.2 Zentrale Impulse für religiöse Erfahrungen
10.2.1 Psychoaktive Substanzen
10.2.2 Reizdeprivation
10.2.3 Musik
10.2.4 Religiöse Rituale
10.3 Religiöse Erfahrungen in einer säkularisierten Gesellschaft
11 Umgang mit negativen Gottesbildern und »Sekten«-strukturen
11.1 Negatives Gottesbild
11.1.1 Definition
11.1.2 Ursachen und Implikationen
11.2 Soziale Strukturen in geschlossenen religiösen Gruppen
11.2.1 Begriff und Verbreitung
11.2.2 Zentrale Merkmale geschlossener religiöser Gruppen
11.2.3 Wer lässt sich auf die Versprechen und Angebote geschlossener Gruppen ein?
11.2.4 Empfehlungen zum Umgang mit Betroffenen und deren Angehörigen
12 Bekehrung, Erleuchtung und die gläubige Identitätsbildung
12.1 Die Bedeutung von Krisen in der Identitätsentwicklung
12.2 Religionspsychologische Konversionsforschung
12.3 Esoterischer Glaube: Erleuchtung und Erwachen als ein religiöses Entwicklungsziel
12.4 Psychologische Hilfen zur gläubigen Identitätsbildung
Ausblick: Reflektierter Glaube fördert das Gemeinwohl
Literatur
Vorwort
»Glauben ist menschlich.« Daran erinnert das erste Kapitel dieses Buches in seiner Überschrift. Zwar haben sich Kirchenbindung und Religiosität in Europa, dem am meisten säkularisierten Kontinent, in den letzten Jahrzehnten enorm abgeschwächt, doch sollte man darüber nicht übersehen, dass sich gemäß »Religionsmonitor 2023« zwei Drittel der in Deutschland lebenden Menschen als zumindest mittel oder wenig religiös einstufen und drei Viertel stark oder wenig ausgeprägt an Gott oder etwas Göttliches glauben. Je nachdem wie zentral diese Menschen ihren Glauben verinnerlicht haben, können sie aus ihm Sinn für ihr Leben, Motivation zu sozialem Verhalten und Kraft zur Bewältigung von Belastungen gewinnen: Während der europäischen Migrationskrise 2015/2016 fühlten sich Befragte, die sich als religiös einschätzten, weniger durch Migration bedroht als andere. Zu Beginn der Coronapandemie 2020 stiegen die Google-Suchen nach Gebeten weltweit um mehr als 50 Prozent an. Während dieser Krise haben religiöse Menschen problemorientierter und proaktiver reagiert und eine höhere Lebenszufriedenheit aufgewiesen als nichtreligiöse. Religiosität kann eine bedeutsame Ressource darstellen, aber auch mit problematischen Entwicklungen verbunden sein. Wie immer man zu ihr steht – es gibt gute Gründe, sich gesicherte Grundkenntnisse über sie zu erwerben.
Erstens ist dies ganz allgemein eine Frage unseres Wissens um den Menschen, unserer »Menschenkenntnis«. Wer wissen will, wie Menschen denken, empfinden und handeln können, kann den religiösen Bereich nicht ausklammern. Er würde ein Potenzial und eine Dynamik ignorieren, die das Leben und Zusammenleben unter Umständen stark bestimmen können. Die Folge wäre eine verkürzte Anthropologie.
Zweitens ist es für den Zusammenhalt in der Bevölkerung nicht belanglos, ob man weiß, wie Glaube »funktioniert« und ob Religiöse und Nichtreligiöse einander verstehen. Die Kluft zwischen dem Drittel der Bevölkerung, das sich als »gar nicht religiös« einschätzt, und der etwa halb so starken Gruppe derer, die sich als »sehr/ziemlich« religiös bezeichnen, nimmt zu, und gut ein Drittel der Menschen in Deutschland halten die religiöse Vielfalt in unserer pluralen Gesellschaft für eine Bedrohung – Menschen ohne Religionszugehörigkeit mehr als die anderen (Religionsmonitor 2023).
Drittens sind religionspsychologische Grundkenntnisse für eine religionssensible psychologische Beratung, Psychotherapie, Sozialarbeit mit Migrantinnen und Migranten und für die Altenpflege unerlässlich.
Nun ist aber Religiostät, gelebter Glaube, höchst komplex. Sie ist nicht identisch mit einem Glaubensbekenntnis, das viele teilen, sondern kann sich auch innerhalb ein und derselben Glaubensgemeinschaft von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausprägen, und religiöse Gruppen können ihre Mitglieder verschieden beeinflussen. Wie lässt sich dieser verwirrend bunte Lebensbereich über unser Alltagswissen hinaus wissenschaftlich verstehen und klären? Neben Religionswissenschaft, einschlägigen Theologien und Sozialwissenschaften wird man vor allem jene Wissenschaft zu Rate ziehen müssen, deren Aufgabe es ist, das Erleben und Verhalten von Menschen zu erforschen: die Psychologie. Tatsächlich hat sich, angeregt von Gordon W. Allport und Charles Y. Glock in den USA, seit etwa 1950 eine empirische Religionspsychologie entwickelt, die an die wissenschaftliche, akademische Psychologie anschlussfähig werden konnte, weil sie sich um theoretische Grundlagen und Forschungsmethoden bemühte, die deren Standards entsprechen: Religionspsychologie als Spezialgebiet der Psychologie – so wie beispielsweise Differentielle Psychologie, Klinische Psychologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie und Gesundheitspsychologie, mit denen sich auch oft eine Zusammenarbeit nahelegt.
Der Vielfalt religiösen Erlebens und Verhaltens musste und muss auch eine Vielfalt von theoretischen Konzepten und Forschungsmethoden entsprechen. Man ging und geht von verschiedenen Theorieansätzen (Paradigmen) der Psychologie aus: von phänomenologisch-psychiatrischen, psychodynamischen, soziologischen, emotions- und kognitionspsychologischen und vor allem von empirisch-behavioristischen (lerntheoretischen). Auch wurden unterschiedliche Methoden angewandt, qualitative und quantitative: Inhaltsanalysen, Interviews und vornehmlich Fragebogen. Idealerweise sollte religionspsychologische Forschung in einem Wettbewerb betrieben werden, in dem jeweils der Ansatz (und die Methode) zum Zug kommt, der den Bereich des Glaubenslebens, den man gerade untersucht, am überzeugendsten erklären kann: beispielsweise religiöse Wahnvorstellungen anders als religiös motivierte Krankheitsbewältigung oder Vorurteile. Zu wünschen wäre eine Gesamtsicht, die Forschungsergebnisse mit unterschiedlichen Ansätzen pluralistisch-integrativ so zusammenführt, dass sie sich ergänzen und nicht widersprechen – sozusagen in einem »kohärenten Eklektizismus« (Gordon W. Allport). Eine solche Synthese ist nicht leicht herzustellen. Auf sie verzichten die meisten großen Überblicksdarstellungen und berichten stattdessen additiv Forschungsergebnisse zu verschiedenen Themenkomplexen.
Heute findet man in den großen psychologischen Datenbanken mehrere Tausend Veröffentlichungen zum Stichwort »Religion/Religiosität« und der Beziehung zu anderen Themen. Sie entstanden großenteils in den Teilbereichen Sozial- und Gesundheitspsychologie, die in den USA wie auch in Europa institutionell besser verankert sind als das Stiefkind Religionspsychologie. Als besonders aufschlussreich haben sich Fragebogenerhebungen erwiesen, in denen man in unzähligen Korrelationsstudien die Religiosität von Individuen gemessen und mit anderen Merkmalen in Beziehung gesetzt hat. Längsschnittstudien sind hingegen äußerst selten. In dem riesigen Strom von Resultaten ist zwar nicht alles von gleicher wissenschaftlicher Qualität und Relevanz, doch kann eine Religionspsychologie, die sie sammelt und kritisch sichtet, manch erhellende und gesicherte Auskunft geben über die Beziehung bestimmter Formen von Religiosität zu so wichtigen Themen wie Lebenszufriedenheit, Bewältigung von Krankheit und anderen Lebenskrisen, prosoziales Verhalten, Vorurteil, Depressivität, Besessenheitserlebnisse, Visionen, religiöse Wahnideen und Einflüsse von unter Umständen problematischen spirituellen Gruppen auf ihre Mitglieder.
Damit kann die Religionspsychologie unser Wissen um das religiöse Erleben, Denken und Verhalten von Menschen beachtlich erweitern. Dabei ist sie, richtig verstanden, eine unparteiische, weltanschaulich neutrale Quelle. Denn sie hat weder Religionskritik noch Religionsapologetik zu betreiben, sondern das Glaubensleben von Menschen mit den Fragestellungen, Konstrukten und Methoden erfahrungswissenschaftlicher Psychologie unbefangen zu beschreiben und im Hinblick auf ihre psychosozialen und intrapsychischen Bedingungen zu erklären, so gut ihr das möglich ist. Engagierte Wissenschaft soll und kann sie nur insofern sein, als sie sich aufgrund der psychohygienisch-therapeutischen Grundausrichtung der Psychologie für das psychische Wohlbefinden und eine günstige Persönlichkeitsentwicklung verantwortlich fühlen muss. Darum hat sie sich auch für die Fragestellungen der Gesundheitspsychologie und der Lebensqualitätsforschung zu interessieren, die erforschen, welche religiösen Einstellungen das Wohlbefinden und die Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen oder fördern.
Die bisher geleistete Forschung hat erfreuliche Ergebnisse erbracht, doch bedürfen viele Fragen einer weiteren Klärung. Darum enden nicht wenige Studien mit dem Befund: »Further research is needed«. Themen, die derzeit vor allem beforscht werden müssten, sind die Neigung zu Fundamentalismus, Verschwörungserzählungen, geistlichem und sexuellem Machtmissbrauch, Radikalisierung mit religiösem Hintergrund sowie Religiosität in einer Migrationsgesellschaft.
Während in den USA zahlreiche religionspsychologische Untersuchungen durchgeführt werden und eigene Fachzeitschriften für dieses Fach existieren, erscheinen in Deutschland solche Studien eher selten. Im deutschen Sprachraum gibt es – im Unterschied etwa zu Belgien, den Niederlanden und Schweden – an keiner Universität einen Lehrstuhl für Religionspsychologie; damit fehlt ein Zentrum, das gezielt Studien zu bestimmten Themenkomplexen anregen könnte. Das Fach und seine Aufgaben sind weitgehend unbekannt. Wer hierzulande sagt, er unterrichte Religionspsychologie, muss auch bei akademisch gebildeten Gesprächspartnern mit der erstaunten Frage rechnen: »Gibt es das jetzt auch?« Manche Lehrende an Hochschulen und Universitäten sind gegenüber religiösen Themen vermutlich deshalb befangen, weil sie befürchten, sie müssten ihre weltanschauliche Einstellung offenbaren oder gerieten in den Verdacht, einer Konfession zu dienen. So gehen von ihnen kaum Anregungen zu Arbeiten mit religionspsychologischer Thematik aus.
Möge dieses Buch entgegen diesem Trend möglichst viele Leserinnen und Leser an Ergebnisse und Arbeitsweise moderner Religionspsychologie heranführen und neugierig machen. Denn Religionspsychologie ist »ein pluriformes Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft« (Jacob van Belzen, 2015, S. 234) – und »glauben ist menschlich«.
Bernhard Grom
Einführung: Warum Religionspsychologie heute bedeutsam ist
Religion hat einen schlechten Ruf. Über Jahrhunderte war es in Deutschland normal, in einer katholischen oder evangelischen Familie aufzuwachsen. Aber im Jahr 2022 ist der Anteil der Kirchenmitglieder auf unter 50 % gefallen. Während im Jahr 1970 noch 49 % der westdeutschen Bevölkerung evangelisch und 44 % katholisch waren – zusammen also 93 %, hat sich dieser Anteil innerhalb einer Generation fast halbiert und ist unter die 50-%-Marke gerutscht. Das ist nicht allein mit der Wiedervereinigung und den neuen Bundesländern zu erklären, deren Bevölkerung eher sozialistisch als kirchlich geprägt wurde. Soziologen sehen in der 50-%-Marke im Jahr 2022 einen historischen Einschnitt und erklären das mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen der Säkularisierung und Individualisierung. Erschreckend viele ans Licht gekommene Fälle von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen haben das Vertrauen in das Christentum in den letzten Jahren weiter schwinden lassen. Religiöser Glaube wird heute eher mit Eigenschaften wie unwissenschaftlich, naiv, weltfremd, dogmatisch, fundamentalistisch oder »scheinheilig« in Verbindung gebracht. Der fromme Schein trüge, das Vertrauen in eine höhere Macht sei nur vorgetäuscht und diene eigenen Interessen, lautet eine verbreitete Meinung.
Trotz dieser negativen Vorzeichen und ungünstigen Umstände haben wir diese Einführung in die Religionspsychologie gern und mit Überzeugung erarbeitet. Denn es gibt mehrere gute Argumente, warum eine psychologische Erforschung des Glaubens gerade im 21. Jahrhundert in einem religionsarmen Land wie Deutschland bedeutsam ist:
Die menschliche Glaubensfähigkeit ist psychologisch relevant
Die seelischen Möglichkeiten des Vertrauens, Glaubens und Hoffens stellen eine komplexe emotional-kognitive Fähigkeit dar, die insbesondere Entscheidungsprozesse beeinflusst. Glauben, Selbstvertrauen und zwischenmenschliches Vertrauen beruhen auf einer verpflichtenden Hingabe an eine Wirklichkeitsdeutung. Die mit dieser Kurzdefinition zusammenhängenden psychologischen Prozesse werden in Kapitel 1 ausführlich erläutert. Zur Einstimmung ein Beispiel: Wenn bei einer Wanderung ein Flusslauf zu überqueren ist, muss ich realistisch einschätzen, ob ich das Wasser mit meiner Sprungkraft überwinden kann oder ob ich lieber den Umweg zur nächsten Holzbrücke in Kauf nehme. Hoffnungsvolles Vertrauen ist nötig, um die Angst zu überwinden und den Sprung zu wagen. Genauso wichtig sind die Risikoabwägung und eine realistische Selbsteinschätzung, um die körperlichen Kräfte nicht zu überschätzen und dann vielleicht im Wasser zu landen (siehe die folgende Abbildung).
Abbildung: Der Sprung in den Glauben © Nelly Nieter
Glauben ist eine menschliche Möglichkeit, die sich nicht nur auf die eigene Person und das Gegenüber beziehen kann, sondern auch auf eine größere Wirklichkeit, das Schicksal oder eine Schöpferkraft. Glauben und Vertrauen wirken sich in vielfältigen Bereichen aus: auf das Selbstbild, auf zwischenmenschliche Beziehungen, ja sogar auf die Arbeit und die Unternehmenskultur. Mittlerweile werden Firmenwerte nach dem Vertrauen in eine Marke eingeschätzt (Neser, 2016). Damit bringt die psychologisch schwierig zu erfassende Glaubenshaltung handfeste ökonomische Konsequenzen mit sich – was die Forschung motiviert, noch mehr darüber herauszufinden. Erstaunlicherweise gibt es bisher wenige psychologische Untersuchungen über den Glauben (Schweer, 2021). Unser Buch konzentriert sich auf den Glauben, der in früheren Jahrzehnten in den Religionen kultiviert wurde und durch Glaubenspraktiken das Tragische und Absurde des menschlichen Lebens zu bewältigen half.
Die innere Glaubenshaltung entspricht nicht unbedingt der formalen Religionszugehörigkeit
Als empirische Sozialwissenschaft orientiert sich die Psychologie an Studien. Dabei ist die Messgenauigkeit ein wichtiges Kriterium, um Studienergebnisse zu verstehen. Der Befund, dass im Jahr 2022 weniger als 50 % der deutschen Bevölkerung Mitglied einer Kirche ist, muss ergänzt werden. Deutschland wird als ein beliebtes Einwanderungsland mittlerweile religiös immer vielfältiger und bunter. Beispielsweise bekennt sich eine wachsende Anzahl Deutscher zum muslimischen Glauben, das waren im Jahr 2023 fast sechs Millionen Menschen und damit knapp 7 % unserer Bevölkerung. Zweifellos ist auch die Gruppe der Konfessionslosen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten größer geworden. Doch diese breite und vage Kategorie gibt keine Auskunft darüber, woran diese Menschen glauben: an bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse, an das Gute, an das Nichts?
Ganz bewusst stellt unsere Einführung die persönliche Glaubenshaltung und -praxis in den Mittelpunkt und nicht den konfessionellen Status. Denn die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft sagt nicht unbedingt etwas über die innere Haltung aus. Manche Kirchenmitglieder glauben nicht an Gott und gehören aus traditionellen, ästhetischen, kulturellen oder berufspolitischen Gründen zu einer christlichen Kirche. Anderen wiederum ist die »Amtskirche« wegen verkrusteter Strukturen oder Überorganisation ein Dorn im Auge. Sie vertiefen den für sie persönlich bedeutsamen Glauben in einer unabhängigen Freikirche, die sie mit großzügigen Spenden fördern, und lehnen es ab, mit ihren Steuern einen überalterten Organisationsapparat aufrechtzuerhalten.
Deshalb bevorzugt dieses Buch das Konzept des Glaubens. In Kapitel 1 wird unser Ansatz ausführlich begründet und von ähnlichen Begriffen wie »Religiosität«, »Transzendenz« oder »Spiritualität« abgegrenzt.
Im Fokus: Existenzfragen und Sinnsuche, nicht theologisch verstandener Glaube
Der im Untertitel des Buches verwendete Begriff »Religionspsychologie« bezieht sich auf einen weiten, umfassenden Religionsbegriff (siehe Kapitel 1). Nicht die traditionell gewachsenen Strukturen etablierter Religionsgemeinschaften mit ihren sozialpsychologischen Mechanismen und Auswirkungen stehen im Zentrum. Auch der Glaube als ein Zentralbegriff des Christentums wird von uns nicht untersucht, dazu gibt es viele kulturgeschichtliche und theologische Studien (z. B. Angel, 2022 oder Härle, 2022). Unsere Einführung verfolgt keinen theologischen, sondern einen psychologischen Ansatz. Damit unterscheidet sie sich von einer kirchlichen Sichtweise wie etwa die »Religionspsychologie« (Marks, 2018) in der Buchreihe »Kompendium Praktische Theologie«.
Psychologinnen und Psychologen1 tun sich seit jeher schwer mit dem religiösen Glauben. Die deutschsprachige Religionspsychologie ist seit vielen Jahrzehnten verwaist, obwohl sie zu Anfang des letzten Jahrhunderts ein weltweit beachtetes Zentrum dafür bildete (van Belzen, 2015). Historische Gründe dafür werden in Kapitel 1 erläutert. Wir sind davon überzeugt, dass es sich aus individuellen Gründen (»Wie bewältige ich eine existenzielle Krise?«) und gesellschaftlichen Gründen (»Was hält unsere Gesellschaft zusammen?«) lohnt, die Psychologie des Glaubens wieder intensiver zu erforschen und sie für den Einzelnen und die Gemeinschaft nutzbar zu machen.
Die junge Wissenschaft der Psychologie versucht, menschliches Erleben und Verhalten (immer besser) zu verstehen und zu erklären, stößt dabei aber auch immer wieder an Grenzen. Zur Veranschaulichung ein analoger Fall: Ein Kind ist neugierig auf sich und die Welt. Wissbegierig möchte es verstehen, wie der Körper, die Umwelt und später auch die Mitwelt »funktionieren«. Eine wichtige, aber oft unlösbare Frage im Kleinkindalter lautet »Warum?«. Lässt man sich als Erwachsener ehrlich auf diese Frage ein, kann man sie nur bis zu einem gewissen Punkt beantworten. Zu komplex ist die Wirklichkeit, zu widersprüchlich, zu überraschend, teilweise zu absurd und zu tragisch erweist sich das Leben. Auf die drängende Warum-Frage gibt es keine logischen und objektiv eindeutigen Antworten, sondern es kommen Vorannahmen, Überzeugungen und der Glaube ins Spiel.
Aus fachlicher Sicht stehen bei einer Psychologie des Glaubens die persönliche Suche nach Sinn und Glück, nach Antworten auf existenzielle Fragen, nach Hoffnung und Vertrauen und die Bewältigung spiritueller Krisen im Mittelpunkt. Diese Funktionen haben früher religiöse Überzeugungen und Praktiken übernommen. Ausführlich werden diese Fragen in Kapitel 2 behandelt. Mache Fachleute haben vorgeschlagen, diesen psychologischen Forschungsbereich als Existenzanalyse (Frankl, 2007) oder neuerdings Spiritualitätspsychologie (Allolio-Näcke, 2021; Bucher, 2014; Marks, 2018) zu bezeichnen. Das hat sich aber bisher (noch) nicht durchgesetzt, deshalb verwenden wir die bekannte Bezeichnung Religionspsychologie.
Glaube kann in einem Verschwörungsdenken münden – oder Berge versetzen
Glauben ist menschlich, aber Menschen können sich auch täuschen. Die seit einigen Jahren um sich greifenden Verschwörungserzählungen machen deutlich, wie schmal der Grat zwischen einer berechtigten Hoffnung oder realistischen Erwartung und einem Verschwörungsdenken ist. Die menschliche Glaubensfähigkeit kann leicht vereinnahmt werden und durch Feindbilder, einseitige Faktenverzerrungen und Endzeitängsten zu einer gefährlichen Perspektivverengung führen (Lamberty, 2022). In Kapitel 1 wird Glauben als eine Vorform des Wissens beschrieben, das aber auf die kritisch-rationale Realitätsprüfung angewiesen ist, um nicht im Wunschdenken und Irrtum zu enden. Deshalb ist die psychologische Untersuchung der Glaubensfähigkeit besonders wichtig. Dabei fällt der Psychologie die Aufgabe der Realitäts- und Alltagstauglichkeitsprüfung zu.
Andererseits enthält die Glaubensfähigkeit einen Optimismus, der die Welt des Faktischen durchbricht. Jesus versuchte, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern eine besondere Glaubenshaltung vorzuleben und zu vermitteln, durch die angeblich Berge versetzt werden können (Bibel, 1. Korinther 13,2). Die positiven Kräfte des Glaubens werden heute gezielt in der Medizin, im Coaching und in der Psychotherapie eingesetzt (Lermer, 2019). Der Glaube an eine positive Wirkung einer Arznei wird neben dem eigentlichen Medikament in der Medizin seit einigen Jahren intensiv erforscht. Studien belegen, dass bei einer ärztlichen Behandlung neben der Medikamentengabe die positive Erwartungshaltung, der sogenannte Placebo-Effekt, den Heilungsprozess massiv beeinflussen (Fischer et al., 2018). Dabei ist der Anteil der Glaubenshaltung am Heilungsprozess noch unklar, wird aber zunehmend erforscht und in der ärztlichen Weiterbildung systematisch geschult (Esch, 2017). Weil gerade Heilungsprozesse stark mit der Glaubenshaltung verbunden sind, werden diese Zusammenhänge in Kapitel 7 und 8 dargestellt. Weil Glauben psychologisch aber nicht nur positive Wirkungen nach sich ziehen kann, sondern auch im Irrtum und Wahn enden kann, wird im Kapitel 9 auf seine Schattenseiten – nämlich Fundamentalismus, Extremismus und Missbrauch – eingegangen. Eine psychologisch-kritische Untersuchung der Glaubensdimension dämmt das menschliche Wunschdenken sowie die Sehnsucht nach esoterischen und magischen Hilfsmitteln ein. Dabei sollen die enormen Möglichkeiten des Glaubens nicht wegrationalisiert werden, sondern kritisch geprüft und »geerdet« werden.
Zum Aufbau des Buchs
Das Buch richtet sich an Interessierte und Professionelle, die die psychologischen Vorbedingungen und Auswirkungen des Glaubens besser verstehen wollen. In einer weltweit angespannten gesellschaftlichen Lage, die von vielen globalen und individuellen Unsicherheitsfaktoren bedroht wird und bei vielen Menschen Stressreaktionen sowie Ängste vor Kontrollverlust erzeugt, zeigt die Förderung der Glaubensfähigkeit neue Lösungsmöglichkeiten auf. Das Buch ist sowohl zum Eigenstudium als auch in der Weiterbildung geeignet. Der didaktische Rahmen jedes Kapitels mit Lernzielen, Erschließungsfragen und Literaturempfehlungen soll die Beschäftigung mit der Stofffülle erleichtern. In der Rubrik »Persönliche Vertiefung/Selbsterfahrung« laden grundsätzlichere Fragen am Ende jedes Kapitels dazu ein, sich persönlich auf einzelne Aspekte einzulassen, sich emotional berühren zu lassen und zu reflektieren. In einer geeigneten Runde können diese Fragen auch ausgetauscht werden und damit intensivere Selbsterfahrungsprozesse anstoßen. Um die emotionalen Zugänge zum Thema zu verstärken und auch die Seitengestaltung aufzulockern, wurden Grafiken und Abbildungen erstellt, die das Gesagte veranschaulichen. Manche Inhalte lassen sich durch treffende Zeichnungen einprägsamer vermitteln als durch langatmige Erklärungen.
Das Buch untersucht den Glauben systematisch in drei Teilen:
– Teil I stellt psychologische Anknüpfungspunkte zum Glauben her und liefert Definitionen.
– Teil II beleuchtet Glaubensphänomen aus der psychologischen Außenperspektive.
– Teil III ergänzt diese durch subjektive Innenperspektiven persönlicher Erfahrung.
Teil I beginnt mit dem psychologischen Begriff des Glaubens in Abgrenzung zu verwandten Konzepten (Kapitel 1). Glauben ist deshalb menschlich, so wird argumentiert, weil existenzielle Fragen, das Scheitern und Sinnkrisen zum Leben gehören (Kapitel 2). Als eine große existenzielle Herausforderung wartet am Ende jeden Lebens das Abschiednehmen und Sterben (Kapitel 3), das bei einer angemessenen Vorbereitung allen Beteiligten viel leichter fällt und seinen Schrecken verlieren kann.
Teil II, der Hauptteil, erläutert die Glaubensmöglichkeit aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven in sechs Kapiteln. Behandelt werden evolutions- und neuropsychologische Zugänge, sozialpsychologische Ansätze sowie die Entwicklungspsychologie des Glaubens. Krankmachende Aspekte und heilungsfördernde Ansätze werden ebenso dargestellt. In jedem dieser Kapitel werden die relevanten Forschungsergebnisse erläutert, Begriffe definiert, Zusammenhänge mit anderen psychologischen Dimensionen hergestellt und Folgerungen gezogen.
Teil III blickt auf die subjektive Seite des Glaubens. Die subjektive Erfahrungsdimension ist gerade beim Glauben bedeutsam, weil dieser tief in der Emotionalität und dem Selbstbild des Menschen verwurzelt ist. Außergewöhnliche Erfahrungen, wie sie beispielsweise beim Meditieren auftreten, verlangen nach Erklärungen. Häufig kommt da irgendeine Form der Deutung und des Glaubens ins Spiel (Kapitel 10). In manchen Lebensgeschichten wurde die Glaubensfähigkeit durch rigide Erziehung und ein angstvolles Gottesbild verdunkelt und beeinträchtigt (Kapitel 11). Welche Rolle der Glaube bei der Identitätsbildung übernehmen kann und welchen Einfluss darauf Bekehrungserfahrungen nehmen, stellt das Kapitel 12 dar.
Der abschließende Ausblick plädiert für einen reflektierten Glauben, weil eine solche Form dem Gemeinwohl dient und damit vor allem die Gefahren der sozialen Isolation, Depression und Einsamkeit vermindert.
Dank
Der Erstautor dankt seiner Co-Autorin, Sarah Demmrich, sehr dafür, dass sie mit Geduld, Zielstrebigkeit, Übersicht und akribischer Fachkenntnis wesentlich dazu beigetragen hat, dieses während der Coronapandemie fast zu scheiternde Projekt am Leben zu halten und erfolgreich abzuschließen. Die Autorin wiederum ist ihrem Verfasserkollegen, Michael Utsch, zutiefst verbunden, dass sie an diesem Buch mitwirken durfte und ihr somit die Gelegenheit geboten wurde, ihr religionspsychologisches Wissen durch seine therapeutischen, aber auch religionswissenschaftlichen Kompetenzen zu vertiefen.
Die Grafikdesignerin Nelly Nieter hat trotz gleichzeitigem Prüfungsstress kreative Zeichnungen beigesteuert. Als eine unserer ersten Leserinnen hat sie uns gezeigt, was sie vom Text verstanden hat (und was nicht) – danke dafür, Nelly!
Unsere besondere Anerkennung gilt auch den wissenschaftlichen Hilfskräften Leon Stephan, Alina Birkmeyer und Abdulkerim Şenel, die mit größter Sorgfalt und sehr viel Engagement an der Redaktion und Formatierung des Manuskripts mitgewirkt haben.
Ulrike Rastin, Sandra Englisch und dem Team von Vandenhoeck & Ruprecht danken wir herzlich für die geduldige und professionelle Projektsteuerung.
1 In diesem Buch verwenden wir im Sinne der Gendersensibilität des Öfteren die weibliche und die männliche Form nebeneinander, jedoch nicht durchgängig, um den Lesefluss nicht allzu sehr zu stören. Bei referierten Studien ist exakt benannt, ob sowohl »Probandinnen und Probanden« teilgenommen haben oder aber ausschließlich männliche »Probanden«.
I Glauben ist menschlich – Religiosität und Spiritualität aus Sicht der Psychologie
1 Religiosität, Spiritualität – oder Glaube?
Lernziele
1. Glauben abgrenzen können von verwandten Begriffen wie » Religiosität«, »Spiritualität« und »Weltanschauung«.
2. Psychologische Messinstrumente der Religiosität, Spiritualität und des Glaubens kennen.
3. Glaube in seinen emotionalen, kognitiven und Verhaltenskomponenten unterscheiden können.
4. Wesentliche psychologische Funktionen der Glaubensfähigkeit beschreiben können.
»Der Mensch besteht aus Glauben. Wie sein Glaube ist, so ist er.«
(Bhagavad Gita 17,3)
»In allen Religionen ist der Glaube ein wesentliches Element des religiösen Lebens.«
(Vattimo, 1997, S. 76)
»Glaube […] ist keine abgesonderte Dimension des Lebens, keine abgegrenzte Besonderheit. Glaube ist eine Orientierung der ganzen Person, die ihren Hoffnungen und Bestrebungen, Gedanken und Handlungen Sinn und Ziel gibt.«
(Fowler, 2000, S. 36)
»Alles Vertrauenssache!« Das gilt nicht nur als Beifahrerin auf dem Motorrad, Kletterer einer Bergsteigerseilschaft oder beim Kauf eines Gebrauchtwagens. In vielen Lebensbereichen ist zwischenmenschliches Vertrauen unabdingbar. Vertrauen gilt als die wichtigste Ressource des sozialen Miteinanders (Schweer, 2021). Eine zuversichtliche Grundhaltung ist auch für das Selbstbild unverzichtbar – ohne Selbstvertrauen werde ich keine Herausforderung meistern! Im Vertrauen auf meine Fähigkeiten und Fertigkeiten packe ich zuversichtlich eine Aufgabe an – und mache im günstigsten Fall die Erfahrung von Selbstwirksamkeit.
Spätestens in Krisensituationen oder in menschlichen Grenzsituationen (Unfall, Leid, Tod) sind der Handlungsspielraum und die Selbstwirksamkeit stark eingeschränkt, der Mensch fühlt sich ohnmächtig einem höheren Schicksal ausgeliefert. Ein Mitbegründer der Psychoanalyse, der Wiener Arzt Alfred Adler (1870–1937), hat deshalb in seinem letzten großen Werk »Der Sinn des Lebens« nicht nur die Beziehungen des Menschen zu sich selbst und den Mitmenschen als wesentlich angesehen, sondern auch die menschliche Bezogenheit auf ein größeres Ganzes berücksichtigt, die er als »kosmische Faktoren« umschrieb (Adler, 1933/2018, S. 162).
Die menschliche Fähigkeit des Glaubens ist aus psychologischer Sicht allerdings noch ziemlich unerforscht. Das liegt zum einen an der Komplexität der emotionalen und kognitiven Faktoren, die den Glauben ausmachen. Zum anderen sind die Zusammenhänge zwischen internen personalen Faktoren wie Optimismus, Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen mit externen, transpersonalen Faktoren, die wir schnell dem Zufall oder Schicksal zuschreiben, wenig erforscht und unklar (Schweer, 2021).
Glauben als individuelle Fähigkeit zu positiven, aber auch negativen Erwartungen hat sich über die Jahrtausende als ein kulturstiftendes kollektives Phänomen erwiesen, das neben beeindruckender religiöser Kunst auch gesellschaftsprägende religiöse Institutionen hervorgebracht hat. Auch wenn in Europa das Christentum massiv an Bedeutung verliert, darf der bleibende Einfluss kulturell überlieferter Werte nicht unterschätzt werden. Glauben zählt offensichtlich zu einer zentralen Säule des individuellen und kollektiven Selbstverständnisses. MacGregor (2020) hat einen faszinierenden Reisebericht durch die Welt der Götter und Religionen vorgelegt. Quer durch die Kontinente und Kulturen hat der Direktor des British Museum und Intendant des Berliner Humboldt-Forums dokumentiert, wie religiöser Glaube das Leben von Gemeinschaften und das Selbstbild prägt.
1.1 Religiosität, Spiritualität und Glauben
1.1.1 Begriffsbestimmungen
Für psychologische Aussagen sind inhaltlich möglichst exakte Begriffsbestimmungen und theoriegeleitete Verknüpfungen mit angrenzenden Konzepten nötig. Menschliche Grundgefühle wie Angst oder Freude lassen sich heute recht präzise psychologisch beschreiben, erfassen und in ihren neurophysiologischen und psychosomatischen Zusammenhängen erklären. Die psychologische Forschung hat z. B. dazu beigetragen, seelische Störungen wie eine Panikattacke besser zu erkennen, behandeln und ihnen auch vorbeugen zu können. In der Organisationsentwicklung, Mitarbeitendenführung, Berufsfindung, Karriereplanung, Partnerschaft, Erziehungsberatung und vielen anderen Lebensbereichen bilden psychologische Erkenntnisse die Grundlage für Entscheidungsprozesse.
Allerdings gestaltet sich die psychologische Beschreibung und Erfassung von komplexen Einstellungen, Erlebens- und Verhaltensweisen der Religiosität und Spiritualität schwierig, da Denken, Fühlen, Grundüberzeugungen und kulturelle Prägungen gleichermaßen einbezogen sind. Eine Operationalisierung, d. h. eine Messbarmachung, ist jedoch für die psychologische Theoriebildung und praktischen Folgerungen – etwa die sozialpsychologische Bedeutung einer Teilnahme am Freitagsgebet in einer Moscheegemeinde oder die therapeutische Wirksamkeit eines spirituellen Rituals – unverzichtbar. Die folgenden Definitionen, die als Basis für Messungen dienen können (siehe Kapitel 1.2), sollten dabei nicht als finale Begriffsbestimmungen, sondern nur als Arbeitsdefinitionen für dieses Einführungsbuch aufgefasst werden.
Definitionen
Religion stellt ein institutionalisiertes System von Glaubensüberzeugungen und Praktiken in Bezug auf eine transzendente Welt dar (Lunn, 2009). Der Begriff bezieht sich somit auf eine Glaubensgemeinschaft, die Traditionen, Rituale und Heilige Texte teilen (Christentum, Islam, Buddhismus etc.).
Religiosität ist dabei das Erleben und Verhalten eines Individuums oder einer Gruppe in Bezug auf eine solche institutionalisierte Religion.
Spiritualität bezeichnet die persönliche Suche nach etwas Heiligem und die Verbundenheit mit einem größeren Ganzen, die inhaltlich religiös (z. B. Gott), kosmisch-esoterisch (z. B. Energie) oder säkular (d. h. ohne religiösen Bezug, z. B. Natur) gefüllt werden kann (Utsch et al., 2017).
Glaube ist eine psychische Vorstufe des Wissens und stellt die Anerkennung einer Wahrheit, Realität oder Echtheit von etwas (z. B. eines Phänomens) – vor allem unter der Abwesenheit von Belegen – dar. Glaube ist dabei mehr als eine unterhaltsame Interpretation von bestimmten Ereignissen, sondern bezeichnet eine verpflichtende Haltung und ein inneres Vertrauen zu einer bestimmten Interpretation eines Phänomens. (American Psychological Association, 2015; Mönter, 2022)
Einige gehen davon aus, dass Glaube als Vorstufe von Wissen nur den kognitiven Teil von Religiosität oder Spiritualität umfasse (z. B. Maraldi, 2021). Der Sozialpsychologe Michael Argyle (2000) jedoch definiert Glaube als eine umfassende Haltung (Attitude), die – wie nichtreligiöse Haltungen – aus drei Komponenten besteht: Kognition, Emotion und Verhalten (siehe Abbildung 1.1). Die kognitive Komponente ist diejenige, die meist mittels Fragebögen erfasst wird (z. B. durch Items wie »Ich glaube an Gott«) und steht in Verbindung mit bestimmten Emotionen (z. B. Liebe zu oder Angst vor Gott) und Verhalten (z. B. Beten, Spenden; für prosoziales Verhalten siehe Kapitel 6).
Abbildung 1.1: Glaube als Haltung (nach Argyle, 2000)
1.1.2 Glaube als zentrales psychologisches Konzept der Religionspsychologie
Mit dem Fokus auf der Psychologie des Glaubens will dieses Einführungsbuch einen breiteren Zugang jenseits ausgetretener Pfade herkömmlicher Religiositäts- und Spiritualitätskonzepte begehen, den früher schon einige Ärzte und Psychologinnen eingeschlagen haben. Bei der psychologischen Konzeption des Glaubens lassen sich vier theoretische Ansätze unterscheiden: Verhaltenstheorie, phänomenologisch-verstehende, psychoanalytische und neurowissenschaftliche Psychologie.
a) Verhaltenstheorie
Für Pierre Janet (1859–1947), einem der Mitbegründer der wissenschaftlichen Psychologie, zählte Glauben zu einem der wichtigsten seelischen Phänomene. Glaube ist dabei für ihn »ein Versuch der Anpassung, der unser Handeln wirksamer gestalten soll. Er ist im Grunde eine Art Sprechen, eine Änderung der Worte, um sie so wirkungsvoll wie die Handlungen unseres Körpers zu machen« (Janet, 1936/2013, S. 9). Er unterscheidet drei Formen des Glaubens: den primitiven, den sentimentalen und den vernünftigen Glauben. Nach der ausführlichen Diskussion verschiedener Glaubensformen beschreibt er die Mystiker und Mystikerinnen als die ersten Psychologen des Glaubens. Sie würden intensive emotionale Erfahrungen machen, die sie als Gottesbegegnung erlebten, und diese auch so reflektieren.
Achtzig Jahre später verbindet der Persönlichkeitspsychologe Julius Kuhl (*1947) intuitive religiöse Erfahrung und analytisches Denken und will dadurch die klassische Feindschaft zwischen Glauben und Wissen psychologisch überbrücken. Die Fähigkeit des Glaubens könne zur Entfaltung kommen, wenn »dem Verstand klar gemacht worden ist, wo seine Grenzen sind und wann er auch noch andere psychische ›Abteilungen‹ zulassen sollte« (Kuhl, 2015, S. 21). Im Sinne einer »zweiten Naivität« könne ein Mensch vom Wissen zum Glauben gelangen und diese mentale Kraft zur Lebensbewältigung einsetzen.
Definition
In religiösen Gemeinschaften spielen Symbole und Zeichenhandlungen eine große Rolle. Unter »zweiter Naivität« wird die Bereitschaft verstanden, sich nach der kritischen Analyse eines Sachverhalts auch emotional auf solche Symbole und Zeichenhandlungen einzulassen. Wenn ich mich beispielsweise historisch-kritisch darüber informiert habe, was das Teilen von Brot und Wein bei der Feier eines christlichen Abendmahls bedeutet, kann ich bei der Teilnahme eine Glaubenserfahrung machen.
b) Phänomenologisch-verstehende Psychologie
Der Psychologe und Pädagoge Eduard Spranger (1882–1963) setzte sich im medizinischen Kontext u. a. dafür ein, dass der Erfolg einer Therapie davon abhänge, bei den Erkrankten die verlorene »feste Glaubenskraft« (Spranger, 1942/1974, S. 251) wiederherzustellen. Er beschreibt die »eigentümliche Leistung des Glaubens« darin, »aus dem Unzulänglichen das Höhere hervorzutreiben, gerade aus dem Negativen das Positive zu entfalten. Dazu gehört Kraft. Glaube ist nicht eine ›Ansicht‹ von der Welt, sondern ein Energiezentrum. Wenn es sich durch die Widerstände durchringt, bildet sich unvermeidlich aus seinen Kräften ein neuer Vorstellungszusammenhang […] für die Weltinterpretation« (S. 266). Ausgehend von einem weiten Glaubensbegriff setzt Spranger Glauben mit Vertrauen gleich, das »als eigentliches Fundament der persönlichen Lebensstruktur eingebaut ist und den ganzen Lebensvollzug in Erlebnis und Tat maßgeblich bestimmt […] Glaube ist diejenige Art von Gewißheit über weltanschaulich bedeutsame Sachverhalte, mit der die persönliche Existenz steht und fällt« (S. 253). Nach Spranger kommt der Glaube dann ins Spiel, wenn naturwissenschaftliche Sicherheiten nicht mehr greifen: »Glaube entsteht da, wo das Unzulängliche unseres Lebenszusammenhanges erfahren wird. Er setzt das Erlebnis des Ungenügens voraus. Sein Entstehungsboden ist daher gerade auf der negativen Seite zu suchen: im Zweifel, in der Verzweiflung, der Schuld, der Furcht, der Angst« (S. 254). An Beispielen demonstriert Spranger, wie die »Dynamik des Glaubens« imstande ist, dass »aus dem Negativen das Positive entwickelt wird, aus der Ohnmacht die Kraft, aus dem Zweifel die Gewißheit« (S. 272). Der Religionspsychologe David Wulff (1997) hat Sprangers Ansatz gewürdigt und auf dessen Basis ein Messinstrument des Glaubens entwickelt, das wir weiter unten kennenlernen (siehe Abschnitt 1.2.3).
c) Psychoanalytische Psychologie
Den religionskritischen Gründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, dürfte es wundern, wie ideenreich und lebendig sich die psychoanalytische Religionspsychologie in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt hat (Kapitel 4). Dabei wird das psychoanalytische Denkmodell sowohl von gläubigen als auch von agnostischen und atheistischen Psychoanalytikern verwendet.
Paul Pruyser (1916–1990) war als leitender Psychologe in einem amerikanischen Klinikverband tätig und machte in seiner weitverbreiteten »Psychologie des Glaubens« (Pruyser, 1972) aus seinem christlichen Glauben keinen Hehl. Anders als bei verhaltenspsychologischem Zugang versuchte er, den Glauben nicht von religiösen Ritualen oder Überzeugungen her zu verstehen, sondern als eine seelische Grundfunktion zu beschreiben. Systematisch werden die Wahrnehmungsprozesse, Denkvorgänge, emotionalen Prozesse und zwischenmenschlichen Bindungen in Bezug auf die Glaubensfunktion analysiert. In der Weiterentwicklung der Freud’schen Religionstheorie sei »Heiliges« weder in der äußeren Welt auffindbar, noch tauche es direkt im inneren Erleben einer Person auf. Pruyser geht neben dieser inneren und äußeren Welt von einer dritten »Welt der Illusionen« aus, dem imaginären Raum der Vorstellungen, die wie eine Brücke Innen und Außen verbinde. Obwohl er etliche Bibelverse zitiert und interpretiert, will er nur als Psychologe sprechen und warnt davor, auf das Gebiet der »Ontologie« zu geraten, was er auch vermeiden kann. In der Zusammenfassung von Pruysers Ansatz würdigt die Wiener Religionspsychologin Susanne Heine (2005) Pruyser als einen Psychologen, den sein offenes Interesse zu großer Kenntnis theologischer Inhalte geführt habe. Er sei ein gutes Beispiel dafür, dass Religionspsychologie sowohl psychologische als auch religionskundliche Kompetenzen benötige.
Ohne auf Pruyser einzugehen, hat der Düsseldorfer Psychoanalytiker Dieter Funke (2021) die Bedeutung des inneren (Zwischen-)Raums zur Bewältigung von Ungewissheit und damit als vertrauensbildende psychospirituelle Arbeit herausgearbeitet.
Auch die französische Kulturanthropologin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva (2014) sieht in dem »Glaubensverlangen« eine anthropologische Konstante, die vor jeglicher religiös-kulturellen Ausgestaltung im Menschen angelegt sei: »Das sprechende Wesen ist ein glaubendes Wesen« (S. 17). Davon ist die Literaturtheoretikerin und bekennende Atheistin überzeugt, denn jeder Satz werde in der erwartungsvollen Hoffnung auf eine Antwort, zumindest auf ein Zuhören gesprochen. Dieses Grundbedürfnis nach Antwort beginne beim Kleinkind mit der Erwartung eines liebenden Dritten, welche die tiefgreifende Mutter-Kind-Abhängigkeit erweitere und verwandle. Es lasse sich beim Sprechen durch die Erwartung des Zuhörens und Antwortens nachweisen.
Als ein letztes Beispiel sei auf eine neue Entwicklung innerhalb der Psychoanalyse hingewiesen. Der Londoner Psychoanalytiker Peter Fonagy (2023) hat die Psychoanalyse von der Triebtheorie über die Bindungstheorie zu einer Kommunikationstheorie weiterentwickelt. Sein Konzept dafür lautet »epistemisches Vertrauen«. Damit ist ein grundsätzliches Vertrauen in eine Person als sichere Informationsquelle gemeint, dass gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz und »Fake News« an Bedeutung gewinnt. Epistemisches Vertrauen bezieht sich auf die Quelle der Information und auf den Kontext der Information. Deshalb ist es auch vom Verhältnis zum Kontext abhängig. Neue Informationen sind eher glaubwürdig, wenn der Kontext als glaubwürdig eingeschätzt wird. In diesem psychoanalytischen Ansatz werden sowohl emotionale mit rationalen Faktoren als auch Person und Situation einbezogen. Epistemisches Vertrauen als Glaubensfähigkeit wird als eine Grundlage für stabile Beziehungen angesehen und deshalb als Ziel psychotherapeutischer, beraterischer und psychosozialer Arbeit angesehen.
d) Neurowissenschaftliche Psychologie – der »Credition«-Ansatz
Allen vier hier vorgestellten psychologischen Ansätzen ist gemeinsam, dass Glaube nicht wie gewöhnlich als religiöses Fürwahrhalten verstanden wird, sondern säkular einen fundamentalen Gehirnprozess beschreibt, der Wahrnehmungen bewertet und entscheidend zur Handlungsplanung und Entscheidungsfindung beiträgt.
1.1.3 Verhältnis von Religiosität, Spiritualität und Glaube
Während Glaube als Basis von Religiosität und Spiritualität angesehen werden kann (Skrzypińska, 2023), ist das Verhältnis von Religiosität zu Spiritualität ein hochkontroverses Thema. Frühere Ansätze unterstrichen die institutionelle Komponente von Religiosität und den persönlichen Charakter von Spiritualität so stark, dass sie Religiosität und Spiritualität als Gegensätze betrachteten. Jedoch zeigte sich empirisch, dass Menschen sich teilweise als religiös und spirituell bezeichnen (z. B. Zinnbauer et al., 1999). Dies gilt auch für Deutschland: Obwohl hierzulande immer weniger Menschen einen Bezug zur Religion und Kirche haben (Bertelsmann Stiftung, 2023, siehe Abbildung 1.2), gibt dennoch ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Bevölkerung an, spirituell (16 %) oder religiös und gleichzeitig spirituell zu sein (13 %; Gesis, 2018, siehe Abbildung 1.3).
Abbildung 1.2: Religiosität in Deutschland im Zeitvergleich (in %) (Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2023. Religionsmonitor kompakt – Die Zukunft der Kirchen, S. 3, © Bertelsmann Stiftung)
Abbildung 1.3: Verteilung der religiösen und spirituellen Selbsteinschätzung der deutschen Bevölkerung (Gesis, 2018)
Als Resultat solcher Ergebnisse betonen neuere Theorien (Hill et al., 2000; Krauss u. Hood, 2013; Skrzypińska, 2023) nun eine teilweise Überlappung oder sogar vollständige Überschneidung von Religiosität und Spiritualität, was in den Abbildungen 1.4, 1.5 und 1.6 dargestellt wird.
Abbildung 1.4: Spiritualität als Teil der Religiosität (nach Pargament, 1997)
Abbildung 1.5: Religiosität als Teil der Spiritualität (nach MacDonald, 2000)
Abbildung 1.6: Synthetisches Verständnis von Religiosität und Spiritualität (nach Streib u. Hood, 2016)
Für Pargament (1997, Abbildung 1.4) ist Spiritualität das Kernstück von Religiosität, wobei Religiosität jedoch breiter zu fassen ist: So gibt es z. B. Menschen, die die ideologische Seite ihrer Religion stark betonen und ihre Religion ohne spirituelle Essenz praktizieren. Wiederum glauben manche an eine Transzendenz, ohne sich einer Religion zugehörig fühlen. Diesem Umstand trägt Abbildung 1.5 Rechnung, welche u. a. auf MacDonalds (2000) Verständnis beruht, dass Religiosität ein möglicher Weg ist, eine Beziehung zu etwas Transzendentem zu erlangen, es jedoch noch weitere gibt, die nicht wie Religionen systematisch institutionalisiert sind (z. B. das Paranormale oder eine individuelle Spiritualität, die sich aus Teilen von verschiedenen Religionen zusammensetzt). Schließlich lehnen einige, wie Streib und Hood (2016), eine Trennung von Religiosität und Spiritualität gänzlich ab und sehen beide Konzepte als deckungsgleich an (Abbildung 1.6).
Einen weitaus komplexeren Ansatz bietet Skrzypińska mit einem psychologischen Modell über ein mögliches kognitives Schema. Dieses beinhaltet Glaube, Spiritualität und Religiosität sowie die Einstellung zum Leben, zur Transzendenz und schließlich eine resultierende Konsequenz, welche sich im Verhalten ausdrückt (siehe Box 1.1).
Box 1.1: Meaning Making Beliefs-Spirituality-Religiousness (MM B-S-R Model) von Skrzypińska (2023)
Auf Basis ihrer jahrzehntelangen empirischen Forschung entwickelte Katarzyna Skrzypińska ein Modell, das Einblicke in die psychologischen Prozesse von Religiosität, Spiritualität und Glaube verspricht. Glaubensüberzeugungen konstituieren sich dabei durch Ideen, die Individuen entsprechend ihren Bedürfnissen auswählen, und bilden die grundlegende Essenz einer Triade von miteinander zusammenhängenden Phänomenen: Religiosität, Spiritualität und Weltanschauung. Weltanschauung beinhaltet eine Reihe von Annahmen über sich selbst, die Welt und unseren Platz in ihr und basiert ebenso auf Glaubensüberzeugungen. Die Weltanschauung ist aber wesentlich strukturierter und systematischer und bringt oft auch einzelne Glaubensüberzeugungen in eine Hierarchie entsprechend ihrer Wichtigkeit.
Abbildung 1.7: Meaning Making Beliefs-Spirituality-Religiousness Model (nach Skrzypińska, 2023, S. 24)
In dem mittleren Überschneidungsbereich befindet sich die religiöse Spiritualität bzw. die spirituelle Religiosität. Diese entspricht dem Fall, in dem sich beide Phänomene gegenseitig ergänzen (z. B. wenn sich Spiritualität durch eine religiöse Praxis manifestiert). Zusammen mit der individuellen Weltanschauung konstituieren sie ein kognitives Schema, welches sich in einer Haltung zum Leben und zur Transzendenz zeigt (hier: zum Heiligen, inklusive einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Transzendenten) und sich schlussendlich im Verhalten manifestiert. Skrzypin´ska formuliert hier weiter aus, wie Glaube, Religiosität und Spiritualität dem menschlichen Verhalten Sinn und Zweck verleihen (siehe dazu ausführlich Kapitel 2).
1.1.4 Glaube »von innen« und »von außen«
Ein Problem psychologischer Religionsforschung stellt die strittige Frage nach der Neutralität der Forschenden dar. Das psychologische Verstehen von mitunter merkwürdig anmutenden Erfahrungen oder irrationaler Überzeugungen religiös Gläubiger ist eine besondere Herausforderung für die Forschung und psychologische Beratung.
Der Religionswissenschaftler und Theologe Rudolf Otto (1917/2004) hat vor über hundert Jahren dazu einen pragmatischen Vorschlag gemacht. Für ihn ist Religion die Erfahrung von etwas Heiligem oder auch des Numinosen, wie er es nannte (siehe auch Kapitel 10). Das bedeutet: Religion beginnt in den rational oft nicht erfassbaren Begegnungen des Menschen mit etwas ganz anderem. Sie beginnt mit einem Staunen und einem Berührtwerden von etwas, das Menschen später als grundlegend »heilig« erleben und dies somit als unhinterfragbar gültig und bedeutsam einstufen. Die Erfahrung des Heiligen begründet Otto vor allem in Gefühlen des Berührtwerdens, Erschauderns und der Faszination. Wenn überhaupt, sei Glaube zunächst nur aus einer Innenperspektive zu verstehen: »Wir fordern auf, sich auf ein Moment starker und möglichst einseitiger religiöser Erregtheit zu besinnen. Wer das nicht kann oder wer solche Momente überhaupt nicht hat, ist gebeten nicht weiterzulesen« (Otto, 1917/2004, S. 8). Der Psychologe William James, der eine ähnliche Phänomenologie, wenn auch mit anderen Methoden, vorschlug (mehr dazu in Kapitel 10), sah dies jedoch ganz anders. Er selbst bedauerte es wohl, keinen eigenen Bezug zum religiösen Glauben zu haben, obwohl er sich in seinen Arbeiten tiefgründig damit beschäftigte (James, 1902/2010). Einen Mittelweg schlägt Reich (1992) vor, der die ideale Voraussetzung der Religionspsychologinnen und -psychologen darin verortet, »die Motivation, das religiöse Einfühlungsvermögen und theologische Wissen eines wirklich Gläubigen zusammen mit der skeptischen Grundhaltung eines Nicht-Gläubigen« zu verbinden. Diesem Ansatz sieht sich auch unser Einführungsbuch verpflichtet: Erstens folgt es den klaren Regeln empirischer Sozialwissenschaften, zweitens behält es die Grenzen des vernünftigen Denkens im Blick. Gerade deshalb muss für ein besseres Verständnis der Glaubensdimension die persönliche, emotional verankerte Innendimension mitberücksichtigt werden. Der Autor und die Autorin dieses Einführungsbuchs bringen ihre Innenperspektive als Glaubende in zwei verschiedenen religiösen Traditionen (Protestantismus und Bahá’í-Religion) mit ein. Als wissenschaftlich Tätige sind sie gleichzeitig der überprüfbaren sozialwissenschaftlichen Außenperspektive verpflichtet.