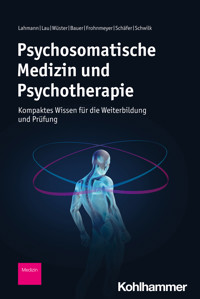
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Alltag in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie ist herausfordernd: Als ÄrztIn und TherapeutIn arbeiten Sie strukturiert und evidenzbasiert und sollen zugleich auf die individuellen Besonderheiten der PatientInnen eingehen. Dabei bleibt für eine fundierte Weiterbildung oft wenig Zeit. Dieses therapieschulenübergreifende Praxislehrbuch hilft Ihnen im klinischen Alltag und bei der gezielten Prüfungsvorbereitung mit anregenden Fragen und anschaulichen Antworten: Was sind die wichtigsten psychosomatischen Krankheitsbilder? Wie werden sie diagnostiziert und klassifiziert (nach ICD-10 und ICD-11)? Wie können die Entstehung und Behandlung der einzelnen Erkrankungen jeweils in der psychodynamischen, kognitiv-behavioralen und systemischen Theorie erklärt werden? Welche Psychopharmaka werden wann eingesetzt? Das grundlegende Wissen wird strukturiert und kompakt präsentiert, veranschaulicht durch zahlreiche Fallbeispiele, Illustrationen, Tabellen und Merke-Kästen. Damit ist dieses Praxislehrbuch der ideale Begleiter für Ihre Weiterbildung und (Facharzt-)Prüfung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Psychotherapie – Ein Überblick
1.1 Einleitung: Was ist Psychotherapie?
1.1.1 Was sind allgemeine Wirkprinzipien von Psychotherapie?
1.1.2 Indikationen: Wer benötigt eine Psychotherapie?
1.1.3 Diagnostik: Wie werden psychische Erkrankungen diagnostiziert?
1.1.4 Wie erfolgt die Aufklärung über Psychotherapie?
1.1.5 Wann sollte eine Psychotherapie beendet werden?
1.2 Therapie: Welche Therapieschulen gibt es?
1.2.1 Wie lautet die Definition von Gruppenpsychotherapie und worin bestehen die Vor- und Nachteile?
1.3 Was ist psychodynamische Psychotherapie?
1.3.1 Wie hat sich die psychodynamische Psychotherapie entwickelt?
1.3.2 Wie entsteht Psychopathologie aus psychodynamischer Perspektive?
1.3.3 Wie erfolgt die Diagnostik im Rahmen einer psychodynamischen Psychotherapie?
1.3.4 Wie erfolgt die Behandlung im Rahmen einer psychodynamischen Psychotherapie?
1.4 Was ist Verhaltenstherapie?
1.4.1 Wie hat sich die kognitive Verhaltenstherapie entwickelt?
1.4.2 Wie entsteht Psychopathologie aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
1.4.3 Wie erfolgt die Diagnostik im Rahmen einer verhaltenstherapeutischen Psychotherapie?
1.4.4 Wie erfolgt die Behandlung im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie?
1.5 Was ist systemische Therapie?
1.5.1 Wie hat sich die systemische Therapie entwickelt?
1.5.2 Wie entsteht Psychopathologie aus systemischer Perspektive?
1.5.3 Wie erfolgt die Diagnostik im Rahmen einer systemischen Psychotherapie?
1.5.4 Wie erfolgt die Behandlung im Rahmen einer systemischen Psychotherapie?
1.6 Individuelle Indikationskriterien: Welche psychotherapeutischen Settings gibt es und wer sollte wo behandelt werden?
1.6.1 Wann sollten Patient*innen psychiatrisch und wann psychosomatisch behandelt werden?
1.6.2 Wann werden Patient*innen ambulant, wann voll- und wann teilstationär psychosomatisch behandelt?
1.6.3 Was sind die Unterschiede zwischen einer psychosomatischen Akutbehandlung und einer Rehabilitationsmaßnahme?
Weiterführende Literatur
2 Depressive Störungen
2.1 Einleitung: Was sind depressive Störungen?
2.2 Relevanz: Warum ist das Thema depressive Störungen wichtig?
2.2.1 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
2.3 Klassifikation: Wie werden depressive Störungen klassifiziert?
2.3.1 Wann spricht man von einer chronischen Depression?
2.4 Differenzialdiagnosen: Welche affektiven Störungen sind noch wichtig?
2.4.1 Dysthymia – Wenn die Stimmung immer gedrückt ist
2.4.2 Manie – Wenn die Stimmung »zu gut« ist
2.4.3 Bipolare Störungen – Wenn die Stimmung Achterbahn fährt
2.4.4 Anpassungs- und Trauerreaktionen – Wenn die Trauer anhält
2.4.5 Postpartale Depression – Wenn die Stimmung nach der Entbindung anhaltend gedrückt ist
2.4.6 Prämenstruelle dysphorische Störung – Wenn die Stimmung vor jeder Menstruation abrutscht
2.4.7 Burnout – Wenn das innere Feuer erlischt
2.5 Diagnostik: Wie werden depressive Störungen diagnostiziert?
2.5.1 Wie sieht die gezielte Diagnostik bei depressiven Störungen aus?
2.5.2 Was sind häufig genutzte psychometrische Instrumente zur Diagnostik bei depressiven Störungen?
2.5.3 Wie kann beim Vorliegen einer depressiven Störung der psychopathologische Befund (nach AMDP) für die eingangs skizzierte Patientin »Anna« lauten?
2.5.4 Welche somatische Basisdiagnostik erfolgt bei depressiven Störungen?
2.6 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von depressiven Störungen erklären?
2.6.1 Welche psychosozialen Risikofaktoren gibt es für die Entwicklung einer depressiven Störung?
2.6.2 Wie erklärt sich die Entstehung von depressiven Störungen aus psychodynamischer Perspektive?
2.6.3 Wie erklärt sich die Entstehung von depressiven Störungen aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
2.6.4 Wie erklärt sich die Entstehung von depressiven Störungen aus systemischer Perspektive?
2.6.5 Wie erklärt sich die Entstehung von depressiven Störungen aus neurobiologischer Perspektive?
2.7 Therapie: Wie werden depressive Störungen behandelt?
2.7.1 Welche Life-Style-Faktoren können den Verlauf depressiver Störungen günstig beeinflussen?
2.7.2 Wie werden depressive Störungen in der psychodynamischen Psychotherapie behandelt?
2.7.3 Wie werden depressive Störungen in der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt?
2.7.4 Wie werden depressive Störungen in der systemischen Therapie behandelt?
2.7.5 Wie werden depressive Störungen medikamentös behandelt?
Weiterführende Literatur
3 Angststörungen
3.1 Einleitung: Was sind Angststörungen?
3.2 Relevanz: Warum ist das Thema Angststörungen wichtig?
3.3 Klassifikation: Wie werden Angststörungen klassifiziert?
3.3.1 Agoraphobie – Wenn die Möglichkeit, nicht fliehen zu können, Angst macht
3.3.2 Soziale Phobie – Wenn die Blicke der anderen Angst machen
3.3.3 Spezifische Phobie – Wenn bestimmte Gegenstände, Tiere oder Situationen Angst machen
3.3.4 Panikstörung – Wenn die Angstattacke aus heiterem Himmel kommt
3.3.5 Generalisierte Angststörung – Wenn die Sorgen ständige Begleiter sind
3.4 Diagnostik: Wie werden Angststörungen diagnostiziert?
3.4.1 Wie sieht die gezielte Diagnostik bei Angststörungen aus?
3.4.2 Was sind häufig genutzte psychometrische Instrumente zur Diagnostik bei Angststörungen?
3.4.3 Wie kann beim Vorliegen einer Angststörung der psychopathologische Befund (nach AMDP) für die eingangs skizzierten Patientinnen »Julia« und »Kathrin« lauten?
3.4.4 Welche wichtigen Differenzialdiagnosen zu Angststörungen gibt es?
3.4.5 Wie sieht die Hierarchie der Diagnosen nach ICD-10 aus?
3.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Angststörungen erklären?
3.5.1 Wie erklärt sich die Entstehung von Angststörungen aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
3.5.2 Wie erklärt sich die Entstehung von Angststörungen aus psychodynamischer Perspektive?
3.5.3 Wie erklärt sich die Entstehung von Angststörungen aus systemischer Perspektive?
3.5.4 Wie erklärt sich die Entstehung von Angststörungen aus neurobiologischer Perspektive?
3.6 Therapie: Wie werden Angststörungen behandelt?
3.6.1 Wie werden Angststörungen in der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt?
3.6.2 Wie werden Angststörungen in der psychodynamischen Psychotherapie behandelt?
3.6.3 Wie werden Angststörungen in der systemischen Therapie behandelt?
3.6.4 Wie werden Angststörungen medikamentös behandelt?
Weiterführende Literatur
4 Zwangsstörungen
4.1 Einleitung: Was sind Zwangsstörungen?
4.2 Relevanz: Warum ist das Thema Zwangsstörungen wichtig?
4.2.1 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
4.3 Klassifikation: Wie werden Zwangsstörungen klassifiziert?
4.4 Diagnostik: Wie werden Zwangsstörungen diagnostiziert?
4.4.1 Wie sieht die gezielte Diagnostik bei Zwangsstörungen aus?
4.4.2 Was sind häufig genutzte psychometrische Instrumente zur Diagnostik bei Zwangsstörungen?
4.4.3 Wie kann beim Vorliegen einer Zwangsstörung der psychopathologische Befund (nach AMDP) für die eingangs skizzierte Patientin »Lena« lauten?
4.4.4 Welche wichtigen Differenzialdiagnosen zu Zwangsstörungen gibt es?
4.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Zwangsstörungen erklären?
4.5.1 Wie erklärt sich die Entstehung von Zwangsstörungen aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
4.5.2 Wie erklärt sich die Entstehung von Zwangsstörungen aus psychodynamischer Perspektive?
4.5.3 Wie erklärt sich die Entstehung von Zwangsstörungen aus systemischer Perspektive?
4.5.4 Wie erklärt sich die Entstehung von Zwangsstörungen aus neurobiologischer Perspektive?
4.6 Therapie: Wie werden Zwangsstörungen behandelt?
4.6.1 Wie werden Zwangsstörungen in der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt?
4.6.2 Wie werden Zwangsstörungen in der psychodynamischen Psychotherapie behandelt?
4.6.3 Wie werden Zwangsstörungen in der systemischen Therapie behandelt?
4.6.4 Wie werden Zwangsstörungen medikamentös behandelt?
4.6.5 Wie ist die Prognose bei einer Zwangsstörung?
Weiterführende Literatur
5 Traumata und Traumafolgestörungen
5.1 Einleitung: Was sind Traumata und Traumafolgestörungen?
5.1.1 Definition: Was ist ein Trauma?
5.1.2 Definition: Was sind Traumafolgestörungen?
5.2 Die akute Belastungsreaktion – Wenn die Psyche situativ überfordert ist
5.2.1 Einleitung: Was ist eine akute Belastungsreaktion bzw. Stressreaktion?
5.2.2 Klassifikation: Wie werden akute Belastungsreaktionen klassifiziert?
5.2.3 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von akuten Belastungsreaktionen erklären?
5.2.4 Therapie: Wie werden akute Belastungsreaktionen behandelt?
5.3 Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (kPTBS) – Wenn das Gespenst des Schreckens sich nicht mehr vertreiben lässt
5.3.1 Einleitung: Was sind PTBS und kPTBS?
5.3.2 Relevanz: Warum ist das Thema PTBS und kPTBS wichtig?
5.3.3 Klassifikation: Wie werden PTBS und kPTBS klassifiziert?
5.3.4 Diagnostik: Wie werden PTBS und kPTBS diagnostiziert?
5.3.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von PTBS und kPTBS erklären?
5.3.6 Therapie: Wie werden Traumafolgestörungen, insbesondere PTBS und kPTBS, behandelt?
5.4 Anpassungsstörung – Wenn es schwer fällt, sich auf eine neue Situation einzustellen
5.4.1 Einleitung: Was ist eine Anpassungsstörung?
5.4.2 Relevanz: Warum ist das Thema Anpassungsstörung wichtig?
5.4.3 Klassifikation: Wie werden Anpassungsstörungen klassifiziert?
5.4.4 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung einer Anpassungsstörung erklären?
5.4.5 Therapie: Wie werden Anpassungsstörungen behandelt?
Weiterführende Literatur
6 Funktionelle Körperbeschwerden: Somatoforme und dissoziative Störungen
6.1 Einleitung: Was sind funktionelle Körperbeschwerden?
6.2 Relevanz: Warum ist das Thema funktionelle Körperbeschwerden wichtig?
6.2.1 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
6.3 Klassifikation: Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen klassifiziert?
6.3.1 Differenzialdiagnostik: Was zeichnet die einzelnen somatoformen Störungen aus?
6.3.2 Differenzialdiagnostik: Was zeichnet die einzelnen dissoziativen Störungen aus?
6.3.3 Differenzialdiagnostik: Was zeichnet die einzelnen somatoformen Störungen des Gedächtnisses, der Identität und des Bewusstseins aus?
6.4 Diagnostik: Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen diagnostiziert?
6.4.1 Wie sieht die gezielte Diagnostik bei funktionellen Körperbeschwerden aus?
6.4.2 Was sind häufig genutzte psychometrische Instrumente zur Diagnostik bei somatoformen und dissoziativen Störungen?
6.4.3 Welche gezielte somatische Basisdiagnostik erfolgt bei somatoformen und dissoziativen Störungen?
6.4.4 Wie kann beim Vorliegen funktioneller Körperbeschwerden der psychopathologische Befund (nach AMDP) für die eingangs skizzierten Patient*innen »Ben« und »Susanne« lauten?
6.4.5 Welche wichtigen Differenzialdiagnosen zu somatoformen und dissoziativen Störungen gibt es?
6.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von somatoformen und dissoziativen Störungen erklären?
6.5.1 Wie erklärt sich die Entstehung von somatoformen und dissoziativen Störungen aus psychodynamischer Perspektive?
6.5.2 Wie erklärt sich die Entstehung von somatoformen und dissoziativen Störungen aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
6.5.3 Wie erklärt sich die Entstehung von somatoformen und dissoziativen Störungen aus systemischer Perspektive?
6.5.4 Wie erklärt sich die Entstehung von somatoformen und dissoziativen Störungen aus neurobiologischer Perspektive?
6.6 Therapie: Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen behandelt?
6.6.1 Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen in der psychodynamischen Psychotherapie behandelt?
6.6.2 Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen in der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt?
6.6.4 Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen in der systemischen Therapie behandelt?
6.6.5 Wie werden somatoforme und dissoziative Störungen medikamentös behandelt?
6.7 Prognose
Weiterführende Literatur
7 Essstörungen und Adipositas
7.1 Einleitung: Was sind Essstörungen?
7.2 Relevanz: Warum ist das Thema Essstörungen wichtig?
7.2.1 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
7.3 Klassifikation: Wie werden Essstörungen klassifiziert?
7.3.1 Anorexia nervosa – Wenn man sich trotz Untergewicht »fett« fühlt
7.3.2 Bulimia nervosa – Wenn der Teufelskreis aus Essen und Erbrechen nie endet
7.3.3 Binge-Eating-Störung – Wenn die Essattacke nicht aufhört
7.4 Diagnostik: Wie werden Essstörungen diagnostiziert?
7.4.1 Wie sieht die gezielte Diagnostik bei Essstörungen aus?
7.4.2 Was sind häufig genutzte psychometrische Instrumente zur Diagnostik bei Essstörungen?
7.4.3 Welche somatische Basisdiagnostik erfolgt bei Essstörungen?
7.4.4 Wie kann beim Vorliegen einer Bulimia nervosa der psychopathologische Befund (nach AMDP) für die eingangs skizzierte Patientin »Annette« lauten?
7.4.5 Welche wichtigen Differenzialdiagnosen zu Essstörungen gibt es?
7.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Essstörungen erklären?
7.5.1 Wie erklärt sich die Entstehung von Essstörungen aus psychodynamischer Perspektive?
7.5.2 Wie erklärt sich die Entstehung von Essstörungen aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
7.5.3 Wie erklärt sich die Entstehung von Essstörungen aus systemischer Perspektive?
7.5.4 Wie erklärt sich die Entstehung von Essstörungen aus (neuro-)biologischer Perspektive?
7.6 Therapie: Wie werden Essstörungen behandelt?
7.6.1 Welche Behandlungsverfahren können bei Essstörungen zum Einsatz kommen?
7.6.2 Wie werden Essstörungen in der psychodynamischen Psychotherapie behandelt?
7.6.3 Wie werden Essstörungen in der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt?
7.6.4 Wie werden Essstörungen in der systemischen Therapie behandelt?
7.6.5 Wie werden Essstörungen medikamentös behandelt?
7.7 Prognose: Welchen Verlauf nehmen Essstörungen?
Weiterführende Literatur
8 Persönlichkeitsstörungen
8.1 Einleitung: Was sind Persönlichkeitsstörungen?
8.2 Relevanz: Warum ist das Thema Persönlichkeitsstörungen wichtig?
8.2.1 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
8.3 Klassifikation: Wie werden Persönlichkeitsstörungen klassifiziert?
8.3.1 Differenzialdiagnostik: Was zeichnet die einzelnen Persönlichkeitsstörungen aus?
8.4 Diagnostik: Wie werden Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert?
8.4.1 Wie sieht die gezielte Diagnostik bei Persönlichkeitsstörungen aus?
8.4.2 Was sind häufig genutzte psychometrische Instrumente zur Diagnostik bei Persönlichkeitsstörungen?
8.4.3 Wie kann beim Vorliegen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung der psychopathologische Befund (nach AMDP) für die eingangs skizzierte Patientin »Stefanie« lauten?
8.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen erklären?
8.5.1 Wie erklärt sich die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen aus psychodynamischer Perspektive?
8.5.2 Wie erklärt sich die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen aus kognitiv-behavioraler Perspektive?
8.5.3 Wie erklärt sich die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen aus systemischer Perspektive?
8.5.4 Wie erklärt sich die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen aus neurobiologischer Perspektive?
8.6 Therapie: Wie werden Persönlichkeitsstörungen behandelt?
8.6.1 Wie werden Persönlichkeitsstörungen in der psychodynamischen Psychotherapie behandelt?
8.6.2 Wie werden Persönlichkeitsstörungen in der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt?
8.6.3 Wie werden Persönlichkeitsstörungen in der systemischen Therapie behandelt?
8.6.4 Wie werden Persönlichkeitsstörungen medikamentös behandelt?
Weiterführende Literatur
9 Sexuelle Funktionsstörungen, Geschlechtsinkongruenz und paraphile Störungen
9.1 Sexuelle Funktionsstörungen
9.1.1 Einleitung: Was sind sexuelle Funktionsstörungen?
9.1.2 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
9.1.3 Klassifikation: Wie werden sexuelle Funktionsstörungen klassifiziert?
9.1.4 Diagnostik: Wie werden sexuelle Funktionsstörungen diagnostiziert?
9.1.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von sexuellen Funktionsstörungen erklären?
9.1.6 Therapie: Wie werden sexuelle Funktionsstörungen behandelt?
9.2 Geschlechtsinkongruenz
9.2.1 Einleitung: Was ist Geschlechtsinkongruenz?
9.2.2 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
9.2.3 Klassifikation: Wie wird Geschlechtsinkongruenz klassifiziert?
9.2.4 Diagnostik: Wie wird Geschlechtsinkongruenz diagnostiziert?
9.2.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Geschlechtsinkongruenz erklären?
9.2.6 Therapie: Wie wird Geschlechtsinkongruenz behandelt?
9.3 Paraphile Störungen
9.3.1 Einleitung: Was sind paraphile Störungen?
9.3.2 Epidemiologie oder Wo liegt das Problem?
9.3.3 Klassifikation: Wie werden paraphile Störungen klassifiziert?
9.3.4 Diagnostik: Wie werden paraphile Störungen diagnostiziert?
9.3.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von paraphilen Störungen erklären?
9.3.6 Therapie: Wie werden paraphile Störungen behandelt?
Weiterführende Literatur
10 Konsil- und Liaisonpsychosomatik
10.1 Einleitung: Was ist Konsil- und Liaisonpsychosomatik?
10.1.1 Worin bestehen die Aufgaben im psychosomatischen Konsildienst?
10.2 Bewältigungsmodelle: Wie gehen Menschen mit schweren Krankheiten und bevorstehendem Tod um?
10.2.1 Krankheitsbewältigung: Welche Coping-Strategien gibt es?
10.2.2 Umgang mit dem Tod: Welche emotionalen Reaktionen sind häufig?
10.3 Therapie: Wie wird im psychosomatischen Konsil- und Liaisondienst gearbeitet?
10.3.1 Wie können Ressourcen aktiviert werden?
10.3.2 Welche Entspannungsverfahren können angewendet werden?
10.3.3 Wie können Krankheitsbewältigung und Coping gefördert werden?
10.3.4 Wie kann mit existenziellen Themen wie Endlichkeit, Sterben und Tod umgegangen werden?
10.4 Was sind beispielhafte Arbeitsbereiche des psychosomatischen Konsil- und Liaisondienstes?
10.4.1 Was ist Psychoonkologie?
10.4.2 Was ist Psychokardiologie?
10.4.3 Was ist Psychopneumologie?
10.4.4 Welche Rolle spielt die Psychosomatik in der Neurologie?
10.4.5 Wie sieht eine konsiliarische Mitbehandlung bei Essstörungen aus?
10.4.6 Welche Rolle spielt die Psychosomatik in der Intensivmedizin?
10.4.7 Welche Rolle spielt die Psychosomatik in der Transplantationsmedizin?
10.5 Welches Krankheitsbild spielt im psychosomatischen Konsil- und Liaisondienst eine wichtige Rolle?
10.5.1 Einleitung: Was ist ein Delir?
10.5.2 Relevanz: Warum ist das Thema Delir wichtig?
10.5.3 Klassifikation: Wie wird das Delir klassifiziert?
10.5.4 Diagnostik: Wie wird ein Delir diagnostiziert?
10.5.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung eines Delirs erklären?
10.5.6 Therapie: Wie wird das Delir behandelt?
Weiterführende Literatur
11 Psychosomatische Notfälle
11.1 Akute dissoziative Zustände
11.1.1 Einleitung: Was sind dissoziative Zustände?
11.1.2 Relevanz: Warum ist das Thema dissoziative Zustände wichtig?
11.1.3 Diagnostik: Wie werden dissoziative Zustände diagnostiziert?
11.1.4 Therapie: Wie wird bei dissoziativen Zuständen gehandelt?
11.2 Selbstverletzendes Verhalten
11.2.1 Einleitung: Was ist selbstverletzendes Verhalten?
11.2.2 Relevanz: Warum ist das Thema selbstverletzendes Verhalten wichtig?
11.2.3 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung selbstverletzenden Verhaltens erklären?
11.2.4 Therapie: Wie wird nach einer Selbstverletzung gehandelt?
11.3 Suizidalität
11.3.1 Relevanz: Warum ist das Thema Suizidalität wichtig?
11.3.2 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Suizidalität erklären?
11.3.3 Therapie: Wie wird bei akuter Suizidalität gehandelt?
Weiterführende Literatur
12 Psychiatrische Störungsbilder
12.1 Demenz – Wenn die Merkfähigkeit schwindet
12.1.1 Einleitung: Was ist eine Demenz?
12.1.2 Relevanz: Warum ist das Thema Demenz wichtig?
12.1.3 Klassifikation: Wie werden Demenzen klassifiziert?
12.1.4 Diagnostik: Wie werden Demenzen diagnostiziert?
12.1.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Demenzen erklären?
12.1.6 Therapie: Wie werden Demenzen behandelt?
12.2 Störungen durch Substanzkonsum und abhängige Verhaltensweisen am Beispiel von Störungen durch Alkohol – Wenn man »nicht mehr davon loskommt«
12.2.1 Einleitung: Was sind Störungen durch Substanzkonsum oder abhängige Verhaltensweisen?
12.2.2 Relevanz: Warum ist das Thema Störungen durch Substanzkonsum und abhängige Verhaltensweisen (am Beispiel von Störungen durch Alkohol) wichtig?
12.2.3 Klassifikation: Wie werden Störungen durch Substanzgebrauch klassifiziert?
12.2.4 Diagnostik: Wie werden Störungen durch Substanzkonsum und abhängige Verhaltensweisen diagnostiziert?
12.2.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Störungen durch Substanzkonsum und abhängiger Verhaltensweisen erklären?
12.2.6 Therapie: Wie werden Störungen durch Substanzkonsum und abhängige Verhaltensweisen behandelt?
12.3 Schizophrenien – Wenn Halluzinationen und Wahn die Wahrnehmung verzerren
12.3.1 Relevanz: Warum ist das Thema Schizophrenien wichtig?
12.3.2 Klassifikation: Wie werden Schizophrenien klassifiziert?
12.3.3 Diagnostik: Wie wird eine Schizophrenie diagnostiziert?
12.3.4 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Schizophrenien erklären?
12.3.5 Therapie: Wie werden Schizophrenien behandelt?
12.4 Autismus-Spektrum-Störungen – Wenn Kommunikation und Verhalten starr und stereotyp sind
12.4.1 Einleitung: Was sind Autismus-Spektrum-Störungen?
12.4.2 Relevanz: Warum ist das Thema Autismus-Spektrum-Störungen wichtig?
12.4.3 Klassifikation: Wie werden Autismus-Spektrum-Störungen klassifiziert?
12.4.4 Diagnostik: Wie werden Autismus-Spektrum-Störungen diagnostiziert?
12.4.5 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung von Autismus-Spektrum-Störungen erklären?
12.4.6 Therapie: Wie werden Autismus-Spektrum-Störungen behandelt?
12.5 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) – Wenn Unaufmerksamkeit und Impulsivität das Leben unübersichtlich machen
12.5.1 Relevanz: Warum ist das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) auch im Erwachsenenalter wichtig?
12.5.2 Klassifikation: Wie wird die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) klassifiziert?
12.5.3 Diagnostik: Wie wird eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert?
12.5.4 Ätiologiemodelle: Wie lässt sich die Entstehung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erklären?
12.5.5 Therapie: Wie wird die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) behandelt?
Weiterführende Literatur
13 Psychopharmakologische Behandlung im psychosomatischen Kontext
13.1 Einleitung: Wie werden Psychopharmaka im psychosomatischen Kontext verwendet?
13.1.1 Auswahl: Wie werden Psychopharmaka ausgewählt?
13.1.2 Dosierung: Wie werden Psychopharmaka im psychosomatischen Kontext eingenommen?
13.1.3 Nichtansprechen: Wie ist das Vorgehen, wenn Psychopharmaka nicht die gewünschte Wirkung zeigen?
13.1.4 Absetzen: Wann und wie können Psychopharmaka wieder abgesetzt werden?
13.1.5 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAWs): Welche UAWs können potenziell lebensbedrohlich sein?
13.2 Übersicht: Welche Antidepressiva werden im psychosomatischen Kontext angewendet?
13.3 Übersicht: Welche Antipsychotika werden im psychosomatischen Kontext angewendet?
13.4 Übersicht: Welche weiteren Psychopharmaka werden im psychosomatischen Kontext angewendet?
13.5 Therapie: Wie werden Schlafstörungen medikamentös behandelt?
Weiterführende Literatur
Literatur
Sachwortverzeichnis
Die Autor*innen
Univ.-Prof. Dr. med. Claas Lahmann, Ärztl. Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg; Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Spez. Schmerztherapie, Psychoanalyse, Executive Master of Change. Klinische und Interessensschwerpunkte: u. a. somatoforme Störungen und Arbeitspsychosomatik.
Dr. med. Inga Lau, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (TP) und systemische Therapeutin (DGSF). Klinische und Interessensschwerpunkte: Essstörungen, Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT), Mentalisieren des Körpers und Gruppentherapie.
Dr. med. Anne-Louise Wüster, MA, angehende Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (TP). Freiberufliche Rhetoriktrainerin, u. a. im Bereich Arzt-Patienten-Kommunikation. Klinische und Interessensschwerpunkte: Affektive Störungen, Gruppentherapie, Psychotherapie im Gehen in der Natur.
PD Dr. Prisca Bauer, MSc, PhD, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (TP). Klinische und Interessensschwerpunkte: Affektive Störungen, dissoziative und somatoforme Störungen, Konsilpsychosomatik, Embodiment und Phänomenologie.
Dr. med. Eva Frohnmeyer, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (VT) sowie systemische Therapeutin (DGSF). Klinische und Interessensschwerpunkte: Essstörungen, Traumafolgestörungen, Mehrpersonensetting, Psychotherapie mit Adoleszenten und jungen Erwachsenen.
Dr. med. Laura Schäfer, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (TP), in Weiterbildung zur Zusatzbezeichnung Psychoanalyse. Klinische und Interessensschwerpunkte: Psychodynamische Therapie, Essstörungen, Traumafolgestörungen und dissoziative Störungen.
Dr. med. Nora Schwilk, in Weiterbildung zur Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit Zusatzbezeichnung Psychoanalyse am Universitätsklinikum Freiburg und am Aus- und Weiterbildungsinstitut für psychoanalytische und tiefenpsychologische Psychotherapie (AWI). Klinische und Interessensschwerpunkte: Psychodynamische Therapie.
Claas LahmannInga LauAnne-Louise WüsterPrisca BauerEva FrohnmeyerLaura SchäferNora Schwilk
Psychosomatische Medizinund Psychotherapie
Kompaktes Wissen für die Weiterbildung und Prüfung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Mit Grafiken von Romi Preiter (Instagram: romi_preiter)1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043976-4
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043977-1epub: ISBN 978-3-17-043978-8
Vorwort
Das Gebiet der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie hat sich in den letzten Jahren so stark weiterentwickelt und ausdifferenziert, dass es kaum möglich ist, alle ätiologischen Krankheitsmodelle und psychotherapeutischen Behandlungsansätze im Detail parat zu haben. Hier kann das »Eisbärenprinzip« hilfreich sein: Wenn das Eis Schollen bildet, ist es wichtig, dass die nächste Scholle immer nur einen Sprung entfernt ist. In der Prüfungssituation heißt das, zu allen bedeutsamen Krankheitsbildern immer mindestens so viel Wissen parat zu haben, dass man es bis zur nächsten Wissensscholle schafft. Dies stellt auch im klinischen Alltag sicher, dass man nicht ins Schwimmen gerät, sondern immer einen breiten Überblick behält (um spezifische Fragestellungen im Bedarfsfall konkret nachlesen zu können).
Die Idee für dieses Buch entstand in unserem klinikinternen »Fachärzt*innenteaching«, welches seit einigen Jahren fester Bestandteil der ärztlichen Weiterbildung in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg ist. Im Kreis der Autor*innen haben wir regelmäßig alle wichtigen Störungsbilder durchgearbeitet und in Anlehnung an unsere Eisbären-Metapher folgende »Eisschollen« definiert, die man für alle wichtigen psychosomatischen Krankheitsbilder im Blick haben sollte:
1.
Eine einprägsame Fallvignette zur Memorierung und Illustration der Klinik
2.
Eine Zahl als essenzieller epidemiologischer Eckpunkt
3.
Die wichtigsten Diagnosekriterien nach ICD-10 und ICD-11
4.
Die wichtigsten psychometrischen Instrumente
5.
Jeweils mindestens ein ätiologisches Modell aus Psychodynamik, kognitiver Verhaltenstherapie, systemischer Therapie sowie Neurobiologie
6.
Die grundlegenden Behandlungsansätze aus Psychodynamik, kognitiver Verhaltenstherapie, systemischer Therapie und Psychopharmakotherapie
Oft haben wir uns während des Fachärzt*innenteachings Notizen gemacht, um die Inhalte so übersichtlich – d. h. in einer kompakten, systematischen und schulenübergreifenden Form – auch später noch nachlesen zu können. So entstand dieses Lehr-, Lern- und Praxisbuch als Gemeinschaftswerk von Professor Lahmann und den Assistenzärztinnen der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Besonderen Wert haben wir dabei auf prägnante Formulierungen und eine didaktisch anregende Darstellung gelegt. Viele Überschriften sind als Fragen formuliert, um schon beim ersten Lesen zum Mitlernen anzuregen. Praxisnahe Fallbeispiele flankieren das übersichtlich und kompakt zusammengefasste Wissen; eingängige Fallbeispiele und Grafiken sorgen für kurzweilige und effiziente Lernerfahrungen. Und nie bleiben die Inhalte auf einer theoretischen Ebene stecken, sondern es werden konkrete Strategien für Diagnostik und Therapie im klinischen Alltag aufgezeigt. Damit liefert das Buch auch eine solide Grundlage für die Psychosomatische Grundversorgung in allen klinischen Fachbereichen sowie schulenübergreifendes Basiswissen für die Zusatzbezeichnung Psychotherapie und die psychosomatische Facharztweiterbildung.
Die Rohfassung des Manuskripts hat den Praxistest bereits erfolgreich bestanden: Mehrere Autorinnen haben sich damit erfolgreich auf die Facharztprüfung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie vorbereitet.
Unser besonderer Dank gilt den Kolleginnen Alexandra Hagen und Sonja Lienhart, die uns durch kritische Durchsicht des Manuskripts und emotionale Ermutigungen ganz wesentlich unterstützt haben. Außerdem danken wir unseren erfahrenen Mentor*innen Almut Zeeck, Manon Feuchtinger, Elke Reinert, Andrea Kuhnert, Derek Spieler, Lukas Frase und Stefan Schmidt für die Durchsicht einzelner Kapitel und wertvolle inhaltliche Anregungen. Und nicht zuletzt danken wir unserer Kollegin Romi Preiter für die maßgezeichneten Abbildungen.
Wir sind sicher, dass auch Sie nach der Lektüre dieses Buches weder klinisch ins Schwimmen geraten noch in Prüfungssituationen nasse Füße bekommen werden.
Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre und alles Gute!Ihr Autor*innenteam
PS:Dieses Buch ist eine Teamleistung. Es wurde durch eine kreative Zusammenarbeit mit intensiver Auseinandersetzung und gegenseitigen Inspirationen lebendig.
Eine Schlüsselrolle in der Entstehung des Buches hatte Claas Lahmann: Er ist hauptverantwortlich für die Konzeption und inhaltliche Umsetzung des Werks. Seine sorgfältigen Korrekturen und sein beständiges, konstruktives Feedback führten zur Optimierung aller Kapitel, ihrem stringenten Aufbau und der Sicherstellung der inhaltlichen Korrektheit. Unterstützt wurde er dabei von Inga Lau (Projektmanagement) und Anne-Louise Wüster (Mitgestaltung didaktisches Konzept und Teamkommunikation).
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Autor*innen zeigt folgende Aufstellung:
Psychotherapie: Inga Lau, Prisca Bauer, Laura Schäfer, Anne-Louise Wüster, Eva Frohnmeyer, Claas Lahmann
Depressive Störungen: Anne-Louise Wüster, Inga Lau, Eva Frohnmeyer, Prisca Bauer, Claas Lahmann
Angststörungen: Anne-Louise Wüster, Prisca Bauer, Laura Schäfer, Eva Frohnmeyer, Inga Lau, Claas Lahmann
Zwangsstörungen: Eva Frohnmeyer, Anne-Louise Wüster, Prisca Bauer, Inga Lau, Claas Lahmann
Trauma und Traumafolgestörungen: Nora Schwilk, Laura Schäfer, Inga Lau, Claas Lahmann
Funktionelle Körperbeschwerden: Claas Lahmann, Laura Schäfer, Prisca Bauer, Inga Lau, Anne-Louise Wüster
Essstörungen und Adipositas: Eva Frohnmeyer, Inga Lau, Claas Lahmann
Persönlichkeitsstörungen: Anne-Louise Wüster, Prisca Bauer, Inga Lau, Claas Lahmann
Sexuelle Funktionsstörungen u. a.: Eva Frohnmeyer, Inga Lau, Claas Lahmann
Konsil- und Liasonpsychosomatik: Inga Lau, Prisca Bauer, Eva Frohnmeyer, Laura Schäfer, Claas Lahmann
Psychosomatische Notfälle: Prisca Bauer, Inga Lau, Claas Lahmann
Psychiatrische Störungsbilder: Anne-Louise Wüster, Prisca Bauer, Eva Frohnmeyer, Inga Lau, Claas Lahmann
Psychopharmakologische Behandlung: Prisca Bauer, Anne-Louise Wüster, Inga Lau, Eva Frohnmeyer, Claas Lahmann
1 Psychotherapie – Ein Überblick
1.1 Einleitung: Was ist Psychotherapie?
Psychotherapie ist eine interpersonelle Interaktion, anhand derer unerwünschtes Verhalten oder durch interpersonelle Probleme verursachtes Leiden mithilfe einer professionellen und definierten Behandlungsmethode verändert werden soll. Dabei können ein*e oder mehrere Patient*innen und Therapeut*innen beteiligt sein. Die therapeutische Grundhaltung umfasst dabei Einfühlung, Empathie und ein authentisches Interesse an und wertfreie Akzeptanz von Patient*innen und deren Leid.
1.1.1 Was sind allgemeine Wirkprinzipien von Psychotherapie?
Die Wirksamkeit von Psychotherapie ist empirisch gut belegt. Im Vergleich zur medikamentösen Therapie ist die Adhärenz besser und weniger Patient*innen brechen die Therapie ab. Nichtsdestotrotz bleibt die Symptomatik in 20 – 30 % der Fälle unverändert, in 5 – 10 % der Fälle wird sie sogar schlechter, weshalb vor Therapiebeginn eine entsprechende Aufklärung wichtig ist.
Neben spezifischen Wirkfaktoren, die die Wirkung von konkreten Therapiemethoden beschreiben, gibt es allgemeine Wirkfaktoren, die für alle Therapieformen gelten. Edward Bordin beschrieb 1979 die sogenannte Therapeutische Allianz als Ergebnis aus Übereinstimmung zwischen therapeutischen Aufgaben und Therapiezielen einerseits und der Qualität der emotionalen Bindung zwischen Patient*in und Therapeut*in andererseits.
Merke
Die therapeutische Beziehung gilt als wichtigster allgemeiner Wirkfaktor in einer Psychotherapie.
Klaus Grawe postulierte im Jahr 2000 fünf allgemeine Wirkfaktoren der Psychotherapie:
1.
Therapeutische Beziehung: Die Qualität der therapeutischen Beziehung wird durch Empathie, Akzeptanz und Wertschätzung geprägt. Zudem sollte die Beziehung möglichst verlässlich sein.
2.
Problemaktualisierung: Die Thematik ist unmittelbar erlebbar (z. B. durch Übertragung/Gegenübertragung, Exposition oder systemische Musterwiederholung).
3.
Ressourcenaktivierung: Im therapeutischen Setting werden Bewältigungsmöglichkeiten spürbar.
4.
Problembewältigung: Die Thematik kann unmittelbar verändert werden (z. B. durch korrigierende Beziehungserfahrungen, Expositionserfolg).
5.
Motivationale Klärung: Durch die Interventionen erfahren Patient*innen mehr über ihre Bedürfnisse und Ziele.
1.1.2 Indikationen: Wer benötigt eine Psychotherapie?
Etwa ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland leidet an psychischen Erkrankungen, die behandelt werden können. Psychische Erkrankungen werden anhand von Kriterien definiert, die in der »International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems« (ICD, deutsch: »Internationale Klassifikation der Krankheiten«) festgehalten sind. Aktuell wird in Deutschland von Version ICD-10 auf ICD-11 umgestellt, wobei sich einige Definitionen ändern. Damit die Kosten einer Psychotherapie von einer Krankenkasse übernommen werden, ist eine Diagnose nach ICD notwendig und es muss ein erstattungsfähiges Therapieverfahren gewählt werden (▸ Kap. 1.2).
Zusätzlich gilt es, Gebote der »Notwendigkeit« und »Wirtschaftlichkeit« zu befolgen, wie im Sozialgesetzbuch V als »Wirtschaftlichkeitsgebot« ausgeführt: Eine Therapie sollte nur durchgeführt werden, wenn gute Aussichten bestehen, dass nach der Behandlung eine nachhaltige Besserung auftritt. Bei der Auswahl der Therapie ist es wichtig, eine kostengünstige Option zu bevorzugen, solange sie ähnlich wirksam ist wie teurere Alternativen. Zum Beispiel kann eine Einzelpsychotherapie zwar fachlich vertretbar, aber nicht zwingend erforderlich sein, wenn Selbsthilfegruppen vergleichbare Ergebnisse erzielen können.
Psychotherapeutische Unterstützung kann aber auch bei belastenden Lebensereignissen (z. B. Scheidung) oder körperlichen Erkrankungen (z. B. Tumorleiden) notwendig und hilfreich sein (▸ Kap. 10 »Konsil- und Liaisonpsychosomatik«). Darüber hinaus gibt es körperliche Symptome, welche sich primär durch psychische Prozesse erklären lassen oder durch diese aufrechterhalten werden (▸ Kap. 6 »Funktionelle Störungen«).
Exkurs: Bio-psycho-soziales Modell
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts führten biomechanische (»Medizin der seelenlosen Körper«) oder biosemiotische Paradigmen (»Medizin der körperlosen Seele«) dazu, dass viele Krankheiten als entweder ausschließllich körperlich oder ausschließlich psychisch bedingt gesehen und dementsprechend behandelt wurden. 1977 entwickelte der Internist und Psychiater Georg L. Engel das bio-psycho-soziale Modell als allgemeines Erklärungsmodell der Krankheitsentstehung. Darin werden biologische, psychische und soziale Faktoren nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern als sich wechselseitig beeinflussend in Bezug auf Erkrankungs- und Genesungsprozesse (▸ Abb. 1.1).
Abb. 1.1:Bio-psycho-soziales Modell nach Georg Engel
Neue integrative Ansätze gehen über die beschreibenden Ebene des bio-psycho-sozialen Modells hinaus, indem sie dynamische und wechselseitige Beziehungen zwischen Körper, Kognition, Emotion und der (sozialen) Umwelt postulieren. Ein Beispiel ist das 4E-Kognitions-Paradigma. Es besagt, dass kognitive Prozesse (z. B. Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Entscheiden) der Interaktion des denkenden Körpers mit seiner Umwelt bedürfen.
Kognition bedarf folgender 4 »E's«:
Embodiment (= Verkörperung; Verbindung von Geist und Körper)
Einbettung (= Umweltfaktoren beeinflussen Kognition)
Erweiterung (= einige Umweltfaktoren sind grundlegend für Kognition)
Enaktion (= Kognition ist handlungsleitend und handlungsgeleitet)
Der enge Zusammenhang körperlicher und psychischer Faktoren bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Heilung von Erkrankungen ist das grundlegende Paradigma der Psychosomatischen Medizin. Wichtige Mitbegründer der Psychosomatischen Medizin sind Viktor v. Weizäcker und Thure v. Uexküll, welche dem holistischen Ansatz eines bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnisses folgten.
Die Hauptbehandlungsmethodik der Psychosomatischen Medizin ist die Psychotherapie, welche – je nach Krankheitsbild – um somatische und pharmakotherapeutische Methoden erweitert wird.
1.1.3 Diagnostik: Wie werden psychische Erkrankungen diagnostiziert?
Grundpfeiler der Diagnostik psychischer Erkrankungen sind Anamnese, Erhebung eines psychopathologischen Befunds, psychometrische Tests (Fragebögen etc.), ggf. körperliche Untersuchungen und ggf. laborchemische und apparative Diagnostik. Ziel ist es, zu prüfen, ob die Diagnosekriterien einer Erkrankung nach ICD erfüllt sind.
Um die psychischen Befunde standardisiert zusammenzufassen, wird der psychopathologische Befund nach AMDP-System (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) genutzt. Folgende Punkte sind dafür relevant:
1.
Subjektiver Eindruck der/des Patient*in
Erscheinungsbild
Kontaktaufnahme
Sprachliche Aspekte
2.
Psychopathologische Symptome
Bewusstsein und Orientierung
Aufmerksamkeit und Gedächtnis
Formales Denken (z. B. Gedankenabreißen, Grübeln)
Befürchtungen und Zwänge (z. B. Hypochondrie, Phobie, Zwänge)
Wahn (z. B. Verarmungs-, Verfolgungs-, Vergiftungswahn etc.)
Sinnestäuschungen (z. B. akustische oder visuelle Halluzinationen)
Ich-Störungen (z. B. Derealisation, Depersonalisation)
Affektivität (z. B. deprimiert, euphorisch, ängstlich, affektarm)
Antrieb und Psychomotorik (z. B. Antriebsminderung, Unruhe)
Zirkadiane Besonderheiten (z. B. Morgentief)
Andere Störungen (z. B. sozialer Rückzug, Suizidalität)
Zusatzmerkmale (z. B. Körperbildstörung, Panikattacken)
3.
Somatische Symptome
Schlaf und Vigilanz (z. B. Ein- und Durchschlafstörungen)
Appetenz (z. B. Appetitminderung, Libidoverlust)
Gastrointestinale Störungen (z. B. Übelkeit, Mundtrockenheit)
Kardio-respiratorische Störungen (z. B. Schwindel, Herzrasen)
Andere vegetative Störungen (z. B. Miktionsstörungen, Schwitzen)
Weitere Störungen (z. B. Kopfdruck, Konversionssymptome)
Neurologische Störungen (z. B. Rigor, Tremor, Nystagmus)
Zusatzmerkmale (z. B. sexuelle Funktionsstörungen)
Mit Hilfe psychometrischer Tests können klinische Befunde quantifiziert und vergleichbar gemacht werden. Sie kommen daher häufig im Forschungskontext zum Einsatz und können aus Interviews und/oder aus Fragebögen zur Selbst- sowie Fremdbeurteilung bestehen.
Merke
Gütekriterien psychometrischer Tests:
Objektivität: Unabhängig davon, wer den Test durchführt, erbringt der Test die gleichen Ergebnisse.
Reliabilität (Zuverlässigkeit): Wenn ein Test mit derselben Person zu einem ähnlichen Zeitpunkt wiederholt wird, erbringt er die gleichen Ergebnisse.
Validität (Gültigkeit): Ein Test misst das, was er messen soll, zum Beispiel die Ausprägung einer depressiven Episode.
1.1.4 Wie erfolgt die Aufklärung über Psychotherapie?
Psychotherapeut*innen unterliegen ihren Patient*innen gegenüber der Aufklärungspflicht gem. § 630 BGB. Die Aufklärung sollte zu Beginn der Therapie mündlich und/oder schriftlich erfolgen und folgende Punkte beinhalten:
Was ist Psychotherapie, wann wird sie durchgeführt und wie wirkt sie?
Wie läuft eine Psychotherapie ab und was ist ihr Ziel?
Gibt es Alternativen zum vorgeschlagenen Therapieverfahren?
Welche Risiken bestehen bei Durchführung der Therapie?
Welche Risiken bestehen bei Nichtbehandlung oder Therapieabbruch?
Welche Rechte haben Patient*innen?
Rahmenbedingungen wie Häufigkeit, Absage, Honorarfragen, Datenschutz etc.
Nach ausführlicher Aufklärung sollten Patient*innen eine Einwilligungserklärung unterschreiben
1.1.5 Wann sollte eine Psychotherapie beendet werden?
Die Endlichkeit eines therapeutischen Bündnisses sollte schon während der Therapie mitgedacht werden, das Therapieende also schon früh im Therapieverlauf benannt und rechtzeitig gezielt vorbereitet werden. Eine gelungene Auseinandersetzung mit den Themen Abschied, Integration von Enttäuschung bezüglich unerfüllter Erwartungen und autonome Lebensgestaltung ist ein wichtiger Teil der Therapie und dient u. a. der Rückfallprophylaxe.
Folgende Aspekte sollten zu einer Beendigung der Therapie führen:
Die erwünschte Besserung ist eingetreten.
Patient*innen ...
-
können dysfunktionale Beziehungsmuster erkennen und verändern.
-
haben das Gefühl, Herausforderungen selbst meistern zu können.
-
genießen das Leben, sind sozial eingebunden und arbeitsfähig.
Patientenseitiger Wunsch nach einem Behandlungsende (natürlich schön, wenn die Einschätzung auch von therapeutischer Seite geteilt wird)
Negative therapeutische Effekte, z. B. anhaltende Symptomverschlechterung
Gut zu wissen
Eine vorübergehende Verschlechterung der Symptomatik sollte nicht automatisch zu einem Therapieabbruch führen, sondern kann vielmehr Teil des therapeutischen Prozesses sein. So ist z. B. bei somatoformen Störungen oder Traumafolgestörungen eine initiale Verschlechterung aufgrund der bis dato nicht wahrnehmbaren oder abgespaltenen Affekte nicht selten.
1.2 Therapie: Welche Therapieschulen gibt es?
Aus dem klinischen Alltag
Sybille (23) stellt sich in der psychosomatischen Ambulanz vor, da sie gerne eine Psychotherapie machen möchte. Sie leidet schon sehr lange unter einer instabilen Stimmung, immer wieder fühlt sie sich depressiv. Nachdem sie mit 18 von zu Hause ausgezogen war, hatte sie viel Gewicht verloren, heute glaubt sie, dass sie damals eine Anorexie hatte. Gewicht und Essverhalten haben sich aber mittlerweile normalisiert. Sie studiert Biologie und wohnt im Studierendenwohnheim, wo sie sich auch wohl fühlt. Seit ca. sechs Monaten hat sie eine feste Partnerschaft, nach welcher sie sich einerseits lange gesehnt hatte, andererseits sind die Auseinandersetzungen über Kleinigkeiten im Alltag anstrengend. Nun hat ihr Freund sie gefragt, ob sie nicht zusammenziehen möchten, was in ihr eine depressive Krise ausgelöst hat. Sie kommt mit der Frage, welche Art der Psychotherapie für sie in dieser Situation am besten geeignet wäre.
Die Psychotherapie an sich hat seit ihrer Entstehung viele unterschiedliche Vorstellungen dazu hervorgebracht, wie psychische Erkrankungen entstehen können, diagnostiziert und behandelt werden sollten. In unserem Buch beschränken wir uns auf die sogenannten psychotherapeutischen Richtlinienverfahren, d. h. die Therapieformen, die von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden (▸ Tab. 1.1):
Psychodynamische Psychotherapie (analytische Psychotherapie, AP, und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, TP)
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
Systemische Therapie (ST)
Alle Therapieschulen haben sich kontinuierlich weiterentwickelt und zunehmend Elemente anderer Schulen integriert. Dies führt einerseits zu großen methodischen Überschneidungen in den verschiedenen Therapieansätzen, andererseits sind dadurch zum Teil neue, integrative Therapiemethoden entstanden. Sie werden normalerweise ihrer Ursprungsschule zugeordnet, z. B. die Mentalsisierungsbasierte Therapie (Mentalisation-Based Therapy, MBT) nach Peter Fonagy und Anthony W. Bateman und die Übertragungsfokussierte Therapie (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) nach Otto Kernberg den psychodynamischen Therapieverfahren und die Schematherapie nach Jeffrey E. Young, die Acceptance-Commitment-Therapie (ACT) nach Steven C. Hayes oder die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Marsha M. Linehan der kognitiven Verhaltenstherapie.
Folgende Therapieschulen wurden vom wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie als wirksam anerkannt, werden aber nicht von den Krankenkassen finanziert:
Klientenzentrierte Gesprächstherapie nach Carl Rogers
Interpersonelle Therapie nach Harry S. Sullivan
1.2.1 Wie lautet die Definition von Gruppenpsychotherapie und worin bestehen die Vor- und Nachteile?
Während im einzeltherapeutischen Setting normalerweise ein*e Patient*in oder ein betroffenes System mit einer/m Therapeut*in (im Mehrpersonensetting ggf. auch mehrere Therapeut*innen) arbeitet, setzt sich eine Therapiegruppe aus mehreren Betroffenen zusammen. Im Fall von systemischer Therapie können das auch mehrere betroffene Systeme sein.
Gruppentherapeutische Ansätze sind für viele Patient*innen initial herausfordernd, haben sich aufgrund diverser Vorteile aber als sehr wirksam herausgestellt. Irvin D. Yalom hat u. a. folgende Wirkfaktoren herausgearbeitet, welche für alle Arten von Gruppentherapie gelten:
Prinzip Hoffnung: Innerhalb der Gruppe wird Hoffnung vermittelt, dass die aktuellen Probleme bewältigt werden können.
Universalität des Leidens: Patient*innen fühlen sich von anderen Patient*innen oft besser verstanden als von Therapeut*innen.
Wie in einer Einzeltherapie können Patient*innen auch in einer Gruppentherapie Hilfestellungen und Anleitungen zur Lösung von Problemen erhalten, z. B. indem bestimmte Themen gemeinsam diskutiert, erarbeitet oder in Rollenspielen erfahrbar gemacht werden.
Eine Therapiegruppe bietet einen geschützten Raum, um neue Verhaltensweisen erproben zu können und teilweise entstehen diese durch Lernen von anderen Gruppenmitgliedern.
Gegenseitige Akzeptanz und Unterstützung: Teilnehmende können in einer Gruppe erleben, anderen z. B. durch aufmerksames Zuhören oder Feedback helfen zu können (Altruismus), aber auch selbst von anderen akzeptiert, verstanden und unterstützt zu werden; beides wirkt meist selbstwertstärkend.
Gegenseitige Inspiration: Betroffene können durch die teils gegensätzlichen Perspektiven anderer Mitglieder ein neues Verständnis ihrer Situation oder der eigenen Wahrnehmung entwickeln.
Soziale Kompetenzen: Innerhalb der Gruppe lernen Betroffene, die eigenen Gefühle, aber auch die der anderen besser wahrzunehmen. Dies erleichtert es, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und zu verteidigen, Kritik zu üben und ggf. auftretende Konflikte konstruktiv zu bewältigen.
Gruppenkohäsion: Die Teilnehmenden entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl zu der Gruppe, wodurch das Gefühl unterstützt wird, mit psychischen Problemen nicht allein zu sein.
Katharsis: Oft fällt es Patient*innen initial schwer, über sich und eigene Schwierigkeiten zu berichten. Wenn sie dies dennoch tun, erfahren sie häufig positive und stärkende Rückmeldungen, wodurch schwierige Emotionen leichter erlebt und verarbeitet werden können.
Je nach Gruppenfokus können immer wieder auftretende Beziehungsmuster im Hier und Jetzt erlebt, verstanden und bearbeitet werden.
Häufig sind diese Beziehungsmuster schon in der Herkunftsfamilie entstanden und der Austausch in der Gruppe hilft, sie zu reflektieren und alternative Verhaltensstrategien zu erproben.
Gruppentherapien sind ähnlich wirksam wie Einzeltherapien, dabei aber kostengünstiger. Folgendes Vorgehen ist hilfreich, um das Gefühl von Sicherheit und positiver Erwartungshaltung zu verstärken:
Aufklärung über positive Wirkung von Gruppentherapien und Abbau von Ängsten vor der ersten Teilnahme
Verlässlicher Gruppenrahmen
Klare Gruppenregeln (Gruppenleitung achtet auf Einhaltung der Regeln)
Nichtsdestotrotz profitieren natürlich nicht alle Patient*innen gleichermaßen von einem Gruppensetting. Der Nachteil von Gruppentherapien besteht darin, dass weniger Zeit fokussiert für die persönlichen Themen aufgewendet werden kann. Auch für Patient*innen, die in Gruppentherapien in nicht regulierbare Anspannung geraten, kann eine Gruppe potenziell schädlich sein. Daher sollte das Vorgehen individuell angepasst werden.
Ausgestaltung und Fokus können je nach therapeutischer Schule – analog zum einzeltherapeutischen Setting – unterschiedlich sein: In psychodynamischen Gruppen werden die Themen meist nicht vorgegeben, sondern von den Teilnehmenden geprägt. Hier liegt der Fokus oft auf interaktionellen Herausforderungen im Hier und Jetzt und ihren biografischen Hintergründen. In verhaltenstherapeutischen Gruppen soll dysfunktionales Denken und Verhalten erkannt und verändert werden. Dafür wird häufig mit psychoedukativen Elementen und Rollenspielen, ggf. auch mit vertiefenden Hausaufgaben gearbeitet. In systemischen Gruppen liegt der Fokus auf dem Erkennen und dem gegenseitigen Aktivieren vorhandener Ressourcen.
1.3 Was ist psychodynamische Psychotherapie?
1.3.1 Wie hat sich die psychodynamische Psychotherapie entwickelt?
Gründervater der analytischen Therapie ist Sigmund Freud (1856 – 1939), der nach initial hypnotherapeutischem und karthatischem Arbeiten in den 1890er Jahren die Psychoanalyse entwickelte. Freuds Konzept des Unbewussten legte den Grundstein aller folgenden psychodynamischen Theorien. Trotz der Heterogenität heutiger Konzepte ist das dynamische Unbewusste als Essenz in allen psychodynamischen Betrachtungen enthalten. Nach dem topografischen Modell nach Siegmund Freud gibt es drei verschiedene Orte, an denen psychische Inhalte verarbeitet werden:
Bewusstes: Die wenigsten Inhalte (z. B. Daten, Fakten, Gedanken, Wünsche und Gefühle) sind unmittelbar im Bewusstsein.
Vorbewusstes: Inhalte des Vorbewusstseins bestehen aus Gedanken, Wünschen und Gefühlen sowie Handlungsabläufen oder verdrängten Konflikten, die nicht bewusst sind, je nach Umweltreiz und Abwehr aber die Bewusstseinsebene erreichen können.
Unbewusstes: Erbanlagen, frühe Erlebnisse und Instinkte sind unbewusst. Auch traumatische Erinnerungen und konflikthafte Wünsche und Triebe können durch Abwehr ins Unbewusste verdrängt werden. Verdrängtes Material kann sich in Form von Träumen, Fantasien, Symptomen und Fehlhandlungen offenbaren. Gleichzeitig besteht ein erheblicher Widerstand vor der Bewusstwerdung. Mit Hilfe von freier Assoziation, Traumarbeit und Deutung können die präsymbolischen Inhalte (wieder) ins Bewusstsein geholt werden.
1923 entwickelte Freud das Strukturmodell, in dem er die drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich beschrieb. Das im unbewussten lokalisierte Es strebt nach Lusterfüllung. Ich- und Über-Ich haben sowohl bewusste als auch vorbewusste Anteile. Das Über-Ich strebt nach der Erfüllung von elterlichen oder gesellschaftlichen Normen und Werten. Das Ich hat die Aufgabe, die teils widersprüchlichen Impulse von Es und Über-Ich mit einer realen Durchführbarkeit abzugleichen (▸ Abb. 1.2).
Abb. 1.2:Zusammenspiel von Über-Ich, Ich und Es nach Sigmund Freud
Als Triebe beschreibt Freud Verbindungen zwischen Seelischem und Körperlichem, d. h. Kräfte, die körperlichen Ursprungs sind, aber psychisch als Begierde oder Ängste wahrgenommen werden. Als Drang bezeichnet Freud die Begierde, mit der sich die Triebhandlung vollzieht. Ein Subjekt strebt nach Befriedigung oder Abfuhr des Dranges. Normalerweise bedarf es dazu eines Objektes, d. h. ein anderes Lebewesen (oder Gegenstandes), auf welches das Subjekt bezogen ist. Das so genannte Triebobjekt verändert sich im Laufe der Entwicklung des Subjekts. Ein Triebobjekt wird mit einer Energie besetzt (die Triebkraft, z. B. die Libido als Energie des Sexualtriebs).
Was beinhaltet das psychosexuelle Entwicklungsmodell?
Für Freud war der Sexualtrieb von großer Bedeutung – was schon zu seiner Zeit für Irritation sorgte (und sich in moderneren analytischen Theorien entsprechend veränderte). Der Sexualitätsbegriff war allerdings nicht auf eine genitale Sexualität reduziert, sondern bezog auch Freundschafts- und Liebesempfindungen mit ein sowie im körperlichen Sinne alle Arten von Lustgewinn durch körperliche Aktivitäten oder Empfindungen. Die Entwicklung der Sexualität teilte Freud in fünf Entwicklungsphasen ein (▸ Tab. 1.2). 1966 entwickelte Erik Erikson aus dem psychosexuellen ein psychosoziales Modell mit der Idee, dass Identitätsentwicklung einen lebenslangen Prozess darstellt und je nach Lebensabschnitt unterschiedliche Spannungsfelder zwischen individuellen Bedürfnissen und sozialem Umfeld entstehen.
Tab. 1.2:Phasen der psychosexuellen und psychosozialen Entwicklung nach Sigmund Freud und Erik Erikson
Lebensjahr (LJ)/Phase
Erogene Zone
Themen nach Freud
Spannungsfeld nachErikson
0 – 18Monate:Orale Phase
Mund
Saugen, Schlucken, Befriedigung primärer Bedürfnisse
(Ur)Ver- vs. Misstrauen:»Ich bin, was ich bekomme.«
2.–3. LJ:Anale Phase
Analregion
Bestimmen, Kontrollieren, Grenzen der Bedürfnisbefriedigung
Autonomie vs. Scham/Zweifel:»Ich bin, was ich will.«
4.–5. LJ:Phallische Phase
Penis, Klitoris
Erforschen des eigenen Körpers, Bewusstsein für Geschlechterunterschiede
Initiative vs. Schuldgefühl:»Ich bin, was ich mir vorstelle zu werden.«
6.–11. LJ:Latenz
–
Leistungsanspruch, Konkurrenz, Bedürfnisaufschub
Werksinn/Stolz vs. Minderwertigkeitsgefühl:»Ich bin, was ich lerne.«
12.–19. LJ:Pubertät
Flexibel
Entwicklung sexueller Identität, Partnerschaftsdeterminante
Identität vs. Identitätsdiffusion:»Ich bin, was ich bin.«
20.–45. LJ:Reife
Intimität und Gemeinschaft vs. Isolierung:»Ich gehöre zu dem, was ich liebe.«
46.–65. LJ
Generativität vs. Selbstabsorption:»Ich bin, was ich bereit bin, zu geben.«
> 65. LJ
Integrität vs. Verzweiflung:»Ich bin, was ich gelebt habe.«
Wer sind wichtige Vertreter*innen psychoanalytischer Schulen?
So klar die Psychoanalyse auf Sigmund Freud als Gründervater zurückzuführen ist, so vielschichtig waren die weiteren Entwicklungen und Strömungen innerhalb der Psychoanalyse – und sind es bis heute.
Trieb-Psychologie oder Trieb-Struktur-Modell (1890 – 1930/40: Sigmund und Anna Freud u. a.):
Die Trieb-Psychologie stellt die Triebbefriedigung als Basis von Denken und Handeln (s. o.) ins Zentrum. Die intrapsychische Perspektive ist wichtig (Einpersonenpsychologie): Trieb-Wunsch-Abwehr-Konflikte zwischen den drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich stehen in den theoretischen Betrachtungen im Vordergrund, wobei dem Es ein Großteil des Interesses gilt.
Das Objekt (= Objekt der Triebe) ist nur insofern von Interesse, wie es der Triebbefriedigung dient.
Psychopathologie entsteht durch angeborene Triebe und der Suche nach Triebbefriedigung im Konflikt mit dem Gewissen und Idealen (z. B. Aggression als angeborener Todestrieb, welche aber gesellschaftlich abgelehnt wird).
Schon früh distanzierten sich diverse analytisch geprägte Denker von Siegmund Freuds Theorien und entwickelten ihre eigenen Lehren, u. a.:
Individualpsychologie (Alfred Adler, 1912): Zentral ist ein positives Menschenbild, in dem menschliches Handeln grundsätzlich als sozial und empathisch betrachtet wird. Minderwertigkeitsgefühle können aber zu Rücksichtslosigkeit und dominantem Verhalten führen.
Analytische Psychologie (Carl G. Jung, 1913): Jung prägte das Konzept des »kollektiven Unterbewussten«, in dem menschheitsgeschichtliche Entwicklungen das Individuum beeinflussen. Er setzte sich zudem mit dem Thema der spirituellen Sinnsuche und Persönlichkeitsentwicklung auseinander, die durch Religionen wie den Buddhismus geprägt wurden.
Existenzanalyse (Viktor E. Frankl, späte 1920er Jahre): Die »Dritte Wiener Schule« (nach Freud und Adler) fokussierte auf das Sinnerleben des Menschen sowie psychopathologiefördernde Sinnlosigkeitsgefühle.
Ich-Psychologie (ab 1930/1940er Jahre, v. a. in den USA: Anna Freud, Heinz Hartmann u. a.):
Sie stellt die Ich-Entwicklung, die Anpassungsfähigkeit des Subjekts an die Umwelt sowie Abwehrprozesse des Ichs in den Vordergrund. Ausgehend vom Strukturmodell nimmt das Ich dabei eine zentrale, autonome und regulierende Funktion ein. Das Ich vermittelt zwischen äußeren Gegebenheiten (Realität) und inneren Konflikten (Anforderungen des Über-Ichs und Wünschen des Es) und vertritt das Subjekt in seinen Anliegen.
Die Fähigkeiten des Ichs, auch Ich-Funktionen genannt, wurden später u. a. von Otto Kernberg als Niveaus der Persönlichkeitsorganisation weiterentwickelt und sind heute vergleichbar mit dem Begriff der strukturellen Fähigkeiten, wie sie in der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) eine zentrale Rolle spielen.
Das Ich verfügt über (unbewusste) Abwehrmechanismen, die der Entlastung des Ichs dienen und je nach Ausprägung der Ich-Funktionen als mehr oder weniger »reif« bezeichnet werden können.
Objektbeziehungstheorie (ab 1930er Jahre: Melanie Klein; ab 1950er Jahre: Winfried R. Bion, William R. D. Fairbairn, Donald Winnicott, Michael Balint, Magret Mahler, Otto Kernberg u. a.):
Der Suche nach einem guten Objekt als Basis von Denken und Handeln kommt eine besondere Bedeutung zu.
Interpersonelle Einflüsse bekommen mehr Bedeutung, die Beziehung zum Objekt und die (strukturgebenden) frühkindlichen (prä-ödipalen) Erfahrungen mit dem Objekt sind zentral.
Verständnis von Objekten als Beziehungsgegenüber
Äußeres Objekt als Beziehungsgegenüber in der Außenwelt
Inneres Objekt als verinnerlichte (erlebte) Beziehungserfahrung
Psychopathologie wird durch ein Erleben von Beziehungsinsuffizienz erklärt.
Der Therapiefokus ist vor allem das Verstehen der Inneren Objekte und ihre Bedeutung im Hier und Jetzt in der Übertragung und Gegenübertragung.
Das Selbst als Kern der Persönlichkeit ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff des Ich, der sich meist intrapsychisch auf die drei Instanzen bezieht.
Das Selbst ist auf die Wahrnehmung und Spiegelung durch Objekte angewiesen, ein Mangel an Spiegelung führt zu einem gestörten Selbstwertgefühl im Sinne einer narzisstischen Pathologie.
Aggressive Affekte wie narzisstische Wut, massive Sexualisierungen oder Affektregulationsschwierigkeiten werden als Reaktion auf insuffiziente Beziehungsangebote durch empathische Objekte verstanden.
Intersubjektive (= relationale) Wende (ab 1990er, v. a. in den USA: Steven Mitchel, Robert D. Stolorow, Georg E. Atwood u. a.). Bis heute sind die Auslegungen der Theorie vielfältig, d. h. es gibt noch kein einheitliches Konzept:
Grundannahme ist die Entstehung des Identitätserleben durch und in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Es kommt zu einer »Wende« vom innerseelischen (intrapsychischen) Fokus der Psychoanalyse hin zum zwischenmenschlichen (intersubjektiven) Feld und von der Objektivität zur Subjektivität.
Das intersubjektive Feld wird durch die beteiligten Subjekte gemeinsam und wechselseitig gebildet und ist dadurch einzigartig, situations- und kontextabhängig.
Therapeut*innen werden von Beobachtern zu Mitgestaltern der therapeutischen Beziehung; Übertragung und Gegenübertragung werden wechselseitig verstanden.
Weitere Forschungsfelder und Konzepte, die die Entwicklung der Psychoanalyse maßgeblich mitbeeinflussten, sind:
Beobachtende Säuglingsforschung und Entwicklungspsychologie (ab 1950/1980er Jahre: Daniel Stern, Joseph D. Lichtenberg, Martin Dornes, Mary Ainsworth u. a.): Aus der Baby-Beobachtung wurde deutlich, dass Babys mütterliche Fürsorge keineswegs passiv empfangen, sondern sie die Mutter-Kind-Beziehung reziprok mitgestalten.
Bindungstheorie (ab 1940er Jahre: John Bowlby, James Robertson, Mary Ainsworth u. a.): Im Fremde-Situations-Experiment wurden 1 – 1,5 Jahre alte Kinder von ihren Müttern getrennt und je nach Verhalten unterschiedlichen Bindungstypen zugeordnet. Bis heute lassen sich Kinder bis 5 Jahre nach einem ähnlichen Versuchsaufbau in eines der vier Bindungsmuster einordnen (▸ Tab. 1.3).
Tab. 1.3:Bindungsmuster
Bindungsmuster
Verhalten im Fremde-Situation-Experiment
Häufigkeit*
Sicher
Das Kind reagiert mit Stress, wenn die Mutter den Raum verlässt, lässt sich von dieser nach der Rückkehr aber sofort wieder beruhigen.
60 – 70 %
Unsicher-vermeidend
Das Kind wirkt äußerlich bei Trennung von der Mutter unbeeinträchtigt, steht aber innerlich unter Stress. Es wendet sich zur Regulation dem Spielzeug oder einer fremden Person zu und ignoriert die Mutter nach ihrer Rückkehr.
10 – 15 %
Unsicher-ambivalent
Das Kind reagiert sichtbar mit großem Stress auf den Weggang der Mutter und lässt sich auch nach deren Rückkehr kaum beruhigen.
10 – 15 %
Desorganisiert
Das Kind zeigt nach Weggang der Mutter bizarr anmutende Verhaltensweisen wie Bewegungsstereotypien oder Mutismus.
5 – 10 %
* in der Normalpopulation
Heute verstehen wir sichere Bindungsmuster als protektiv, während unsichere und desorganisierte Bindungsmuster im Sinne von Vulnerabilitätsfaktoren das Risiko für eine psychische Erkrankung erhöhen.
Die Bindungstheorie hatte großen Einfluss auf weitere Entwicklungen, wie die Entwicklung der Theory Of Mind und das Mentalisierungskonzept nach Fonagy (1998). Gemäß letzterem hängt psychische Gesundheit mit der Fähigkeit zu mentalisieren zusammen, d. h. der Fähigkeit, Affekte, Gedanken und Verhaltensweisen bei sich und anderen wahrnehmen, zuordnen und miteinander in Beziehung setzen zu können. Sie korreliert mit den oben beschriebenen Bindungsmustern: Sicher gebundene Menschen können mit höherer Wahrscheinlichkeit mentalisieren als unsicher oder desorganisiert gebundene Menschen. Aus dem Mentalisierungskonzept entwickelten Fonagy und Bateman die Mentalsierungsbasierte Therapie (MBT) zur Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen (▸ Kap. 8), die aber zunehmend auch für andere Störungsbilder adaptiert wird.
1.3.2 Wie entsteht Psychopathologie aus psychodynamischer Perspektive?
Nach psychodynamischem Verständnis gibt es drei Säulen, welche zur Entstehung von Psychopathologie beitragen können: Konflikte, Strukturdefizite und Traumata.
Als Konflikte werden innere Widersprüche beschrieben, bei denen sich zwei Pole von Wünschen, Bedürfnissen, Ängsten oder Vorstellungen entgegenstehen. Konfliktpathologien zeichnen sich durch überreguliertes Verhalten aus. Sie können im Verlauf szenisch reinszeniert werden, z. B. während einer Therapie oder eines stationären Aufenthaltes. Eng mit dem Begriff des Konfliktes verbunden ist der Begriff der Abwehr (▸ Kap. 1.3.3), welche Konflikte oder auch unangenehme Affekte vom Bewusstsein fernhält.
Modell zur Entstehung einer konfliktbasierten Psychopathologie:
Ein auslösender interpersoneller Konflikt (z. B. zwischen einer Frau und ihrem Ehemann, bei dem sie eine Außenbeziehung vermutet) mit Versuchungs- und Versagungssituation (einerseits Wunsch nach mehr Freiheit innerhalb der Beziehung, andererseits Gefühl mangelnder Anerkennung durch den Partner) führt zu
Reaktualisierung eines früheren Konfliktes (die Frau hat sich von ihrem Vater nie ausreichend gesehen bzw. wertgeschätzt gefühlt und sich in der Sehnsucht danach unaushaltbar klein und schwach gefühlt) und aktiviert
Abwehr, um den Konflikt unbewusst zu halten (Reaktionsbildung durch maximale Versorgung der anderen und dem Versuch, den Partner durch vermehrte Fürsorge in der Beziehung zu halten). Dies gelingt aber nur unvollständig und führt schließlich zur
Symptombildung als derzeit bester Kompromiss zwischen Wunsch und Abwehr (die Frau entwickelt eine Panikstörung und kann ohne den Partner nicht mehr das Haus verlassen, wodurch dieser an sie gebunden wird).
Als psychische Struktur werden basale Fähigkeiten zur Ich-Steuerung (sogenannte Ich-Funktionen) verstanden, die notwendig sind, um sich selbst und die Beziehung zu anderen ausreichend zu regulieren. Strukturelle Beeinträchtigungen fallen dadurch auf, dass Affekte häufig nicht reguliert werden und Schwierigkeiten interpersonell ausgetragen werden. Strukturelle Fähigkeiten werden zwar als relativ zeitstabil betrachtet, sind aber grundsätzlich veränderbar.
Strukturelle Störungen entstehen meist durch Entwicklungsdefizite, können aber auch in traumatischen Lebenserfahrungen wurzeln, die wiederum die Entwicklung negativ beeinflussen.
Das Verhältnis von Struktur und Konflikten wird häufig mit einer Bühnen-Metapher beschrieben: Die Struktur entspricht der Ausstattung der Bühne, also dem Bühnenbild mit Scheinwerfern, Vorhang etc., während es sich beim Theaterstück um die Konfliktmuster handelt. Wenn die Bühne kaputt oder nur in Teilen vorhanden ist, wird es immer schwieriger, das Theaterstück zu verstehen. Ist der herabfallende Scheinwerfer Teil des Stücks oder Teil einer kaputten Bühne?
Traumata gefährden die strukturelle Integration, wenn sie unverarbeitet bleiben (▸ Kap. 5). Durch die traumabedingte psychische Überforderung stehen Fähigkeiten wie Selbstberuhigung oder Verortung des Selbst in einem sicheren Hier und Jetzt nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Insbesondere in Situationen, die an das traumatische Geschehen erinnern, brechen strukturelle Fähigkeiten situativ ein. Besonders schwerwiegend sind in diesem Zusammenhang die Erfahrungen von Ausgeliefertsein und Ohnmachtserleben, Schuldgefühle und frühkindliche Traumata, welche (insbesondere, wenn sie wiederholt stattfinden) häufig mit schwerwiegenderen strukturellen Beeinträchtigungen einhergehen.
In einer Bauwerks-Metapher ausgedrückt wäre das Gebäude der Konflikt, die Struktur das Fundament und das Trauma entspräche einem Erdbeben, das in der Lage wäre, auch eine zuvor stabile Konstruktion in Teilen zu zerstören, eine zuvor schon fragile Konstruktion aber gänzlich in sich zusammenstürzen ließe.
1.3.3 Wie erfolgt die Diagnostik im Rahmen einer psychodynamischen Psychotherapie?
Eine psychodynamische Diagnose wird meist auf Basis folgender Informationen gestellt:
Klinische Symptomatik und deren subjektive Bedeutung für die Betroffenen, inkl. auslösende Situation sowie somatische Anamnese
Ableitung der Psychodynamik aus der biografischen Anamnese
Szenisches Verstehen als subjektive Einordnung der während des Gespräches auftretenden Interaktionsmuster, die Hinweise auf zugrundeliegende unbewusste Wünsche, Bedürfnisse und Konflikte geben
Psychodynamische Einordnung in den Dimensionen Struktur, Konflikt und Abwehr, z. B. nach Operationalisierter Psychodynamischer Diagnostik (OPD)
Bereits im Jahr 1996 wurde die OPD entwickelt, die durch ein festgelegtes Vokabular eine diagnostische Einordnung, einen therapeutischen Austausch und eine wissenschaftliche Vergleichbarkeit ermöglicht. Mittlerweile existiert die dritte Revision (OPD-3), die sich in vier Achsen gliedert:
Achse I: Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzung
Einschätzung der Erkrankungsschwere durch die/den Untersucher*in
Objektive Einordnung der Krankheitsschwere
International Classification of Diseases (ICD) oder Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
Globale Beurteilung des Funktionsniveaus (GAF)
Lebensqualität (EQ-5D)
Krankheitsdauer und -verlauf
Subjektive Krankheits- und Behandlungskonzepte, z. B. somatisch, sozial orientiert, intrapsychisch, alternativ (z. B. esoterisch)
Veränderungshemmnisse und Ressourcen
Achse II: Beziehung
Zur Bestimmung des dysfunktionalen Beziehungsverhaltens dienen 16 Items, mit denen folgender Beziehungszirkel beschrieben werden kann (▸ Abb. 1.3):
Abb. 1.3:Beziehungszirkel nach OPD-3 (modifiziert nach Arbeitskreis OPD, 2023, S. 99)
Aus dem klinischen Alltag – Beispiel eines Beziehungszirkels nach OPD-3
Sybille erlebt andere immer wieder so, dass sie sie »im Stich lassen«. Sie selbst gibt sich große Mühe, es anderen recht zu machen. Wenn ihr dies zu anstrengend wird, zieht sie sich zurück. Dies nehmen die anderen als Ablehnung wahr, was ihnen nahelegt, sich auch zurückzuziehen. Dies verstärkt Sybilles Gefühl, »im Stich gelassen zu werden«.
Achse III: Konflikt
Es werden sieben verschiedene Konfliktthemen unterschieden und jeweils ein aktiver sowie ein passiver Modus definiert (▸ Tab. 1.4). Die Reihenfolge ist von den Entwicklungsschritten von Kindheit bis Jugend abgeleitet.
Tab. 1.4:Konfliktthemen nach OPD-3 mit Kern- und Leitaffekten
Kx
Konfliktthema
Affekte
Passiver Modus
Aktiver Modus
K1
Abhängigkeitvs.Individuation
KA: Trennungs- vs. Verschmelzungsangst
LA: Angst, Aversion
Anklammern, Einfordern von Terminen
GÜ: Sorge, VerantwortungsgefühlVerlauf: Angst vor Vereinnahmung
Tendenz, sich nicht auf Therapie einzulassen
GÜ: Wenig VerantwortungsgefühlVerlauf: Abhängigkeitswünsche spürbar
K2
Unterwerfungvs.Kontrolle
KA: Hilflosigkeit
LA: Ärger, Wut, Angst vor Unterwerfung
Unterwerfung,ggf. passive Aggressivität
GÜ: Gefühl der Kollaboration bei gleichzeitiger Affektarmut
Dominanzstreben, ggf. hohe Leistungsbereitschaft
GÜ: Machtkampf
Verlauf: Ärger und Ablehnung
K3
Versorgungvs.Autarkie
KA: Mangelgefühl
LA: Enttäuschung, Trauer, Depression
Chronisches Mangelgefühl
GÜ: Wahrnehmung von Bedürftigkeit; Unterstützungsimpulse
Stolz auf eigene Belastbarkeit, Enttäuschung, Neid
GÜ: Wahrnehmung von Leistungsstärke; Bewunderung, untergründige Enttäuschung spürbar
Verlauf: Genervtsein, Verärgerung, Rückzug
K4
Selbstwert (Selbst- vs. Objektwert)
KA: Minderwertigkeit, Scham
LA: Angst vor Beschämung vs. narzisstische Wut
»Unwichtiges Mängelexemplar«
GÜ: Fremdschämen, Unterstützungs- oder Abwertungsimpulse
Abwertung anderer
GÜ: Kränkung, Scham, Rechtfertigung, Ärger
K5
Schuldkonflikt (prosozial vs. egoistisch)
KA: Schuld, egoistische Aggression
LA: (Selbst-)Vorwürfe, Strafangst, Trauer
Selbstvorwürfe, Schuldgefühle
GÜ: Mitleid, Übervorsicht, Bemühen
Egoismus, Schuldvorwürfe
GÜ: Ablehnung, Konfrontations- und Strafimpulse
K6
Ödipaler Konflikt
KA: Ausgeschlossensein, Unreife
LA: –
Sexuelle Naivität, Unbedarftheit
GÜ: Langeweile, Desinteresse
Sich in Szene setzen
GÜ: Faszination, AnziehungVerlauf: Irritation
K7
Identitätskonflikt
KA: Verunsicherung, Sinnlosigkeit
Identitätsunsicherheit und -dissonanz
Übertriebene Identitätssicherheit
LA:





























