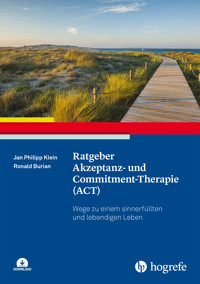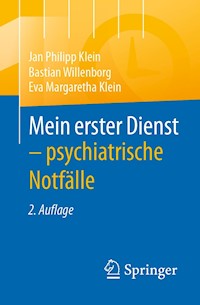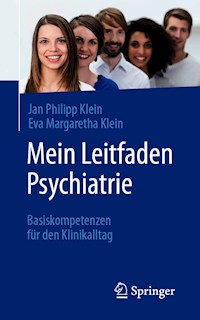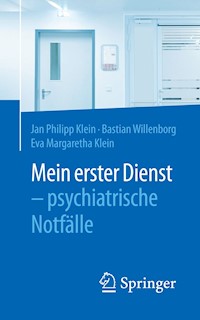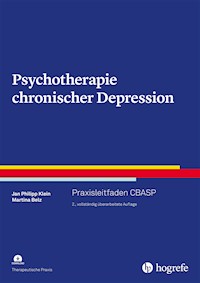
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) wurde von James McCullough speziell für die Behandlung der chronischen Depression entwick-elt. Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Depression haben häufig bei der Bewältigung von interpersonellen Situationen Schwierigkeiten. Beim Vorgehen nach dem CBASP-Ansatz lassen sich Therapeut:innen persönlich und ganz individuell auf ihre Patient:innen ein, um mit ihnen zusammen interpersonelle Fertigkeiten zu trainieren. Das evidenzbasierte Buch vermittelt praxisnah und anhand zahlreicher Beispiele das therapeutische Vorgehen. Die 2., vollständig überarbeitete Auflage liefert zunächst eine Beschreibung des Störungsbildes und fasst den aktuellen Forschungsstand zu CBASP zusammen. Anschließend vermittelt das Buch Schritt für Schritt alle Techniken des CBASP und die therapeutische Haltung im Umgang mit chronisch depressiven Patient:innen. Der Ablauf der Therapie, beginnend mit der Vermittlung des Krankheitsmodells, der Fallkonzeptualisierung und dem Training interpersoneller Fertigkeiten bis hin zur Rückfallprohylaxe, wird praxisorientiert erläutert. Vorgestellt werden zudem neue Entwicklungen des Ansatzes, wie z. B. der Umgang mit komorbiden psychischen Störungen und die Anwendung des CBASP in der Gruppe oder im stationären Setting. Anhand zahlreicher Fallbeispiele wird außerdem der Umgang mit schwierigen Therapiesituationen aufgezeigt. Die zahlreichen im Buch enthaltenen Arbeitsmaterialien für die Diagnostik, zur Psychoedukation und für die Arbeit mit den Patient:innen können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jan Philipp Klein
Martina Belz
Psychotherapie chronischer Depression
Praxisleitfaden CBASP
Prof. Dr. med. Jan Philipp Klein, geb. 1977. 1997 – 2004 Studium der Medizin in Berlin, London (GB) und Dallas, Texas (USA). 2005 Promotion. Ab 2005 wissenschaftliche und klinische Ausbildung an der Charité Berlin und an der Universität zu Lübeck. 2010 Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 2012 Leiter der Arbeitsgruppe Psychotherapieforschung an der Universität zu Lübeck. 2017 Habilitation. Seit 2017 leitender Oberarzt der Kliniken für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität zu Lübeck. 2021 Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Dr. Martina Belz, geb. 1951. 1971 – 1977 Studium der Psychologie, Ethnologie und Archäologie in Tübingen und Freiburg. Anschließend Tätigkeit in verschiedenen klinischen Einrichtungen. 1990 – 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Universität Freiburg. 1994 Promotion. 2002 – 2006 Geschäftsführerin des universitären Freiburger Ausbildungsinstituts für Verhaltenstherapie (FAVT). 2007 – 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Programmleitung im Psychotherapiemasterstudiengang MASPTVT (Master of Advanced Studies Psychotherapie Schwerpunkt Verhaltenstherapie) in Kooperation von Universität Bern und der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie sowie Tätigkeit in eigener Praxis in Bern, Schweiz. Seit 2019 pensioniert.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Matthias Lenke, Weimar
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete Auflage 2023
© 2014 und 2023 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3010-2; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3010-3)
ISBN 978-3-8017-3010-9
https://doi.org/10.1026/03010-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort, Vorworte und Danksagungen
Kapitel 1 Theoretischer Hintergrund – Chronische Depression und das CBASP-Konzept
1.1 Einführung
1.2 Diagnostik der chronischen Depression
1.2.1 Definition der chronischen Depression
1.2.2 Kategoriale Diagnostik: Identifikation der chronischen Depression
1.2.3 Dimensionale Diagnostik: Verlauf der Depression
1.3 Epidemiologie der chronischen Depression
1.4 Störungsmodell der chronischen Depression
1.4.1 Entwicklungsbedingungen chronisch depressiver Patienten
1.4.2 Wahrnehmungsentkoppelung als zentrale Psychopathologie chronisch Depressiver
1.4.3 Präoperatorisches Denken bei chronisch Depressiven
1.4.4 Beziehungsgestaltung und interpersonelle Probleme bei chronischer Depression
1.5 Empirische Belege für die Wirksamkeit von CBASP
1.5.1 Wirksamkeitsnachweis der ambulanten CBASP-Therapie
1.5.2 Vergleich von CBASP mit anderen Psychotherapien
1.5.3 Leitlinienempfehlungen zum Einsatz von CBASP
1.5.4 Wirksamkeit von CBASP-Gruppentherapie und (teil-)stationärer CBASP-Behandlung
1.5.5 Bei wem wirkt CBASP am besten?
1.5.6 Evidenz zur optimalen Gestaltung der CBASP-Therapie
1.5.7 Unerwünschte Ereignisse im Rahmen einer Behandlung mit CBASP
Kapitel 2 Ablauf der Therapie
2.1 Ziele und Struktur des CBASP
2.2 Vermittlung des Störungsmodells
2.2.1 Vorgehen bei der Vermittlung des Störungsmodells
2.2.2 Modifikationen bei der Vermittlung des Störungsmodells
2.3 Fallkonzept: Liste prägender Bezugspersonen
2.3.1 Einführung in die Liste prägender Bezugspersonen
2.3.2 Vorgehen bei der Liste prägender Bezugspersonen
2.3.3 Formulierung der Übertragungshypothese
2.3.4 Vertiefungswissen
2.3.4.1 Modifikationen bei der Erhebung der prägenden Bezugspersonen
2.3.4.2 Was wollen Sie dem Leben des Patienten hinzufügen?
2.3.4.3 Die CBASP-Matrix: Orientierung der Therapieziele an der Übertragungshypothese
2.4 Veränderungsstrategien: Situationsanalyse
2.4.1 Erhebungsphase
2.4.2 Lösungsphase
2.4.3 Anleitung des Patienten
2.4.4 Bezug zum Alltag der Patienten
2.4.5 Modifikationen
2.4.5.1 Zukunftsanalysen
2.4.5.2 Einbeziehung des Kiesler Kreises
2.4.5.3 Kurzversion der Situationsanalyse
2.4.5.4 Adaptierte Version der Florida State University
2.4.5.5 Situationsanalyse als isolierte Technik
2.5 Veränderungsstrategien: Therapeutische Beziehung
2.5.1 Kontingent persönliche Reaktion
2.5.2 Interpersonelle Diskriminationsübung
2.6 Abschlussphase der Therapie
Kapitel 3 Modifikationen
3.1 Modifikationen für die Behandlung von Patienten mit komorbiden Störungen
3.1.1 Alkoholabhängigkeit
3.1.2 Panikstörung
3.1.3 Posttraumatische Belastungsstörung
3.1.4 Persönlichkeitsstörungen
3.2 Modifikationen für die Behandlung in anderen Settings
3.2.1 Situationsanalyse in der Gruppe
3.2.2 CBASP im stationären Setting
3.2.3 Einbeziehung der Partner
Kapitel 4 Schwierige Therapiesituationen
4.1 Liste prägender Bezugspersonen
4.1.1 Gruppen als prägende Bezugspersonen
4.1.2 Vertiefung der Beschreibungen der prägenden Bezugsperson
4.1.3 Erhebung der Bezugspersonen dauert zu lange
4.1.4 Auswahl des Übertragungsbereiches
4.1.5 Benennung der befürchteten Konsequenz
4.2 Situationsanalyse: Was mach ich, wenn …?
4.2.1 … der Patient sagt, ich erlebe keine interpersonellen Situationen?
4.2.2 … der Patient unübersichtlich lange Situationen mitbringt?
4.2.3 … auf den ersten Blick kein gewünschtes Ergebnis in Sicht ist?
4.2.4 … es darum geht, Gefühlsinterpretationen zu revidieren?
4.2.5 … mir bei der Durchführung der Situationsanalyse die Zeit davonläuft?
4.2.6 … der Patient das in der Situationsanalyse Gelernte nicht umsetzt?
4.3 Persönliche Gestaltung der therapeutischen Beziehung
4.3.1 Woran erkenne ich, dass es Zeit für den Einsatz dieser Strategien ist?
4.3.2 Wie viel Persönliches gebe ich preis? Und wie drücke ich es aus?
4.3.3 Was mache ich, wenn der Patient sagt: „Es ist mir egal, wie Sie sich fühlen, es geht hier um mich!“?
4.3.4 Was mache ich, wenn der Patient meine Aufrichtigkeit infrage stellt: „Das sagen Sie doch nur, weil Sie mein Therapeut sind!“?
4.3.5 Wie gehe ich mit suizidalen Krisen des Patienten um?
Literatur
Anhang
Arbeitsmaterial 1: Screening auf eine chronische Depression
Arbeitsmaterial 2: Diagnostisches Vorgehen
Arbeitsmaterial 3: Zeitverlauf der Depression
Arbeitsmaterial 4: Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS)
Arbeitsmaterial 5: Wichtige Begriffe im CBASP
Arbeitsmaterial 6: Vermittlung des Krankheitsmodells
Arbeitsmaterial 7: Psychoedukation
Arbeitsmaterial 8: Kiesler Kreis
Arbeitsmaterial 9: Liste prägender Bezugspersonen
Arbeitsmaterial 10: Kontingent persönliche Reaktion
Arbeitsmaterial 11: Interpersonelle Diskriminationsübung
Arbeitsmaterial 12: Situationsanalyse
Arbeitsmaterial 13: Situationsanalyse – Therapeutenversion
Arbeitsmaterial 14: Situationsanalyse mit Kiesler Kreis
Arbeitsmaterial 15: Zukunftsanalyse
Hinweise zu den Online-Materialien
|9|Geleitwort, Vorworte und Danksagungen
Geleitwort zur 1. Auflage
„Psychotherapie chronischer Depression. Praxisleitfaden CBASP“: Philipp Klein und Martina Belz haben ein neues Buch vorgelegt, das sich in die Reihe „Therapeutische Praxis“ von Hogrefe einfügt und, zusammen mit fast gleichzeitig erscheinenden Büchern, die Reihe deutscher Publikationen zum CBASP-Ansatz fortsetzt. Damit wird die Frage fast aufgedrängt, ob es sich um ein Buch mit einem zusätzlichen Nutzen handelt. Jeder Leser, jede Leserin wird das für sich selber beantworten müssen, als generelle Einschätzung antworte ich mit einem entschiedenen „Ja“!
Warum? Es gibt mehrere Gründe:
CBASP ist ein anspruchsvoller, komplexer Ansatz. Mit der Lektüre eines Buches hat man ihn nicht begriffen. Die Autoren verstehen es aber, den Ansatz auf das, was man auf 96 Seiten plus Arbeitsblättern vermitteln kann, zu reduzieren, ohne dass übersimplifiziert wird und ohne dass das Wesentliche verloren geht.
Bei einer knappen Darstellung besteht die Gefahr des Abstrahierens, womit die praktische Nützlichkeit bedroht wäre: Dieser Gefahr erliegen die Autoren nicht, sie liefern im Gegenteil eine Fülle neuer Hilfen für die Praxis.
Dabei kommt auch die in ihrer Bedeutung oft unterschätzte und vielleicht bei einigen auch wegen des in der deutschen Übersetzung etwas schwierigen Begriffs unbeliebte Psychoedukation nicht zu kurz.
Eine knappe UND richtige Darstellung setzt eine gute Fähigkeit voraus, einzuschätzen, wo vereinfacht werden kann, und diese setzt wiederum eine exzellente Vertrautheit mit dem Ansatz voraus. Bei den Autoren, beide Vorstandsmitglieder im CBASP-Netzwerk und seit vielen Jahren beim Nutzbarmachen des Ansatzes im deutschen Sprachraum engagiert, trifft diese Voraussetzung in hohem Maße zu.
Voraussetzung ist auch umfangreiche therapeutische und Lehrpraxis in dem Ansatz; auch diese Voraussetzung ist erfüllt und kommt u. a. in den vielen informativen Beispielen zum Ausdruck.
Die Autoren geben nicht nur einen Überblick, sie schaffen auch Zugang zu weiterem Material.
CBASP ist ein Ansatz, der dies verdient hat: Seine Wirksamkeit ist in einer der größten Wirksamkeitsstudien belegt, er wurde zwar für eine spezifische Störung entwickelt, hat aber darüber hinaus nach meiner Einschätzung für viele Bestandteile ein hohes Potenzial, der Ansatz schafft den Spagat zwischen einer konsequent lerntheoretischen, aber gleichzeitig integrativen Haltung; und er kommt mit einem Minimum dessen aus, was Schulenbildung oder „Branding“ problematisch macht.
Die Aufnahme der Chronischen Depression in das DSM-5, die parallel zum Fertigstellen dieses Buches erfolgte, wird einen weiteren Beitrag zum Interesse an einer darauf gemünzten Behandlung leisten.
Dem Buch ist zu wünschen, dass es nicht nur die verdiente Verbreitung findet, sondern dass seine Inhalte auch tatsächlich mit Nutzen für Patienten und Therapeuten in die Praxis gelangen.
Bern, September 2013
Franz Caspar
|10|Vorwort zur 1. Auflage
Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) wurde von James McCullough speziell für die Behandlung chronisch depressiver Patienten entwickelt. Auf der Grundlage seiner langjährigen klinischen Erfahrung basiert das CBASP-Modell auf der Beobachtung, dass diese Patienten häufig Schwierigkeiten in der Bewältigung von interpersonellen Situationen haben. CBASP hilft ihnen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Dabei lässt sich der Therapeut persönlich und ganz individuell auf seinen Patienten ein, um mit ihm zusammen interpersonelle Fertigkeiten zu trainieren.
Bereits 1984 hat McCullough das CBASP erstmals in einem Fachartikel beschrieben (McCullough, 1984). Internationale Bekanntheit erfuhr das CBASP erst im Jahr 2000 mit der Veröffentlichung einer außergewöhnlich großen und erfolgreichen Psychotherapiestudie (Keller et al., 2000), in der CBASP mit einer medikamentösen Behandlung verglichen wurde. In rascher Folge veröffentlichte McCullough dann seine Behandlungsmanuale (McCullough, 2000; McCullough, 2006b). Diese wurden bald darauf auch in die deutsche Sprache übersetzt (McCullough, 2006a; McCullough et al., 2011).
Bei der Verbreitung des CBASP-Modells im deutschsprachigen Raum spielten mehrere universitäre Zentren eine entscheidende Rolle. So wurde das erste Behandlungsmanual beispielsweise gemeinsam durch Arbeitsgruppen der Universitäten Freiburg und Lübeck übersetzt (McCullough, 2000; McCullough, 2006a). In etwa zeitgleich wurde in den beiden Kliniken auch ein stationäres CBASP-Programm etabliert. Eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des CBASP im deutschsprachigen Raum spielt das CBASP-Netzwerk (www.cbasp-network.org), das auf Initiative von Elisabeth Schramm (Universität Freiburg) im Jahr 2008 gegründet wurde. In Absprache mit James McCullough organisiert das CBASP-Netzwerk in Deutschland die Ausbildung von CBASP-Therapeuten.
Dabei ist das CBASP kein statisches Modell. Vielmehr gibt es ständig Weiterentwicklungen. In der jahrelangen Anwendung und Auseinandersetzung mit dem Ansatz in Therapie, in Workshops und Supervision hat sich vieles geschärft und ausdifferenziert. Materialien wurden weiter oder neu entwickelt und in vielen Diskussionen sind neue Ideen entstanden und Anpassungen an den klinischen Alltag erfolgt. Diese Weiterentwicklungen werden auch auf den alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Treffen des CBASP-Netzwerks diskutiert und auf diese Weise von James McCullough begleitet. Die Quelle dieser Veränderungen sind neben James McCullough selbst auch viele andere Therapeuten und Forscher, die mit dem CBASP arbeiten. Teilweise liegen diese Weiterentwicklungen bereits in manualisierter Form vor (Einsatz bei komorbiden Störungen: Belz et al., 2013; CBASP stationär: Brakemeier, Guhn & Normann, 2021; CBASP in der Gruppe: Schramm et al., 2012). James McCullough arbeitet gegenwärtig selbst an einer Aktualisierung seines Behandlungsmanuals, das unter anderem auch für zukünftige Psychotherapiestudien Gültigkeit haben wird.
Das vorliegende Buch versteht sich als Leitfaden für die praktische Arbeit mit dem CBASP. Basierend auf unserer eigenen mehrjährigen Erfahrung bei der Arbeit mit chronisch depressiven Menschen und CBASP-Therapeuten, -Trainern und -Supervisoren haben wir den aktuellen Stand zum CBASP-Ansatz zusammengetragen und in praxisnaher Form aufbereitet. Dieser Praxisleitfaden bietet also einen ersten Überblick über das CBASP-Modell und die aktuellen Weiterentwicklungen. Zur besseren Auffindbarkeit der Originalmanuale werden die Quellen ausführlich genannt. So kann der interessierte Leser sein Wissen zu bestimmten Aspekten gezielt vertiefen.
Ein weiteres Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Verbindungen des CBASP-Modells zu anderen therapeutischen Ansätzen und zu anderen Methoden der Dritten Welle der Verhaltenstherapie aufzuzeigen. Dabei haben wir darauf geachtet, die Verbindungen auf der Ebene der Ideen und Konzepte aufzuzeigen. Auf der Ebene der Techniken haben wir uns aus Gründen der Stringenz und Klarheit auf die Beschreibung der Techniken des CBASP beschränkt. Auf diese Weise wollten wir vermeiden, dass der Leser Techniken als dem CBASP angehörig versteht, die zu anderen Methoden gehören.
Zuletzt noch eine wichtige Bemerkung: Wir haben in diesem Buch zur besseren Lesbarkeit durchgehend Personen in der männlichen Form beschrieben (z. B. Therapeuten statt Therapeutinnen und Therapeuten), auch wenn sich dies auf beide Geschlechter bezieht. Ausnahmen haben wir nur bei konkreten Fallbeispielen gemacht.
Wir wünschen dem Leser viel Spaß beim Lesen dieses Buches, Freude beim Anwenden der vermittelten Techniken und viel Erfolg in der Arbeit mit ihren chronisch depressiven Patienten.
|11|Danksagungen
Martina Belz möchte folgenden Personen danken: Ganz besonders dankbar bin ich James McCullough – er hat mir nicht nur die technische Seite von CBASP vermittelt, sondern war für mich von Anfang an auch ein eindrückliches Therapeutenmodell, von dem ich einmal mehr lernen konnte, wie wichtig eine authentische therapeutische Beziehung ist, und dass beides – Technik und Beziehung – nur in Verbindung miteinander ihre volle Wirkung entfalten können. Das, was ich als erfahrene Therapeutin schon immer zu wissen glaubte, hat durch CBASP eine klare empirische Grundlage erhalten. Franz Caspar hat in vielen Diskussionen wichtige kritische und innovative Impulse eingebracht, dafür danke ich ihm sehr. Elisabeth Schramm hat Dank verdient für die wichtige Rolle, die sie beim Vertreten und Weiterentwickeln von CBASP im deutschen Sprachraum gespielt hat und spielt. Last not least geht mein Dank zurück an Philipp Klein, der es in unnachahmlicher Weise verstanden hat, mich für dieses Projekt zu begeistern, und die Hauptlast der Arbeit getragen hat.
Jan Philipp Klein möchte folgenden Personen danken: James McCullough und Elisabeth Schramm für die nötige Geduld und die präzise Anleitung in der Ausbildung und Supervision im CBASP, Fritz Hohagen, Ullrich Schweiger und Kai G. Kahl dafür, dass sie mir diese Ausbildung ermöglicht haben. Susanne Weidinger für die Initiative zur Entstehung dieses Buches und die kompetente Begleitung während des gesamten Produktionsprozesses. Anne Runde, Sönke Arlt und Peter Neu für hilfreiche Hinweise nach der Durchsicht des Manuskripts. Meiner Frau und meinen Kindern, dass sie mir den nötigen Raum gegeben haben, an diesem Projekt zu arbeiten, das mir viel bedeutet hat. Susanne Steinlechner und Ruth Stender-Heinz stellvertretend für alle Mitglieder der Intervisionsgruppe CBASP Nord, meinen Patienten, Workshop-Teilnehmern und Supervisanden: Sie alle haben mir in der praktischen Arbeit den Blick für die Feinheiten des CBASP geschärft. Nicht zuletzt gebührt ein besonderer Dank meiner Koautorin Martina Belz. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht realisierbar gewesen.
Bern und Lübeck, September 2013
Martina Belz und Jan Philipp Klein
Vorwort zur 2. Auflage
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches sind einige Jahre vergangen, in denen wir viel Erfahrung mit dem CBASP sammeln durften. Viele Quellen haben zu diesen Erfahrungen beigetragen. An dieser Stelle sollen einige exemplarisch genannt werden:
Am wichtigsten sind natürlich die Erfahrungen mit unseren Patientinnen und Patienten, die uns immer wieder zeigen, auf welche Art und Weise das CBASP am besten funktioniert.
Direkt danach kommen die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die wir im Rahmen von Trainings und Supervision getroffen haben und die unseren Blick auf das CBASP weiter geschärft haben.
Von großer Bedeutung ist auch der ständige Austausch mit anderen Expertinnen und Experten in Bezug auf das CBASP, den wir im CBASP-Netzwerk pflegen.
Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, all diese neuen Erfahrungen für Sie auf eine verständliche und im praktischen Alltag gewinnbringende Art und Weise aufzuarbeiten.
Genauso wichtig sind unsere Erfahrungen aus mehreren wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, die uns geholfen haben, die dem CBASP zugrunde liegenden Annahmen immer besser zu verstehen. Auch unabhängig von diesen Abschlussarbeiten hat sich die Forschung im Bereich der chronischen Depression und des CBASP weiterentwickelt, sodass sowohl das Störungsmodell des CBASP als auch die Wirksamkeit des CBASP jetzt deutlich besser empirisch belegt sind.
Diese Erfahrungen und diese Erweiterungen des Wissens über CBASP fließen jetzt in die zweite Auflage ein, sodass ein vollständig überarbeitetes Buch entstanden ist, welches didaktisch noch einmal klarer ist als die erste Auflage. Wir sind dem Hogrefe Verlag und insbesondere Frau Susanne Weidinger sehr dankbar, dass sie uns die Gelegenheit geben, diese zweite Auflage zu veröffentlichen.
Bern und Lübeck, Herbst 2022
Martina Belz und Jan Philipp Klein