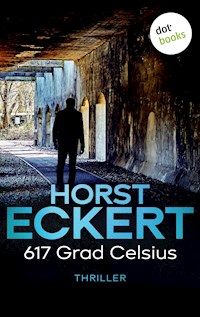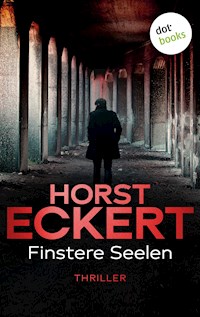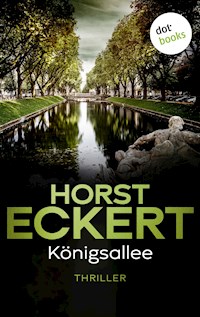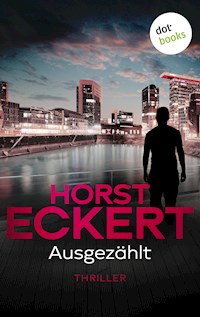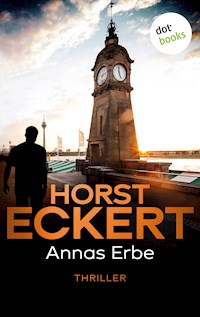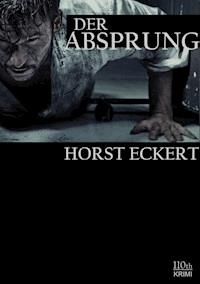Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kripo Düsseldorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
Von Afghanistan nach Düsseldorf: Der packende Thriller »Purpurland« von Bestseller-Autor Horst Eckert jetzt als eBook bei dotbooks. Nach zwei gescheiterten Geiselbefreiungen, bei denen ein Unschuldiger ums Leben kommt, lässt sich SEK-Polizist Felix May in den Streifendienst versetzen. Seine Hoffnung auf einen ruhigeren Job wird jedoch schnell zunichte gemacht, als er bei einem Einsatz eine entstellte Frauenleiche findet – und wiedererkennt: Es handelt sich um Julia, die Frau des Bundeswehrsoldaten Tim Sander, den May erst kürzlich in der Reha kennenlernte. Schon bald wird der Afghanistan-Rückkehrer zum Hauptverdächtigen der Düsseldorfer Kripo, doch May glaubt nicht an dessen Schuld und mischt sich in die Ermittlungen ein. Fest davon überzeugt eine Verbindung zu seinem letzten SEK-Fall zu sehen, gräbt May tiefer – und auch Julia Sander scheint kein unbeschriebenes Blatt gewesen zu sein … »›Purpurland‹ ist in seiner Kompromisslosigkeit atemberaubend, hält durchweg sein hohes Spannungsniveau – und steckt dabei voller Überraschungen, wie es sich für einen ausgezeichneten Krimi gehört.« Tip-Berlin Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Purpurland« von Horst Eckert ist Band 7 der fesselnden Thriller-Serie »Kripo Düsseldorf ermittelt«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nach zwei gescheiterten Geiselbefreiungen, bei denen ein Unschuldiger ums Leben kommt, lässt sich SEK-Polizist Felix May in den Streifendienst versetzen. Seine Hoffnung auf einen ruhigeren Job wird jedoch schnell zunichte gemacht, als er bei einem Einsatz eine entstellte Frauenleiche findet – und wiedererkennt: Es handelt sich um Julia, die Frau des Bundeswehrsoldaten Tim Sander, den May erst kürzlich in der Reha kennenlernte. Schon bald wird der Afghanistan-Rückkehrer zum Hauptverdächtigen der Düsseldorfer Kripo, doch May glaubt nicht an dessen Schuld und mischt sich in die Ermittlungen ein. Fest davon überzeugt eine Verbindung zu seinem letzten SEK-Fall zu sehen, gräbt May tiefer – und auch Julia Sander scheint kein unbeschriebenes Blatt gewesen zu sein …
»›Purpurland‹ ist in seiner Kompromisslosigkeit atemberaubend, hält durchweg sein hohes Spannungsniveau – und steckt dabei voller Überraschungen, wie es sich für einen ausgezeichneten Krimi gehört.« Tip-Berlin
Über den Autor:
Horst Eckert wurde 1959 in Weiden in der Oberpfalz geboren. Er studierte Politikwissenschaften in Erlangen und Berlin. 15 Jahre lang arbeite er als Fernsehreporter für verschiedene Sendungen, unter anderem bei der Tagesschau. Heute ist Horst Eckert freiberuflicher Schriftsteller: Für »Die Zwillingsfalle« erhielt der Autor den renommierten Friedrich-Glauser Preis. Der Autor lebt heute in Düsseldorf.
Von Horst Eckert erscheint bei dotbooks die Thriller-Reihe »Kripo Düsseldorf ermittelt« mit den Einzelbänden:
»Annas Erbe«, »Bittere Delikatessen«, »Aufgeputscht«, »Finstere Seelen«, »Die Zwillingsfalle«, »Ausgezählt«, »Purpurland«, »617 Grad Celsius« und »Königsallee«
Die Website des Autors: www.horsteckert.de/
***
eBook-Neuausgabe April 2022
Copyright © der Originalausgabe 2003 by GRAFIT Verlag GmbH, Chemnitzer Str. 31, D-44139 Dortmund
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von Lukasz Dro / shutterstock.com und Malivan_Iuliia / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-200-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Purpurland« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Horst Eckert
Purpurland
Thriller
dotbooks.
Für Edith und Elans
Prolog
Seit jenem Oktobertag im letzten Jahr kam ihm das Leben verkehrt vor. Eine große Lüge, die immer weitere Ausflüchte nach sich zog, um nicht als komplette Nullnummer aufzufliegen.
Felix May hing vermummt und in voller Einsatzmontur im Klettergeschirr an einem Altbau der Neusser Innenstadt auf Höhe des zweiten Stockwerks. Der Wind pfiff durch die Straße. In den Handschuhen wurden die Finger klamm. May versuchte die Gaffer an den Fenstern ringsum zu ignorieren.
Endlich seilte sich sein Kollege zu ihm ab, dabei energisch einen Kaugummi bearbeitend, als werde er dafür bezahlt. Sie lauschten den Funksprüchen. Die Verhandlungen waren abgebrochen worden, doch der Befehl zum Zugriff blieb aus. May griff nach der Sprechtaste des Funkgeräts und ließ sie mehrfach klicken. Er wollte wissen, was los war.
»Unverändert«, vernahm er aus den Helmlautsprechern die raue Stimme des Präzisionsschützen auf dem Dach gegenüber.
May beschloss, einen Blick zu riskieren. Er wischte die Regentropfen vom Visier, packte einen Löwenkopf, der die Fassade zierte, zog sich hinüber und tastete mit den Füßen nach Halt. Sein Nebenmann hob warnend die Hand.
Scheiß auf die Anweisung des Kommandoführers, dachte May. Und auf die Bedenken des Kaugummibeißers an seiner Seite.
Er fand Tritt auf einem mit Blech verkleideten Vorsprung. Langsam ging er in die Knie und schob sich aufs Fenster zu. Lautlos, hoffte er.
»Was tust du?«, ließ sich der Schütze von gegenüber vernehmen – noch so ein Spezialist der neuen Generation, der vermutlich sogar zum Zähneputzen einen Einsatzbefehl brauchte.
Keine Jalousie behinderte die Sicht. Die Praxis war hell erleuchtet. Die Helferin kauerte auf dem Linoleum, den Kopf unter den Armen vergraben. Der Gynäkologe lag im Behandlungsstuhl, die Handgelenke hinter der Lehne gefesselt. Sein Blick zeigte, dass er Panik schob. Die Füße des jungen Frauenarztes steckten in weißen Socken und ragten in die Luft – Leukoplast fixierte die Waden auf den Stützen.
Die Zielperson stand mit dem Rücken zum Fenster. Ein schmächtiger grauhaariger Mann, der reglos in den Vorraum äugte, die Waffe auf die Praxistür gerichtet. Als drohe ihm nur von dort Gefahr.
May löste den Bremshebel des Abseilgeräts und schwang sich durch die Scheibe. Glas zerbarst vor dem Visier. Scherben knirschten unter seinen Sohlen, als er aufsetzte. Ein plötzlicher Schmerz am Hals – ein Splitter war durch den Stoff der Maske gedrungen.
Er richtete die P226 mit beiden Händen auf die Zielperson. »POLIZEI! WAFFE WEG!«
Der Grauhaarige fuhr herum. Ein vages Lächeln im zerknitterten Gesicht. Sein Akzent klang nach Osteuropa oder Balkan: »Mach deinen Job, junger Mann.«
Nebenan klirrte Glas, der Kollege war offenbar ins Wartezimmer gesprungen. Ein Rütteln an der Verbindungstür – sie war verriegelt.
Die Zielperson hob den Revolver und zeigte Zähne, wie um Verzeihung bittend.
May blickte in die Mündung des kurzen Laufs und hoffte, dass Helm und Weste ihn schützen würden. Er packte seine Pistole fester und schrie: »WERFEN SIE DIE WAFFE WEG!«
Die Arzthelferin kroch unter den Tisch. Der gefesselte Gynäkologe bewegte stumm die Lippen. Getrappel im Treppenhaus – nur eine Frage von Sekunden, bis die Kollegen mit der Ramme den Praxiseingang aufbrechen würden. May fragte sich, welche Chancen sich der schmächtige graue Mann noch ausrechnete. Das Lächeln der Zielperson irritierte ihn.
Der Kerl drehte sich zur Seite und richtete seinen Revolver auf den Behandlungsstuhl. Der Gynäkologe wimmerte. Der Grauhaarige spannte den Hahn.
May drückte ab.
Die Arzthelferin kreischte. Im Vorraum donnerte die Ramme gegen den Eingang. Gleichzeitig flog die Tür zum Wartezimmer auf. Beim Anblick des Toten vergaß der Kollege seinen Kaugummi.
»Hat er sich selbst …«
May schüttelte den Kopf und legte die P226 auf den Tisch. Er nahm Helm und Maske ab, tastete nach der schmerzenden Stelle am Hals und fragte sich, was der Grauhaarige bezweckt hatte.
Der Mann mit dem Balkanakzent hatte keine Begründung für den Überfall genannt. Aber er war sich seiner Sache sicher gewesen. Als hätte er es so geplant.
Verkehrtes Leben.
Und die Lügen hörten nicht auf.
Teil IMohnblüte
»Was uns am heftigsten empört, ist in uns.«
Georges Bataille
Kapitel 1
Das Blechkleid des roten Lada war vielfach durchlöchert, in den Fensterrahmen steckten nur noch Glassplitter. Irgendwer hatte das Wrack auf Ziegelsteine gebockt und die Räder geklaut.
»Unser jüngster Fahndungserfolg«, sagte Dimitri.
Den Nachnamen des russischen Hauptmanns hatte sich Alex Vogel nicht gemerkt. In seinem Artikel würde er den glatt rasierten, drahtigen Kerl mit den rosigen Wangen ohnehin nur ›den Offizier‹ nennen.
»Vier junge Tadschiken«, erklärte Dimitri und verströmte leichten Wodkadunst. »Wir sie kontrollieren, sie Feuer eröffnen. Natürlich sie ziehen Kürzeren und natürlich sie hatten Heroin geschmuggelt.«
Der Hauptmann angelte die Fünfhundertgrammflasche aus der Ritze zwischen den Sitzen und nahm einen weiteren Schluck. Dabei lenkte er den UAZ-Militärjeep mit einer Hand im wilden Slalom um die Schlaglöcher. Er wich einem Kiosk aus – an dem Tisch mit Sonnenschirm saß eine Alte im bunten Gewand und bot Kekse, Getränkedosen und Flaschen mit Benzin feil. Der Geländewagen hüllte die Frau in Staub und krachte in eine Kuhle. Felgen knallten, die Ausstellfenster schepperten und Vogel prellte sich zum hundertsten Mal das Steißbein.
Sein Begleiter wischte sich Schnapstropfen vom Kinn und ergänzte: »Und natürlich ganze Stadt behaupten, die vier nur unschuldige Ausflugsleute und wir ihnen Drogen untergeschoben. Böse immer nur andere.«
Sie durchquerten Khorog. Hütten und schäbige Ziegelbauten aus der Chruschtschow-Zeit. Auch der Landschaft konnte Vogel nichts abgewinnen, Gebirgstäler hatte er schon immer als bedrückend empfunden. Das Provinzkaff lag in zweitausendfünfhundert Metern Höhe an einer Biegung des Pjandsch, der sich als Grenzfluss zu Afghanistan durch schneebedecktes Gebirge wand – Pamir auf dieser, Hindukusch auf der anderen Seite. Khorog war die Heimat einiger tausend tadschikischer Pamiris und Zentrum der Region Gorno-Badachschan im Südosten des Landes. Eine gottverlassene Gegend, fand Vogel.
Am Stadtrand tauchten hinter einer Biegung Baracken auf: die russische Kaserne. Vogel fragte sich, ob Dimitri dem Geheimdienst angehörte und wo er zuvor gedient hatte. Bis auf den starken Akzent war das Deutsch des Hauptmanns ganz passabel.
An der Zufahrt grüßte der Russe zwei Soldaten. »Kontraktniki«, raunte er Vogel zu. »Wir auf einheimische Söldner angewiesen. Leider. Sie ein bisschen …« Dimitri deutete eine Handbewegung an.
Unzuverlässig, überlegte Vogel. Bestechliche Tadschiken. Böse immer nur andere.
Der drahtige Hauptmann steuerte den Geländewagen auf den Kasernenhof, einen betonierten Platz zwischen grauen Baracken. Ein junger Offizier brüllte ein Dutzend Rekruten an. Sie warfen sich in den Staub und robbten. In den Sockel eines Denkmals waren Umrisse gemeißelt und rot ausgemalt – Vogel erkannte die Sowjetunion, ein Reich, das längst Geschichte war. Seit über zehn Jahren war das moslemische Tadschikistan unabhängig, zumindest offiziell.
Ein paar tausend Angehörige der russischen Armee waren in das Land zurückgeschickt worden, um den Schmuggel von Waffen und Heroin zu unterbinden. Oder um sich das Geschäft unter den Nagel zu reißen, wie Vogels Gewährsmann beim Bundeskriminalamt angedeutet hatte.
»Seit wann sind Sie hier?«, fragte er den russischen Hauptmann.
»Ich? Acht Jahre. Familie leben in Moskau. Mein Frau seit drei Monate nicht gesehen. Ich Nase voll. Vor drei Jahre in Hinterhalt geraten. Weit droben in Pamir. Waren Schmuggler von drüben. Sämtliche Kameraden tot. Ich nur verwundet und sie glauben, kaputt. So ich überleben. Aber Leute immer denken, wir Verbrecher und die anderen unschuldige Ausflugsleute. Welt nicht mehr, was mal war.«
Sie erklommen den Wachturm. Dimitri ignorierte den Soldaten, der auf der Bank seinen Rausch ausschlief, die Kalaschnikow im Arm wie eine Geliebte.
Unter ihnen toste der Pjandsch. An manchen Stellen war der Fluss breit und flach, über Felsbrocken konnte man ihn trockenen Fußes überqueren. Am Fuß der kargen Berge auf der anderen Seite trieb ein einsamer Turbanträger seinen Esel über das Geröll. Von der Schulter des Mannes baumelte ein Gewehr.
Der Hauptmann zeigte hinüber. »Afghanistan. Jetzt ihr dran.«
»Waren Sie dort? Ich meine, damals, in den Achtzigerjahren?«
»Nein. Damals Magdeburg. Schöne Stadt.«
Dimitri zündete sich einen Glimmstängel an, eine Kasbek mit einem Mundstück aus Pappe. Als er die Schachtel weitergeben wollte, winkte Vogel ab.
»Kein Wodka, kein Zigarette. Seltsamer Heiliger«, bemerkte der Offizier und lachte.
Vogel fröstelte. Die Sonne stand tief. Von der Frühjahrswärme war kaum noch etwas zu spüren.
Dimitri kniff die Augen zusammen und stieß den Rauch aus. »Wenn Schmuggler begegnen, du musst schießen. Egal ob Tadschike, Usbeke oder Afghan. Jeder hat Kalaschnikow. Letzte Jahr wir töten vierzig Illegale, fünfzehn Festnahme und nur ein Kamerad verloren.«
»Es gibt Gerüchte über Korruption in Ihrer Truppe.«
»Ich weiß. Bei Kontraktniki du nie sicher. Leute sprechen gleiche Sprache, hier und drüben. Aber bei uns Offiziere Sicherheitsdienst von Föderation passt auf.«
Der Hauptmann blickte dem Eseltreiber hinterher. Auf dem Rücken des Tiers schwankten Autoreifen. Vogel fragte: »Ein Schmuggler?«
Dimitri ergriff das Fernglas des schlafenden Wächters. Nach einer Weile antwortete er: »Soll Rekordernte geben.«
Vogel erinnerte sich an die Daten, die das BKA genannt hatte. Seit dem Ende des Talibanregimes war die Opiumproduktion auf das Zwanzigfache explodiert. Achtzig Prozent des Heroins, das auf dem europäischen Markt gehandelt wurde, stammten aus Afghanistan. Trotz der westlichen Truppen in dem Land hinter dem Fluss, trotz Dimitris Soldaten auf der tadschikischen Seite.
Vogel bedeutete dem Hauptmann, dass er genug gesehen hatte. Er war hungrig und müde. Der Flieger zurück nach Duschanbe würde in einer halben Stunde starten. Der Hinflug war grauenvoll gewesen: Ein paarmal hatte die Maschine fast die Felsen gestreift, in jedem Luftloch war Vogels Kopf gegen die Kabinendecke gekracht. Selbst wenn es Gurte gegeben hätte, wäre ein Anschnallen unmöglich gewesen – im überfüllten Flugzeug hatten sich jeweils drei Passagiere eine Bank geteilt, die für zwei bestimmt war. Nur weil Vogel aufgrund des Sauerstoffmangels immer wieder eingenickt war, hatte er den Flug ohne Panikattacken durchgestanden.
Wie gern würde er jetzt in einem Büro an der Düsseldorfer Königsallee hocken. Als Leiter der Lokalredaktion des Blitz. Doch der Verlag hatte ihm einen Typen aus der Zentrale vor die Nase gesetzt, einen hektischen Karrieristen mit großer Klappe und fehlendem Überblick. Kaum ein halbes Jahr später hatte Vogel der Redaktion den Rücken gekehrt – eine üppige Abfindung versüßte ihm den Abschied. Anschließend hatte er feststellen müssen, dass es keine offenen Stellen für Journalisten jenseits der vierzig gab.
Seitdem versuchte er sich als Freelancer – mit einigem Erfolg.
Seine Berichterstattung über die Ermordung eines Antiquitätenhändlers und seiner Familie hatte überregionale Beachtung gefunden. Er hatte Aufträge von angesehenen Magazinen ergattern können. Für die Zeit hatte er über Al-Qaida-Anhänger in Deutschland geschrieben, für den Stern über Mafiaclans im Kosovo. Seinen dabei geknüpften Kontakten zum Bundeskriminalamt verdankte er das Hintergrundwissen für die aktuelle Story.
»Der Außenminister besucht demnächst Afghanistan«, hatte der Ressortleiter Ausland des Stern gesagt, ein Enddreißiger im Joop-Anzug, von dessen Büro aus man den Hamburger Hafen überblicken konnte. »Sie kriegen acht Seiten. Zeigen Sie uns, wie das afghanische Drogengeschäft trotz deutscher Truppenpräsenz boomt. Der vergessene Krisenherd. Insight und human approach. Sie wissen schon.«
Vogel hasste den Job. Er war nicht dafür geschaffen, auf harten Pritschen zu nächtigen und sich von pappigem Brot und sehnigem Hammelfleisch zu ernähren. Ständig auf Achse zu sein, um Geschichten heranzuschaffen für Blattmacher, die ihren Arsch nie in eine überfüllte Maschine ohne Anschnallgurte und ausreichend Sauerstoff setzen würden.
Sie stiegen den Wachturm hinunter. Dimitri torkelte ein wenig. Auf dem Platz trabten die Rekruten im Kreis und brüllten ein russisches Lied. Ein riesiger Hund galoppierte auf Vogel zu. Ein Dobermann – Sabber tropfte aus dem hechelnden Maul. Vogel erstarrte, als der Köter an ihm hochsprang, seine Pranken gegen ihn stützte und die Zähne zeigte.
»Sitz!«, kommandierte Dimitri.
Der Hund gehorchte. Vogel klopfte sich staubige Pfotenabdrücke von der Brust.
»Er heißt Heino«, sagte der Hauptmann.
»Heino?«
»Ich liebe deutsche Kultur. Schwarzbraun ist Haselnuss. Leider wir mussten Ihr Land verlassen. Tadschikistan nicht gut. Ich überlege, zu wechseln Beruf. Aber was soll ich tun?«
Vogel blickte demonstrativ auf die Uhr. Höchste Zeit, zum Flugplatz aufzubrechen. Morgen würde er von Duschanbe nach Kabul fliegen. Eine Woche Afghanistan. Dann zurück im Tross des deutschen Außenministers in eine Welt, deren Straßen staubfrei waren und in der kein Dobermannköter Heino hieß, jedenfalls nicht aus Liebe zur deutschen Kultur.
Im Auto fragte Dimitri: »Was kosten Heroin in Deutschland?«
»Unverschnitten?« Vogel begriff, dass der Russe das Wort nicht verstand. »Das Gramm?«
Der Russe lachte. »Wir rechnen Kilo. Gramm nur bei Wodka. Letzte Jahr wir Heroin dreitausend Kilo Beschlag genommen.«
»Einhundert Euro, glaube ich«, antwortete Vogel. »Für ein Gramm.«
Dimitri nickte langsam, als rechne er den Preis in russische Rubel und tadschikische Diram um. Und in Kilo oder Doppelzentner. Der Offizier kniff die Augen zusammen – vielleicht überlegte er, wie gering der Anteil seines Bakschisch am Umsatz der globalen Drogenbranche war.
Wir sind beide nur kleine Würstchen, dachte Vogel beim Abschied. Jeder in seinem Metier. Wir riskieren unseren Arsch, aber die Gewinne fahren andere ein.
Kapitel 2
Tim Sander wunderte sich, wo der Jeep mit der Feldpost blieb.
Noch eine halbe Stunde bis zur Ablösung. Sander fror und war hungrig. Im Unterschied zu Locke, seinem Kameraden, hatte er während der gesamten Schicht nicht gepennt. Seit Stunden fegte ein Sandsturm über die Shomali-Ebene, in der das Rollfeld der Bagram Air Base lag, vierzig Kilometer nördlich von Kabul. Sander verstaute das Nachtsichtgerät. Die aufgehende Sonne drang als orangefarbene Funzel durch den staubigen Schleier.
Ein schwerfälliger vierstrahliger C17-Transporter senkte sich auf die Piste – Nachschub aus Ramstein oder Incirlik. Zwei Chinook-Bananen stiegen auf, mit ein paar Briten an Bord, die nach Kandahar verlegt wurden. Infanteristen, keine Elitetruppen. Die beiden Hubschrauber dröhnten dem Sturm entgegen, hinein in die Staubwolken.
Noch im Januar war hier mehr los gewesen. Bagram, die Drehscheibe der Anti-Terror-Allianz. Vor Agenten und Spezialeinheiten hatte es nur so gewimmelt: Delta Force, Army Rangers, Green Berets – doch plötzlich hatten die Amis all ihre Special Ops in den Irak abkommandiert und die Sondertruppen der Briten waren gefolgt. Angeblich versuchten Deutschland und Frankreich den Golfkrieg mit UN-Resolutionen zu verhindern, aber für Sander stand fest, dass das Gefeilsche um Worte nur Theater war.
Achtundneunzig Mann der dritten Kompanie des Kommandos Spezialkräfte aus Calw im Schwarzwald waren nun die Einzigen, die noch Terroristen jagten. Elitesoldaten an vorderster Front. Wie zum Trotz gegen die Politik der Bush-Regierung harrten sie aus. Old Europe am Hindukusch.
Sanders Augen brannten. Er spuckte Schleim aus entzündeten Bronchien, grau vom Dreck, den er seit fast fünf Monaten atmete.
Arschghanistan.
Gestern waren im Camp die Klimageräte ausgefallen. Sobald die Sonne höher am Himmel stand, würde die Temperatur in den Kunststoffcontainern auf Backofenhitze klettern. Zum Glück war er davon nicht betroffen.
Gleich nach dem Frühstück würde er mit seinem Zug in die Berge fliegen. Seit die Amerikaner den Hauptfeind im Irak ausmachten, witterten die hiesigen Schurken Morgenluft. Fanatiker hetzten gegen alles, was aus dem Westen kam. Sie wiegelten Bauerndeppen auf und schulten sie in mobilen Lagern zu Gotteskriegern. Irgendwo im Nordosten bahnte sich eine große Sauerei an, behaupteten die Spürnasen vom Zentrum für Nachrichtenwesen.
Wenn Sander und seine Kameraden in ein Dorf eindrangen, um Lehmhütten nach Waffen zu durchsuchen, war Adrenalin angesagt. Keine Festnahme ohne heftigen Widerstand. Kaum ein Kaff ohne Hinterhalt. Trotzdem bedauerte Sander die Doppelschicht nicht. Dem Daumendrehen im Lager zog er die Hatz in den Bergen vor.
Arschghanische Bärte jagen.
Sein Kamerad war aufgewacht. Locke kroch aus dem Schlafsack, stand ächzend auf und suchte Halt am Wall aus Sandsäcken, der den Checkpoint am Lagereingang sicherte. Er schaute sich um, fuhr sich über den kahl rasierten Schädel, dann kramte er Tabak aus einer Tasche und fragte: »Was verpasst die letzten Stunden?«
»Faule Sau«, erwiderte Sander.
Locke zerrieb einen braunen Klumpen und mischte die Krümel in den Tabak. Kaum ein Einsatz, bei dem der Kamerad nicht nebenher auf Einkaufstour ging.
»Du bringst uns beide in Teufels Küche«, warnte Sander.
Mit einer Hand drehte Locke die Zigarette. »Ich frag mich, wie du den Scheiß ohne was zum Rauchen aushältst.«
Sander hielt weiter Ausschau nach dem Jeep mit der Postlieferung. Der grau lackierte Geländewagen Marke Wolf war für ihn das Beste in diesem Land.
Zwei britische Tornados hoben für einen Übungsflug ab. Sander fand, dass es Arbeit genug gab, um die Jagdbomber rund um die Uhr auf Trab zu halten. Überall brodelte es. Paschtunen gegen Tadschiken. Truppen der Übergangsregierung gegen Warlord-Banden. Und stets im Namen des Koran.
Arschghanistan sucht den Super-Mudschahed.
Vor allem für die Schutztruppen, die unten in Kabul stationiert waren und dort Hilfspolizei spielten, wurde es von Tag zu Tag ungemütlicher. Sniper-Attacken, Autobomben, Granateneinschläge. Selbst der regulären Armee war nicht mehr zu trauen. Sie bestand aus Milizen der Nordallianz und übergelaufenen Taliban. Hinter jedem Bart konnte sich ein Irrer verbergen, der den Westen hasste und ins Paradies wollte.
Die Spürnasen vom Geheimdienst versuchten den Überblick nicht zu verlieren. Sie warfen mit Dollars um sich und rekrutierten Informanten. Je dichter die Agenten ihre Netze flochten, desto bedrohlicher malten sie die Szenarien aus. Worst case: Sobald die Amis den Irak platt machen, tobt der Mob am Hindukusch.
Trau niemals einem Bart.
Noch hielt die Berliner Regierung am Bundeswehreinsatz fest. Sanders Kommando Spezialkräfte operierte von Bagram aus im Norden und Osten des Landes. Es galt, den Schutztruppen in der Hauptstadt den Rücken freizuhalten. Zwei Agenten des Zentrums für Nachrichtenwesen führten Regie bei den KSK-Einsätzen. Sie unterstanden dem Verteidigungsministerium und hatten sich gegen die Konkurrenz vom Bundesnachrichtendienst durchgesetzt.
Sander hatte sich noch nicht festgelegt, was er von den beiden bulligen Kerlen halten sollte. Stunde um Stunde brüteten sie vor ihren Laptops über Satellitenaufnahmen und Protokollen abgehörter Funksprüche. Sie markierten Rambo, wenn sie einen Einsatz begleiteten – die MP5 in der einen Hand, das Satellitenhandy in der anderen. Weil der eine mit Vornamen Hardy hieß, nannte jeder im Kommando den anderen nur Laurel.
Letzte Woche war Camp Warehouse, das Feldlager der Schutztruppen in Kabul, mit Granaten beschossen worden – zum zwölften Mal, seit ein deutscher Generalleutnant dort das Kommando führte. Zugleich hatte mitten in der Hauptstadt eine ferngezündete Rohrbombe eine Patrouille erwischt und fünf Soldaten verletzt sowie den einheimischen Dolmetscher getötet, einen jungen Burschen, der eigentlich Verlobung hatte feiern wollen.
Es hieß, dass der Generalleutnant in Camp Warehouse am Rad drehte. Der Besuch des deutschen Außenministers stand bevor. Er musste unbeschadet seine Show abziehen können und die Medienleute, die ihn begleiteten, durften nicht erfahren, wie brenzlig die Lage in Wirklichkeit war.
Auch im KSK-Lager draußen in Bagram herrschte Alarmstimmung. Hardy und Laurel schleppten neue Gerüchte an. Die Bombenleger von letzter Woche stammten angeblich aus den Bergen im Nordosten. Sie sollten noch vor der Ankunft des Ministers ausgeschaltet werden – deshalb die Doppelschicht. Die Devise lautete: Das Kommando Spezialkräfte spürt das Terrornest auf, den Rest erledigen die britischen Tornados.
Doch wo zum Teufel blieb heute die Post?
Zwei Kameraden trotteten auf Sander zu. Die Ablösung.
»Wird aber auch Zeit«, brummte Locke und zog an seiner Selbstgedrehten.
Ein Leutnant der Führungsgruppe ließ sich am Lagereingang blicken. Er bellte herüber: »Macht sofort eure Ausrüstung klar! Start in fünf Minuten. Frühstück und Einsatzbesprechung gibt’s unterwegs.«
Locke trat seine Zigarette aus.
»Warum so eilig?«, rief Sander zurück.
»In den Bergen ist ein Hilfstransport überfallen worden. Horneburg vom Nachrichtenwesen hat ihn begleitet.«
»Laurel? Ist er verschütt gegangen?«, erkundigte sich Locke, schon wieder etwas schläfrig.
»Fragt nicht so blöd. Macht, was ich sage!«
In diesem Moment brauste der Wolf heran. Der sandfarbene Mercedes-Geländewagen mit der Feldpost. Sander rannte dem Jeep entgegen und zwang ihn zum Halten.
Der Leutnant schrie: »Hat dir der Staub die Ohren verklebt?«
Sander griff nach dem Umschlag, den der Postfahrer der Kiste auf dem Beifahrersitz entnahm. Doch der Fahrer zog den Brief zurück und schnupperte daran, als wittere er Parfüm – jedes Mal die gleiche Show.
Die Stimme des Leutnants überschlug sich: »WIRD’S BALD?!«
Sander entriss dem Fahrer den Umschlag und warf einen Blick auf den Absender.
Düsseldorf. Seine Frau.
Sander stopfte den Brief unter die Schutzweste. Der Tag war gerettet.
Kapitel 3
Wenige Autostunden vor Faizabad wurden sie angehalten. Die fünfte Straßensperre, seit sie in Kabul aufgebrochen waren. Eine Gruppe lokaler Milizangehöriger, die Turbane tief ins Gesicht gezogen, westliche Armeejacken über weißen Hemden, die bis auf die Knie reichten.
Alex Vogel streckte die Papiere aus dem Auto und überließ Lima das Reden. Er sah den jungen Kerlen an, dass sie nicht gern mit einer Frau verhandelten.
Lima war Angestellte des United Nations Drug Control Program in Kabul. Als Vogel sie in ihrem kahlen Büro, mit dem Foto des Präsidenten an der Wand kennen gelernt hatte, war sie eine hübsche junge Frau mit langem Haar und freundlichem Lächeln gewesen. Beim Verlassen der Stadt hatte sie sich ein großes Kopftuch umgelegt und tief in die Stirn gezogen. Sie war einsilbig geworden und kniff die Augen zusammen – nicht nur wegen des Sonnenlichts.
»Sie verlangen Stempelgebühr«, erklärte die Afghanin.
»Wie viel?«
»Einhundert. Sie sagen, sie akzeptieren auch Euro.«
Vogel nestelte einen Schein aus dem Geldgürtel. Er hatte längst aufgegeben zu verbergen, wo er das Bargeld aufbewahrte und wie dick der Gürtel gefüllt war. Es war die Kohle der Redaktion. Er musste nicht einmal Belege sammeln.
Neben ihm betätigte Steve den Auslöser, die Kamera lässig hinter Limas Schulter verborgen. Vogel wusste, dass der Rothaarige als einer der besten Kriegsfotografen galt. Ein Amerikaner mit deutsch klingendem Familiennamen, vielleicht ein Sohn jüdischer Emigranten. Er wirkte ruhig, fast schüchtern. Kein Krisenherd der letzten zehn Jahre, den der Kerl nicht bereist hatte, immer an vorderster Front. Wenn das Foto nicht gut ist, warst du nicht nah genug dran – Kabul zu verlassen und den Ausflug ins Herz des Hindukusch zu wagen war die Idee des Amerikaners gewesen.
Vogel hatte sich gefügt. Er ahnte, dass in der Hamburger Redaktion im Zweifelsfall das Wort des Starknipsers galt, nicht seins.
»Und wo bleibt der Stempel?«, wollte Vogel wissen, als er die Papiere zurückerhielt.
Lima gab die Frage weiter. Die Burschen lachten. Vogel bemerkte, dass sie Schmuck trugen, dicke Ringe und Goldkettchen. Er zwinkerte ihnen zu, um die Atmosphäre zu entspannen.
Die UN-Angestellte übersetzte: »Papiere des Bürgermeisters von Kabul müssen hier nicht gestempelt werden.«
»Zu wem gehören diese Leute?«
»Nordallianz, nehme ich an. Kamil Schah heißt der Mudschahed, der schon seit zehn Jahren die Gegend beherrscht.« Sie wechselte ein paar Dari-Worte mit den Bewaffneten und ergänzte: »Sie sagen, ihr Chef sei nicht Kamil Schah, sondern Hamdullah Tareq, ihr Dorfältester. Sie behaupten, wir befänden uns auf dem Boden einer autonomen Region. Keine Ahnung, was sie damit meinen.«
Steve schaltete sich ein: »Ask them about the plantations.«
Lima erwiderte: »Hier gibt es keine Mohnfelder! Das habe ich doch schon erklärt. Es verstößt gegen den Koran, und die Regierung hat den Anbau verboten. Alles wurde abgebrannt. Die UN zahlen den Bauern 1.750 Dollar pro vernichtetem Hektar.«
Vogel sagte: »Bitte, frag sie.«
Drei Tage waren sie bereits auf der Suche nach Schlafmohnplantagen und Heroinküchen durch die zerklüftete Landschaft gerumpelt, über Geröllpisten, Sandwege, ausgetrocknete Flussbetten. Immer höher hinauf ins öde Nirgendwo. Hinter den Gipfeln am Horizont lagen der Grenzfluss und das Pamir-Gebirge, patrouillierte Dimitri, der russische Hauptmann.
In den letzten Dörfern, durch die sie gekommen waren, hatten die Basare einen gut sortierten Eindruck gemacht. Früchte, Konserven, bunte Ballen in Heimarbeit gewebter Stoffe. Klobige goldene Uhren an den Handgelenken der Budenbesitzer. Ein Anzeichen, dass sie sich der Heimat der Heroinbarone näherten – so viel hatte Vogel begriffen.
Er fragte sich, ob er Lima vertrauen konnte. Vielleicht war sie korrupt wie alle anderen. Geschmiert von Gangstern, voller Schiss vor Stammesfürsten.
Lima übersetzte in Afghanen-Kauderwelsch. Sie benutzte viele Worte, als rede sie um den heißen Brei herum. An den Reaktionen der Turbanträger erkannte Vogel, dass es hier sehr wohl Plantagen gab. Er zupfte einen weiteren Schein aus dem Packen vor seinem Bauch. Diese Sprache begriffen sie.
Zwei der Kerle winkten mit ihren Kalaschnikows und kletterten auf den Landcruiser. Sie gaben dem Fahrer Kommandos, die Vogel nicht verstand.
Die Karre verließ die Piste und holperte einen Pfad entlang, den sonst wahrscheinlich nur Packesel benutzten. Der Körpergeruch der neuen Mitfahrer stach in Vogels Nase und er begann sich zu fragen, ob er noch Gast war oder schon Gefangener.
Hinter einer Kuppe öffnete sich der Blick in ein Seitental, dessen Hänge purpurn in der Vormittagssonne leuchteten. Mohn, so weit das Auge reichte. Eine Farborgie, die Vogel verblüffte. Wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt.
Ohne Hektik stieg Steve vom Geländewagen und machte Bilder. Die Milizangehörigen schienen nichts dagegen zu haben.
Unten im Tal hielten sie noch einmal an und spazierten durch die Felder. Vogel registrierte die zarte Schönheit der Pflanzen. Gegen weiteres Bakschisch demonstrierten die Turbanträger, wie man die Fruchtkapseln anschnitt, damit Saft austrat. Der Fotograf knipste hautnah.
Lima redete eine Weile mit den Bewaffneten, dann gab sie Auskunft: »Sie sagen, ihre Leute hätten jeden Flecken Land mit Mohn bepflanzt, sogar dort, wo sonst Weizen oder Mais wachsen würde. Sie teilen das Ausgleichsgeld für die Feldervernichtung mit korrupten UN-Kontrolleuren und brennen nur einen Teil ab. Sie schimpfen auf die Basaris, die ihnen schlechte Preise bezahlen. Und sie hassen Kamil Schah und die Warlords der Nordallianz, weil sie den zehnten Teil der Ernte kassieren. Ein Nachbar wollte keinen Mohn anbauen, weil es gegen den Koran verstößt. Dann seien Kamils Männer gekommen und hätten ihn erschossen. Jetzt haben die Bauern ihre Unabhängigkeit erklärt.«
Die Bösen sind immer die anderen, dachte Vogel. In Kabul hatte man ihm das Gegenteil erzählt: Kamil als treuer Verbündeter der Anti-Terror-Allianz.
Steve kehrte zum Landcruiser zurück. »Where is the village?«
Vogel war nicht besonders scharf darauf, diese wild gewordenen Bauern noch länger um sich zu haben, aber er verzichtete auf Widerspruch.
Sie erreichten eine Ansammlung von flachen Hütten aus Lehm und Natursteinen und gondelten durch ein Gewirr von Gassen und Hinterhöfen. Esel schrien, Hunde kläfften. Eine Horde Kinder lief neben dem Auto her. Sie plärrten: »How are you?«
Vogel warf Kugelschreiber aus dem Fenster und schaute zu, wie die Rotzbengel sich balgten. Unter anderen Bedingungen hätte er das Kaff als malerisch empfunden.
Die Bewaffneten führten ihn und seine Begleiter in ein Haus, das als einziges von einem dürren Baum überschattet wurde. Der erste Raum, der vom Flur abzweigte, war quadratisch und schmucklos bis auf eine Lage Teppiche. Ein alter Bauer mit graubraunem Käppi bat sie, Platz zu nehmen, und servierte grünen Tee. Der Raum füllte sich. Einige Männer zeigten harzige Klumpen vor, die sie zu Krümeln zerrieben. Vogel lehnte ab, als er verstand, dass sie ihm Opium anboten. Die Frauen streiften die Burka ab. Steve fotografierte am laufenden Band.
Hamdullah Tareq, der Dorfälteste, trug einen weißen Rauschebart, sein rechtes Bein war unterhalb des Knies amputiert. Er hielt eine Ansprache, dabei unablässig Vogel mit seinen dunklen Augen fixierend.
Lima übersetzte: »Die Deutschen sind die Freunde der Afghanen, sagt er.«
Der Alte brabbelte weiter und Lima erklärte nach einer Weile: »Er hat zwei seiner Söhne zum Studieren nach Europa geschickt. Ich kann gar nicht glauben, dass die Leute hier so wohlhabend sind.«
Der Rauschebart hörte nicht auf zu reden. Vogel bemerkte, dass Steve klammheimlich nach draußen verduftete.
Lima sagte: »Hamdullah Tareq ist enttäuscht darüber, dass die Deutschen seine Feinde unterstützen.«
Der Weißbart wurde lauter und gestikulierte. Die anderen Männer nickten und murmelten Zustimmung.
»Was sagt er?«, flüsterte Vogel.
»Sie wollen den Ushr nicht bezahlen.«
»Den was?«
»Den zehnten Teil. Die Abgabe, die Kamil Schahs Männer verlangen.«
Sie tranken Tee. Der Fotograf kehrte zurück. Steve wirkte unruhig.
»Let’s go«, murmelte der Amerikaner. »We’ve seen everything.«
»Everything?«
Der Rothaarige nickte und schob Vogel die Hälfte seiner Filmdosen zu. Der begriff: Wenn einem von ihnen etwas zustieß, konnte der andere zumindest einen Teil der Ausbeute retten.
Lauter werdendes Stimmengewirr tönte aus den Gassen, dann krachten Schüsse.
Der Starfotograf sprang auf, um nachzusehen. Vogel mahnte ihn zu bleiben, doch der Kerl war schon weg.
Dann knatterten Salven, wie ein Gewitter, das nicht aufhören wollte.
Kapitel 4
Von oben betrachtet kam ihm die Landschaft wie ein abstraktes Gemälde vor. Erde faltete sich in sämtlichen Brauntönen. Pfade und trockene Flussläufe schlängelten sich durch das Bild. Dunkle Punkte stellten Packesel und ihre Führer dar. Ein paar Felder in einer Senke: Schachbretter in Grün und Gelb. Ab und zu etwas Purpur abseits der Straße – Mohnanbau.
Die wenigen Fahrzeuge auf der Piste nach Faizabad zogen kilometerlange Staubfahnen hinter sich her. Die Huey dröhnte darüber hinweg.
Sander überflog den Brief ein zweites Mal, um den Glücksmoment zu verlängern. Julia schrieb, dass es ihr gut gehe und wie sehr sie sich nach ihm sehne. Lind wie immer beklagte sich seine Frau, dass er sie so lange allein ließ.
Als sei er zum Vergnügen am staubigen Arsch der Welt.
Erst im Sommer hatten sie geheiratet und sich in Calw ein Reihenhäuschen gemietet – zu wenig Zeit für Julia, sich in der Garnisonsstadt einzuleben und Freundschaften zu schließen. Deshalb war sie für die Dauer seines Auslandseinsatzes zu ihrer Tante ins Rheinland gezogen.
Sander dachte voller Wut an das Reportervolk, das seit Beginn des Afghanistankriegs im Schwarzwald eingefallen war. Die Medienfuzzis versuchten die Geheimhaltung zu knacken und gingen den Angehörigen der KSK-Soldaten auf die Nerven. Sander konnte Tante Karolin zwar nicht leiden, aber er war froh, dass Julia bei ihr untergekommen war.
Seine Frau schrieb, dass ihre Schauspielerei Fortschritte mache. Julias Traum: einmal auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. Vormittags jobbte sie als Kinderfrau, den Rest des Tages nahm sie Unterricht.
Sander war stolz, dass Julia die Aufnahmeprüfung an einer echten Schauspielschule geschafft hatte. Aber ihm war klar, dass sie zu Hause in Calw mit dem Gelernten nicht viel würde anfangen können.
Er las, dass sie nebenher als Model gearbeitet hatte. Modeaufnahmen für Werbeprospekte. Das Honorar, so schrieb sie, habe sie in etwas angelegt, das älter sei als er, aber fast genauso schnell auf hundert zu bringen.
Mit vibrierenden Fingern zog Sander noch einmal das beigefügte Foto aus dem Umschlag. Er drückte seine Lippen auf das Bild. Noch fünf Wochen, Liebste. Und auch ohne Schauspielerei bist du mein Star.
Er bemerkte, dass die Kameraden grinsten.
Nur Hardy stand draußen auf den Kufen, als wolle er jeden Moment abspringen. Die Turbine der Huey dröhnte auf Hochtouren.
Sander verstaute den Brief wieder unter der Schutzweste. Es wurde ernst.
Immer mehr rote und violette Felder. Sander spähte auf die Landstraße und versuchte Laster und Jeeps anhand ihrer Staubfahnen zu identifizieren. Die längsten gehörten zu den japanischen Geländewagen, mit denen die Milizen der Warlords unterwegs waren.
Die Bärte mit ihren Kalaschnikows waren nicht auszurotten.
Die vier Soldaten des Kommandotrupps überprüften ihre Geräte. Das G36, der Nachfolger des legendären G3-Schnellfeuergewehrs, auf das die gesamte Bundeswehr zurzeit umgerüstet wurde. Die MP5-SD3 von Heckler & Koch, leider recht anfällig gegen Sand und Staub. Und die Winchester Magnum, im Dienstgebrauch G22 genannt – mit der Sniperwaffe traf Sander auf achthundert Meter punktgenau.
Locke montierte sein Maschinengewehr auf die Schwenklafette. Hardy studierte das Display seines GPS-Geräts. Er rief in die Kabine: »Von hier hat er sich zuletzt gemeldet!«
Sander fragte sich, warum Laurel einen Hilfstransport begleitet hatte, der nach Auskunft seines Geheimdienstkollegen Saatgut und Unterrichtsmaterial in die Bergprovinz bringen sollte.
Hardy schob die Sonnenbrille zurecht und brüllte: »Das waren höchstwahrscheinlich die gleichen Bärte, die den Aufstand gegen Kamil Schah proben und unsere Jungs in Camp Warehouse bombardieren. Sobald wir Horneburg rausgeholt haben, fordere ich die Royal Airforce an. Da bleibt kein Auge trocken!«
Sander kletterte zu ihm auf die Kufe und lugte hinunter.
Gebirgswüste. Flache Dächer reflektierten das Sonnenlicht. Drei Geländewagen hielten aus Richtung Faizabad auf das Dorf zu. Rushhour im Hindukusch – Sander tippte auf Toyotas.
Aber keine Spur von den Unimogs des Hilfstransports.
In dieser Gegend hatten die Leute nie eine Zentralregierung anerkannt. Sander wusste, wie das lief: Gib einem Bart ein Gewehr und er macht sich selbstständig.
Hardy bat den Piloten, tiefer zu fliegen.
Es dauerte keine Minute, bis Sander die Bescherung entdeckte: fünf zivile Unimogs kreuz und quer auf dem Grund einer Schlucht, die Planen aufgeschlitzt, die Ladeflächen offenbar leer geräumt.
Zwei Kameraden seilten sich ab. Hardy folgte ihnen. Locke und Sander sollten von oben sichern. Sander entschied, dass es ausreichte, wenn sein noch vom Opium gedämpfter Kamerad an Bord blieb.
Er klinkte das Seil ein, gab dem Piloten Zeichen und ließ sich auf einen Hügel hinab, von dem aus er Schlucht und Landstraße überblicken konnte.
Der Hubschrauber stieg höher und begann, Kreise zu ziehen. Es war eine UH-1D mit Zusatztanks, die notfalls stundenlang die Berge absuchen konnte. ›Huey‹ war der Spitzname, den die Amis bereits dem Vorläufermodell verpasst hatten – zu Zeiten des Vietnamkriegs.
Unten blieb alles ruhig. Weit und breit kein Bart. Kein Verkehr auf der Piste. Nur ein Rumpeln und Scharren, das aus der Schlucht zu Sander heraufdrang.
Die Kameraden rüttelten an zerbeulten Türen und spähten in die Fahrerkabinen. Hardy zerrte einen Afghanen hervor, der offenbar nicht mehr lebte. Ein Fahrer des Transports, mutmaßte Sander.
Er schritt hinüber zur Straße und suchte nach Spuren eines Kampfes. Oberhalb des Steilhangs stieß er auf Patronenhülsen, Anzeichen eines Schusswechsels. Jede Menge Reifenabdrücke. Die trockene Erde war ringsum aufgewühlt.
Sander erinnerte sich an die Staubfahnen und an das Dorf, das offenbar das Ziel der drei Toyotas gewesen war.
Stiefelspuren und weitere Hülsen. Eine leere Transportkiste. Der Deckel einer zweiten und lose Bretter. Ein Papierfetzen wehte davon, als Sander das Holz aufhob.
Er fing ihn ein und entzifferte bürokratische Kürzel, die für ihn nach Bundeswehr klangen: LogBrig 2, TrspBtl 370. Eingerissene Löcher, die vermutlich von Heftklammern stammten. Er strich das Papier glatt und las einen Ortsnamen. Unverkennbar deutsch: Neckarzimmern.
Nach Sanders Wissen residierte dort ein Gerätehauptdepot des Heeres. Er konnte sich keinen Reim darauf machen.
»Was machen Sie da?«, schrie ihn Hardy an, der mit den zwei Kameraden im Schlepptau den Hang heraufgeklettert kam.
Sander antwortete: »Drei Jeeps sind von hier aus ins Dorf gefahren, das im Südwesten liegt. Mindestens ebenso viele haben sich in die andere Richtung verzogen. Etwas weiter drüben gab es einen Schusswechsel und hier haben die Bärte die Beute umgeladen.«
Er gab den Abriss an Hardy weiter.
Der feiste Agent warf einen Blick darauf und steckte das Papier ein. Er ruckelte an der Sonnenbrille und blaffte: »Warum sind Sie nicht im Hubschrauber geblieben?«
»Soll da wirklich nur Saatgut auf den Unimogs gewesen sein?«
»Ich habe angeordnet, dass Sie uns sichern!«
Sander blieb ruhig, obwohl er innerlich vibrierte. »Sie sind hier der Kundschafter. Befehle empfange ich nur von meinen Vorgesetzten.«
Die landende Huey übertönte die Antwort des Aufklärers. Sie stapften zur Maschine und stiegen ein. Hardy gab dem Piloten Anweisungen, dabei das Display seines GPS-Geräts mit dem Bildschirm im Cockpit vergleichend.
Rasch tauchte das Dorf am Horizont auf.
Auf einem rissigen Acker ging der Helikopter nieder. Sander bemerkte, dass ihm Hardys Blick auswich. Wahrscheinlich würde sich der Agent am Abend beim Kommandoführer beschweren.
»Auf geht’s!«, rief Hardy.
Vier schwer bewaffnete Männer sprangen in den Staub und rannten auf den ersten Schuppen zu, hinter dem sie keuchend Deckung suchten. Sander blickte sich um. Der Agent war beim Hubschrauber geblieben und quasselte aufgeregt in sein Satellitenhandy.
Als sie das Dorf fast erreicht hatten, teilten sich die KSK-Männer paarweise auf und schlichen in entgegengesetzter Richtung von Lehmwand zu Lehmwand. Im Halbkreis um die Siedlung, um von zwei Seiten einzudringen.
Gefolgt von Locke huschte Sander durch enge Gassen, bis ihnen das Geschrei sich balgender Kinder entgegenschallte. Sie zogen sich in einen Hofeingang zurück und stießen unvermutet auf einen Platz, der an einer breiteren Zufahrt lag.
In der Mitte befand sich der Dorfbrunnen, davor parkten die drei Geländewagen. Auf den Ladeflächen stapelten sich Kisten, notdürftig mit Hanfseilen vor dem Abrutschen gesichert.
Ein halbes Dutzend Bärte hielten ein Palaver ab. Junge Typen in Sanders Alter, die den Inhalt einer aufgebrochenen Kiste begutachteten.
Gewehre.
Die Burschen drehten und wendeten die Waffen, feuerten Probeschüsse in die Luft. Die Bärte gerieten ganz aus dem Häuschen. Sander konnte den Blick nicht von ihnen lösen. Das waren nicht die landesüblichen AK-47. Nicht die Sturmgewehre des guten Professors Kalaschnikow.
Was die Kerle jubelnd in die Höhe reckten, war die alte Standardwaffe jedes Bundeswehrsoldaten. Das G3-Schnellfeuergewehr aus deutscher Produktion.
Ihm fiel der Zettel ein. Der Ausriss eines Begleitscheins aus dem Gerätehauptdepot Neckarzimmern. Wie zum Teufel kamen die Waffen in den Hindukusch?
Sanders Atem stockte, als ein rothaariger Kerl in Jeans und Weste aus einem Haus trat und sich der Gruppe näherte. Der Westler hob eine Kamera ans Auge und knipste.
Locke und Sander zogen sich zurück. Sie nahmen einen weiteren Abzweig, um keinem der Bärte über den Weg zu laufen. Solange sie Laurel nicht entdeckt hatten, konnten sie keine Konfrontation riskieren. Den dreisten Fotografen zu schützen war nicht ihr Job.
Die Gasse endete in einem weiteren Hof. Unter einem Bretterverschlag werkelte eine Frau in leuchtend blauer Burka. Sie kippte braune Klumpen in eine Tonne und rührte um. Das Zeug brodelte auf offenem Feuer. Beißender Geruch stach in Sanders Nase.
Locke fragte flüsternd: »In was für ein verdammtes Nest sind wir hier geraten?«
Wie zur Antwort drangen aus einer Maueröffnung Stimmen. In das Kauderwelsch der Bärte mischte sich eine Frauenstimme. Wörter in gebrochenem Deutsch. Sander schlich auf das Loch zu. Vorsichtig spähte er hinein.
Zuerst erkannte er nur ein zweites Fenster auf der gegenüberliegenden Seite und davor einen dürren Baum und einen weiteren Landcruiser, der dort parkte. Dann gewöhnten sich Sanders Augen an das Dämmerlicht im Inneren des Zimmers.
Ein Beinamputierter schwang Reden. Eine Frau ohne Zeltumhang übersetzte einem mittelalten Typen mit schwammigem Gesicht und müden Augen – noch ein Weißer unter all den Einheimischen. Wieder war es nicht Laurel.
Der Kerl machte Notizen und Sander begriff, dass er ein Reporter war, der zu dem rothaarigen Fotografen und vermutlich zu dem Wagen vor dem Haus gehörte.
Gewehrsalven krachten. Die jungen Bärte auf dem Dorfplatz feierten ihre Beute. Ein G3 nach dem anderen ratterte sein Magazin leer. Der Test wuchs sich zu einem Geknatter aus, das Sander an Silvester erinnerte.
Ein gewaltiges Donnern brachte das Gewehrfeuer zum Verstummen.
Die Erde zitterte und ein Tornado fauchte über die Häuser hinweg, so tief, dass Sander das britische Hoheitszeichen am Leitwerk erkennen konnte. Ein zweiter Kampfjet folgte – noch ein Einschlag in nächster Nähe.
Staub und Schreie füllten die Luft.
Sander blickte sich um – keine Rauchfahnen. Er schätzte, dass die Luft-Boden-Raketen knapp außerhalb des Dorfs niedergegangen waren. Seine zitternde Hand fand die Sprechtaste am Spiralkabel, das an seiner Jacke hing. Er versuchte einigermaßen ruhig zu bleiben, als er Hardy über Helmfunk anflehte, die Briten zur Vernunft zu bringen.
Ein Kamerad des anderen Zweierteams antwortete. »Verdammt, was war das?«
Die Jagdbomber rasten erneut im Tiefflug heran.
Sander schob Locke durch die Fensterluke und kletterte hinterher. In dem düsteren Raum hatte jemand die Teppiche beiseite gezogen. Die Leute, die eben noch debattiert hatten, waren in einem Kellerloch verschwunden.
Ausgelatschte Stufen führten in einen unbeleuchteten Gang. Sander hatte keine Ahnung, ob der Keller als Bunker taugen würde, aber er sah keine andere Wahl.
Sie stiegen hinab und zogen die Falltür hinter sich zu – morsche Bretter, viel zu dünn.
Als Sander ein dumpfes Pfeifen vernahm, warf er sich zu Boden, seinen Kameraden dabei mitreißend. Die Druckwelle rüttelte Sander durch. Seine Ohren knackten. Die Falltür splitterte, der Zugang füllte sich mit Trümmern einstürzenden Mauerwerks.
Durch Ritzen drang etwas Tageslicht in den Kellergang.
Seltsam: Alles war still.
Gleich darauf ein zweites Rütteln, das noch kräftiger war. Die Ritzen verdunkelten sich. Sander glaubte zu spüren, wie das gesamte Haus auf die Decke des Gangs stürzte. Aber noch hielt sie.
Finsternis und völlige Stille – ihm wurde bewusst, dass er taub geworden war.
Sein Kamerad krabbelte sich frei. Sander wühlte die Taschenlampe aus der Tasche an seinem Oberschenkel. Staubschwaden tanzten im Lichtstrahl. Lockes Mund formte Sätze, die Sander nicht hören konnte.
Er tastete sich weiter. Der Gang vor ihnen war frei. Sander stolperte über unebenen Boden und gelangte in einen Lagerraum.
Etwa fünfzehn Menschen blinzelten dem Strahl seiner Lampe entgegen. Bärte und Frauen ohne Zelt sowie der Weiße, den Sander für einen Journalisten hielt. Sie kauerten auf dem Lehmboden und lehnten sich gegen Säcke, die längs der Kellerwand bis unter die Decke gestapelt waren. Aus einem Riss rieselte helles Pulver. Ein Heroinlager.
In seinen Ohren klingelte es. Sander bemerkte, dass Locke versuchte Funkkontakt herzustellen. Ein erneuter Treffer ließ die Erde beben. Die Bombe detonierte nicht genau über ihnen, doch der Staub wurde dichter.
Sander hustete und konnte es hören. Auch die Schreie der Menschen um ihn herum vernahm er nun, wenn auch dumpf, wie durch eine Wand. Es minderte seine Panik nicht. Er wusste, dass die Bomber nicht so bald abdrehen würden.
Hardys Worte: Da bleibt kein Auge trocken.
Die nächste Angriffswelle brachte den Kellergang zum Einsturz. Bis in den Lagerraum kullerte der Schutt. Die Leute klammerten sich aneinander. Sander wehrte Hände ab, die sich in seinen Tarnanzug krallten. Er gewann sein Hörvermögen zurück, aber er wünschte sich, das Wehklagen nicht wahrnehmen zu müssen – und nicht den Gestank sich entleerender Därme. Staub schnürte seine Lungen ein. Er schloss die Augen. Weit schneller, als er befürchtet hatte, wurde der Sauerstoff knapp. Müdigkeit packte ihn und ihm war klar, dass es keine Hilfe geben würde. Keiner würde in den Trümmern dieses Dorfs nach Überlebenden suchen.