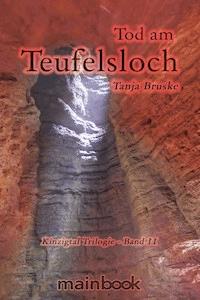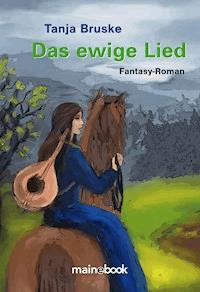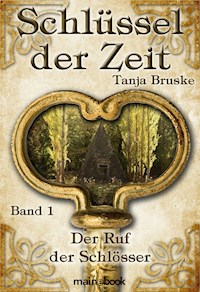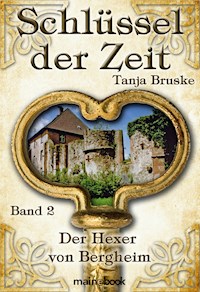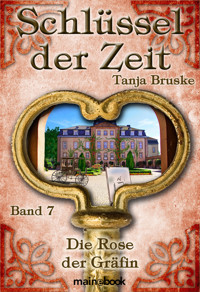Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Main-Kinzig-Kreis in seiner ganzen Vielfalt: Der Lettner in Gelnhausen, die Brüder Grimm, das Birsteiner Wilde Weib, der Hanauer Wassergeist, aber auch Kaiser Barbarossa, Napoleon oder Goethe und zahlreiche weitere wundersame Gestalten haben ihren Auftritt in diesem Sammelsurium von Geschichte und Geschichten aus der Region zwischen Main und Kinzig. Mit dabei ist auch der Raben-Stephan, geheimnisumwitterter Führer auf dieser fantastischen Reise von Steinau bis Hanau und von der Steinzeit bis in eine weit entfernte Zukunft. Diese Sammlung von Kurzgeschichten aus der Feder von Tanja Bruske enthält auch die preisgekrönte Novelle "Der Henker und die Hexe" (Stadtschreiberpreis von Eggenburg 2018). Tanja Bruske schreibt Geschichten und Romane, die im Main-Kinzig-Kreis angesiedelt sind: Kennen Sie schon die Kinzigtal-Trilogie mit den Romanen "Leuchte", "Tod am Teufelsloch" und "Fratzenstein"? Oder die Serie "Schlüssel der Zeit"? Orte und Städte der gesamten Region mit ihren überlieferten Legenden und historischen Besonderheiten spielen die Hauptrolle in den Texten der Autorin aus Hammersbach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
eISBN 978-3-948987-29-9
Copyright © 2021 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Layout: Olaf Tischer
Covermotiv Rabe: © drbimages
Historische Karte Main-Kinzig © Reiner Erdt
Besuchen Sie uns im Internet: www.mainbook.de
Tanja Bruske
Raben-Stephan & Co.
Geschichte(n) aus dem Kinzigtal
Die Autorin
2007 legt Tanja Bruske ihren ersten Fantasy-Roman »Das ewige Lied« (neu aufgelegt bei mainbook) vor, mit dem sie den Wettbewerb des Radiosenders FFH »Hessens verheißungs-vollstes Manuskript« gewinnt. Ab Juni 2013 erscheint ihre Kinzigtal-Trilogie bei mainbook: »Leuchte«, »Tod am Teufelsloch« und der Abschlussband 2017 »Fratzenstein«.
Im September 2018 gewinnt Tanja Bruske mit ihrer Novelle »Der Henker und die Hexe« in Österreich den Titel »Stadtschreiberin von Eggenburg 2018«. Die Geschichte ist im Buch „Raben-Stephan & Co.“ enthalten.
Seit 2014 schreibt Tanja Bruske zudem unter dem Pseudonym Lucy Guth für die Bastei-Serie »Maddrax«, seit 2019 auch für »Perry Rhodan Neo«.
Mit »Schlüssel der Zeit« legt sie bei mainbook eine lokale Histo-Fantasy-Serie vor, die im Main-Kinzig-Kreis angesiedelt ist und im Taschenbuch- und E-Book-Format erscheint. Die Serie wird fortgesetzt.
Tanja Bruske studierte Germanistik sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-versität in Frankfurt und arbeitet heute als Redakteurin bei der GNZ. Sie wohnt im hessischen Hammersbach mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern.
Aktuelles und Lese-Termine finden Sie auf:
www.tanjabruske.de
Inhalt:
Die Legende des Raben
Das Jüngste Gericht
Der Lauscher im Baum
Der Henker und die Hexe
Die Nacht vor der Schlacht
Kinzig-Geisterstunde
Die Perlen
Gelas Gelübde
Die Leiche
Johanns sonderbare Begegnung
Das Koberspiel
Märchenmörder
Das Püppchen
Am Ende der Geschichte
Danksagung
Die Legende des Rabens
„Ich warne dich, Georg, tu das nicht! Bleib auf dem Weg!“
Ich drehte mich zu dem Mönch um. Im Schein seiner Laterne sah Johannes bleich und ängstlich aus. Der junge Geistliche war abgestiegen und hielt sein Pferd am Zügel. Hinter ihm verschwand die Straße nach Oystheim in der Dunkelheit. Wir hatten das Örtchen bei Einbruch der Dunkelheit passiert und hätten uns vermutlich dort eine Unterkunft suchen sollen. Aus einer Tollheit heraus hatten wir beschlossen, bis nach Marköbel weiterzuziehen. Das Dorf hatte den Ruf, größer zu sein und die besseren Gasthäuser zu besitzen. Und jetzt standen wir hier, im Dunkel der Septembernacht, und hatten einen Geist vor uns. Jedenfalls war Johannes der festen Meinung, dass das flackernde Licht in einiger Entfernung ein Geist sei.
„Du kannst ja hier bleiben. Aber ich will mir dieses Phänomen näher ansehen.“ Ich hob meine Laterne, fasste die Zügel des Pferdes fester und drehte mich zu dem Licht um, das über dem Feld schwebte und auf mich zu warten schien. Will es mich irgendwohin führen?
„Im Namen des Herrn, Georg, folge nicht den Verlockungen des Satans!“, hörte ich Johannes’ angstvolle Stimme. Ich seufzte. Schon als das seltsame Licht zum ersten Mal neben dem Weg aufgetaucht war, wäre Johannes vor Angst beinahe vom Pferd gefallen. Seitdem murmelte er ein Gebet nach dem anderen. Ich amüsierte mich über ihn, obwohl ich das Licht auch unheimlich fand. Aber mich faszinierte es mehr, als dass es mich ängstigte. Das ist wohl der Unterschied zwischen einem studierten Magister und einem einfachen Mönch.
Vor einigen Augenblicken war das Licht auf dem Weg direkt vor uns erschienen, ganz nah, sodass wir anhalten mussten. Es war eine leuchtende Kugel, wie ein kleiner Stern. Nachdem wir abgestiegen waren, hatte sich das Licht zum Feld hin bewegt, neckend, auffordernd. Und ich war gewillt, mich auf sein Spiel einzulassen.
„Wir treffen uns in Marköbel“, rief ich meinem Reisegefährten zu. Wir kannten uns noch nicht lange, waren durch puren Zufall gemeinsam auf der Via Regia unterwegs. Ich war ihm nicht verpflichtet, aber ich wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen. Später am Abend würden wir über dieses Abenteuer lachen.
Mein Pferd war allerdings anderer Ansicht: Es scheute und zerrte am Zügel, und ich musste alle Überredungskunst aufbieten, um es zum Weitergehen zu bringen. Der Geist entfernte sich, und ich musste mich beeilen, um aufzuschließen. Das Gelände war hügelig, und als ich mich das nächste Mal umwandte, waren die Straße und der Lichtpunkt von Johannes’ Laterne nicht mehr zu sehen. Nur meine Lampe, das Geisterwesen und die Sterne am Himmel gaben mir noch etwas Orientierung. Unwillkürlich fasste ich nach dem Silberamulett, das ich um den Hals trug. Die vertraute kleine Münze in meinen Fingern fühlte sich gut an.
Ich erreichte sumpfiges Gelände. Mein Schuhwerk gab auf diesem Grund schmatzende Geräusche von sich, die mir Gänsehaut verursachten. Und mein Pferd bockte endgültig. „Nun komm schon weiter“, redete ich auf das Tier ein und zerrte am Zügel. Das gefiel ihm nicht: Das Tier stieg. Ich verlor auf dem sumpfigen Boden den Halt und geriet ins Straucheln. Im nächsten Moment erwischte mich ein wirbelnder Huf an der Brust. Ich hörte es Knacken, ehe ein grausames Stechen durch meinen Körper raste und ich durch die Luft geschleudert wurde. Der Boden war weich, doch das machte den Aufprall nicht besser. Ich rang nach Luft und fragte mich, ob eine Rippe gebrochen war und ob sie in meinem Körper noch mehr Unheil anrichten würde. Ich war nicht mehr in der Lage, mich zu bewegen – mein Körper bestand nur noch aus Schmerzen. Über mir spannte sich das Sternenzelt, und ich hörte Hufschlag, der sich entfernte. Jeder meiner Atemzüge wurde von einem Pfeifen begleitet. In meinen Ohren rauschte es immer lauter. Das Letzte, das ich sah, war der Geist, der zurückkehrte – vielleicht, um mich ins Totenreich zu holen.
Als ich die Augen wieder aufschlug, war es heller Tag. Eine Krähe kreiste über mir – wollte sie sich an meinem toten Körper laben? Aber noch war es nicht soweit. Zwar fühlte ich mich, als hätte mich ein Pferd getreten, aber ich lebte. Da fiel es mir ein: Mich hatte wirklich ein Pferd getreten; mein eigenes. Ich setzte mich auf und bereute es sofort: Ein feuriges Stechen fuhr wie ein Speer durch meine Brust. Ich japste nach Luft.
Die Krähe landete krächzend vor mir.
„Verschwinde“, sagte ich unwirsch. Es klang ebenfalls wie ein Krächzen. Der Vogel blieb sitzen und starrte mich aus seinen schwarzen Augen an. Er legte den Kopf schief.
„Ich bin keine Mahlzeit für dich!“ Wenn ich das Federvieh recht betrachtete, so war es keine Krähe, sondern ein Rabe. Er war deutlich größer als die Vögel, die auf den Feldern in meiner Heimat Helmstadt herumgehüpft waren. Und er hatte einen imposanten Schnabel, den er zu einem langgezogenen Krächzen öffnete. Ich schauderte, griff nach einem Stein und warf ihn in Richtung des Vogels. Er wich geschickt aus und setzte sich ein paar Schritte entfernt auf einen Felsbrocken, um mich weiter zu beobachten.
Ich beschloss, das Tier zu ignorieren und sah mich um. Ich lag am Rande eines Sumpfes, in der anderen Richtung erstreckten sich Wiesen. Von meinem Pferd und von dem Geisterwesen keine Spur. Ich verfluchte beide. Mit zitternden Fingern öffnete ich mein Hemd. Ein kinderkopfgroßer, blau-roter Abdruck verzierte die Herzseite meines Oberkörpers.
Es dauerte einige Zeit, bis ich es schaffte, aufzustehen, stets beäugt von dem Raben. Jeder Schritt war eine Qual, aber ich konnte schlecht mitten in der Wildnis liegen bleiben. Nur Johannes wusste, wo ich war. Und ob der Mönch wirklich auf mich gewartet hatte, bezweifelte ich. Meine Eltern wähnten mich an der Universität, und noch stand ich bei niemandem in Lohn und Brot, der mich vermissen würde. Mein Plan war gewesen, bis Leipzig zu reisen und mich an der Universität zu bewerben. Kurz hatte ich mit dem Gedanken gespielt, die Universität in Mainz aufzusuchen, hatte das jedoch wieder verworfen. Diese Lehranstalt erschien mir zu jung, sie war erst ein paar Jahre vor meiner Geburt entstanden und schien mir nicht angemessen. Vielleicht würde ich später noch einmal dorthin gehen. Im Gegensatz zu anderen Gelehrten vertrete ich die Meinung, dass es für einen Philosophen und Doktoren angemessen ist, viel von der Welt zu sehen. Ich bin eben von Natur aus neugierig – was mir nun zum Verhängnis geworden war.
Ich schlug die Richtung ein, aus der ich gekommen zu sein glaubte. Zu meinem Glück fand ich einen Stock, auf den ich mich stützen konnte. Je länger ich lief, desto leichter fiel es mir, und ich war guten Mutes, das Dorf Marköbel trotz meiner Verletzungen bald zu erreichen. Ich fand die Straße wieder, die mir bei Tageslicht weitaus schmaler und schlechter vorkam als am Abend zuvor.
Mit einem leisen Krächzen landete der Rabe auf dem Weg, den ich unschlüssig betrachtete. „Du bist ja immer noch hier. Ich sagte doch, dass ich keine Mahlzeit bin.“ Ich deutete auf den Weg. „Das soll die Via Regia sein? Sie ist nicht gepflastert, nicht einmal befestigt. Das ist ein besserer Trampelpfad.“ Der Rabe legte den Kopf schief. Er hüpfte ein paar Schritte auf dem Weg. Ich seufzte und ging weiter.
Kurz darauf stand ich vor einer Siedlung, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Gräben umfassten eine Mauer. Von der Beschreibung her kam es am ehesten dem nahe, was ich in Cäsars „De Bello Gallico“ gelesen hatte: einem römischen Kastell. Wie kam es, dass Marköbel aussah wie ein Militärlager aus den glorreichen Tagen des römischen Kaiserreiches? Wenn es denn Marköbel war, das vor mir lag. Meine Verwirrung wuchs, vor allem, als ein römischer Soldat durch das Tor trat – oder zumindest jemand, der genau so gekleidet und gerüstet war, inklusive Helm, Schild und einem Panzer über seiner Tunika. In der rechten Hand hielt er einen Kurzspeer.
Der Soldat sprach mich an. „Barbarus, quid tibi hic negotii est?“
Er sprach tatsächlich Latein. Ich habe es bis zu diesem Moment immer für eine Redensart gehalten, aber mir blieb der Mund offen stehen. Was sollte das hier? War das ein Streich, den man mir spielte? Aber wer sollte so etwas tun?
Der Soldat wurde ungeduldig. „Age, dic!“
Ich beeilte mich, der Aufforderung nachzukommen – der Römer wollte wissen, was ich hier wollte. Es fiel mir jedoch schwer. Ich hatte die lateinische Sprache zwar studiert, aber nie zuvor zur Konversation benutzt.
„Ego perdidit“, sagte ich etwas kläglich. Ob der Römer verstand, dass ich mich verirrt hatte? „Villa quaeritis … Marköbel …“
Der Römer wies südöstlich am Kastell vorbei. „Vicus illic est.“ Er drehte sich gelangweilt um und ging zurück in die Umfriedung.
Ich zuckte zusammen, als der Rabe neben mir auffordernd krächzte.
„In diese Richtung also?“, versicherte ich mich bei dem Raben. Statt mir zu antworten, flog er voraus. Ich humpelte hinterher.
Dieses „Vicus“ entpuppte sich als winzige Siedlung. Einige Dörfler traten aus ihren Hütten. Der Römer hatte mich als Barbar bezeichnet – in meinen Augen waren das hier Barbaren: Die Dorfbewohner waren in einfache Fell- und Leinengewänder gekleidet und beäugten mich misstrauisch. Ich versuchte, mich mit ihnen zu verständigen – als ich mit meinem Deutsch nicht weiter kam, versuchte ich es mit Latein. Diese Sprache schienen sie zwar zu erkennen, aber ihre Mienen blieben abweisend.
Ich taumelte zwischen den ärmlichen Hütten hindurch, die man kaum als Häuser bezeichnen konnte, und fragte mich, was mit mir geschehen war. War ich vielleicht tot und in einem seltsamen Geisterreich gefangen? Ich fand keine Erklärung. Das Stechen in meiner Brust wurde schlimmer. Ich lehnte mich zum Verschnaufen an die Wand eines Hallenbaus – soweit ich sehen konnte das größte Gebäude in der Siedlung. Sofort wurden die Dörfler unruhig. Sie zeigten mit dem Finger auf mich und riefen einzelne Worte – ihre Sprache klang fremd in meinen Ohren. Doch ich verstand: Sie waren nicht damit einverstanden, dass ich mich dem Gebäude genähert hatte. Ich entfernte mich sofort von der Halle; vielleicht war es ein Tempel oder eine Kirche. Doch ich hatte die Leute bereits gegen mich aufgebracht. Sie kamen drohend auf mich zu, und ich humpelte davon, so schnell ich konnte. Im Davonlaufen traf mich ein Stein so fest am Hinterkopf, dass ich stolperte.
Ich verließ die kleine Siedlung in östlicher Richtung. Plötzlich war der Rabe wieder da und flatterte vor mir her. „Du warst eine große Unterstützung“, raunzte ich ihn an – als hätte mir der dumme Vogel in meiner merkwürdigen Situation irgendwie helfen können.
Es fiel mir immer schwerer, Luft zu bekommen, und ein unangenehmes Rasseln steckte in meinen Lungen. Dort, wo mich der Stein getroffen hatte, pochte mein Kopf. Als ich mit den Fingern über die Stelle strich, fühlte ich feuchte Wärme zwischen meinen Locken. Dazu überkam mich eine Panik, wie ich sie nie zuvor im Leben verspürt hatte. Ich wusste nicht, wo ich war, wer diese Leute waren. Ich hatte eine ungefähre Ahnung, dass ich mich weit – sehr weit – von der Welt entfernt befand, die ich kannte.
Das Dröhnen in meinen Ohren nahm zu. Die Geräusche des Raben vernahm ich nur noch undeutlich. Vor meinen Augen tanzten dunkle Flecken, die immer größer wurden. Kurz nachdem ich den Waldrand erreicht hatte, brach ich zusammen und verlor das Bewusstsein.
Der Geruch nach Rauch und gebratenem Fleisch stieg mir in die Nase und weckte mich. Mein Kopf dröhnte, als hätte ich am Vorabend drei Flaschen Muskateller geleert. Mein restlicher Körper stand dem in nichts nach: Er schmerzte von der Nasenspitze bis zum großen Fußzeh. Deswegen verzichtete ich vorläufig darauf, die Augen zu öffnen. Ich ahnte, dass Licht die Qual noch verstärken würde. Stattdessen lauschte ich. Prasseln eines Feuers, Blätterrauschen – und das unverkennbare Geräusch von einem Wetzstein, der eine Klinge schärft. Das brachte mich dazu, doch die Augen zu öffnen. Ich starrte an die grob gezimmerten Deckenbalken einer Holzhütte. Daran hingen getrocknete Kräuter, ein ausgeweideter Hase und ein dürres Vogelnest.
Zu meinen Füßen krächzte es. Ich hob den Kopf – was eine Schmerzkaskade durch meine Schläfen jagte – und sah den Raben am Fußende meines Lagers hocken. Hinter ihm saß, auf einem Schemel, ein Mann mit einem beeindruckenden langen weißen Bart und Augen, die so hellblau waren, dass sie zu leuchten schienen. Er schärfte mit dem Wetzstein eine Sichel.
„Wird auch Zeit, dass du aufwachst“, begrüßte er mich. Er beherrschte meine Sprache akzentfrei. „Du bist seit Stunden bewusstlos. Das Fleisch wird kalt.“
Er stand auf und ging zum Feuer hinüber, das in einigen Schritten Entfernung in einer offenen Kochstelle loderte. Darüber hing ein gewaltiger Kessel, in dem etwas leise vor sich hin blubberte. Der Mann trug einfache Leinenkleidung wie die Dörfler. Sein federnder Gang widersprach seinem augenscheinlichen Alter. Er griff nach einem Holzteller, der neben der Feuerstelle auf einem Tisch stand. „Deine Verletzungen sind schwer, werden aber gut verheilen. Du musst gut essen, um wieder zu Kräften zu kommen.“ Damit reichte er mir den Teller, auf dem eine Hühnerkeule und ein Stück Brot lagen.
Verwundert setzte ich mich auf, nahm das Essen entgegen und bedankte mich. Die Hütte war nicht besonders groß. Neben meinem Bett – einem einfachen Holzgestell mit Tierhäuten und Decken – und der Feuerstelle gab es ein weiteres Lager aus Fellen und Stroh, eine hölzerne Truhe und zu dem erwähnten Tisch zwei Hocker. „Wer bist du? Und wo bin ich?“
Der Alte setzte sich wieder auf den Schemel und nahm seine Wetztätigkeit wieder auf. „Man nennt mich Grannus, und du bist in meiner Hütte.“
„Du hast mich im Wald gefunden und mit hierher gebracht?“
Der Mann wies auf den Raben. „Der Rabe hat mich heute Morgen zu dir geführt. Es ist meine Aufgabe, zu heilen. Und du hattest Hilfe nötig. Hattest du Ärger mit den Dorfbewohnern?“
„Sie fanden es nicht sehr erbaulich, dass ich mich der großen Halle genähert habe.“
Grannus nickte verstehend. „Ah, das Nemeton, die heilige Halle. Sollte man als Fremder meiden.“ Er wies auf meine Brust, die mit Stoffstreifen bandagiert war. „Und damit ist auch nicht zu spaßen. War wohl ein Pferd? Dachte ich mir. Die Heilpaste sollte helfen.“
Ein Heiler also. Wahrscheinlich ein Einsiedler. Solche Menschen hielten sich oft intelligente Raben, hatte ich gehört. Die Vögel waren sehr gelehrig, hieß es. Ich hatte die Schwarzfeder unterschätzt – ihr verdankte ich es, dass ihr Herr mir zu Hilfe gekommen war. Dankbar riss ich ein Stück Fleisch vom Knochen und hielt es dem Raben hin. Er hüpfte zu mir und holte sich den Leckerbissen.
„Du sollst nicht den Raben füttern, sondern selbst essen“, sagte Grannus streng. Das tat ich folgsam – und merkte, was ich für einen Hunger hatte.
„Bin ich in der Nähe von Marköbel?“, fragte ich, während ich das letzte Fett mit dem Brot vom Teller wischte.
„Ja und nein.“
„Was soll das heißen?“
„Um das zu begreifen, solltest du die Antwort auf eine andere Frage kennen.“
Ich runzelte die Stirn. „Und die wäre?“
Der Alte beugte sich vor und grinste. „WANN bist du?“
Mir blieb der letzte Bissen fast im Halse stecken. Ich hustete und röchelte eine Weile. „Wie meinst du das?“, fragte ich, als ich wieder dazu in der Lage war. Dabei ahnte ich es längst.
Die irritierenden Augen des Alten schienen mich zu durchdringen und mir in die Seele zu blicken. „Nun, so wie es mir scheint, hast du eine lange Reise hinter dir – eine Reise durch die Zeit. Oder bist du, wie ich, während der Regentschaft Kaiser Hadrians geboren?“
Grannus’ Eröffnung versetzte mir einen Schlag, der härter war als der Tritt des Pferdes. Für längere Zeit war ich nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu stammeln und auf meine Hände zu starren. Grannus war geduldig mit mir. Er versorgte meine Wunden und ließ mich in Ruhe – bis ich soweit war, ihm wieder Fragen zu stellen.
„Woher wusstest du es?“
Um Grannus’ Augen bildeten sich kleine Lachfältchen. „Es war nicht zu übersehen – zumindest wenn man schon selbst in der Zeit gereist ist … wie ich.“
Es verschlug mir für einige Herzschläge die Sprache. Grannus merkte es und sprach weiter. „In meinem Volk bin ich das, was sie einen Druiden nennen. Du würdest mich vielleicht als Priester bezeichnen, als Heilkundigen, Gelehrten – oder vielleicht als Magier.“
Ich zuckte unwillkürlich zurück und war gleichzeitig seltsam fasziniert. „Du … du beherrschst die schwarzen Künste?“
Grannus drehte bescheiden die Handflächen nach oben. „Einen Bruchteil von dem, was du so nennst.“
„Und dazu gehört das Reisen durch die Zeit?“
„Ja.“
Ich zögerte nicht. „Bring es mir bei!“ Ich schwang trotz der Schmerzen meine Beine über den Rand meines einfachen Bettes, bereit, mich sofort ins Abenteuer zu stürzen.
Grannus verschränkte die Arme vor der Brust. Plötzlich wirkte er abweisend. „Warum?“
„Weil ich zurück will!“
„Ist das alles?“
Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ist das alles? Um die Wahrheit zu sagen: Nein. Ich wusste bereits in diesem Moment, dass ich mehr wollte.
Und Grannus wusste das auch. Er grinste. „Das dachte ich mir. Aber es ist nicht so leicht, wie du glaubst. Es gehört viel Übung dazu. Konzentration.“ Er deutete auf das Amulett, das ich um den Hals trug. „Ist das dein Gott?“
Ich berührte das Amulett. „Nicht ganz. Es ist …“
„Völlig gleich. Wenn du reisen willst, wirst du an andere Dinge glauben müssen.“
Meine Finger umschlossen schützend das Amulett.
„Und du wirst ein Anderer werden. Du musst dich neu erfinden. Und dennoch wird es vielleicht nicht möglich sein.“
Warum nicht? Ehe ich die Frage stellen konnte, beantwortete Grannus sie. „Nicht jeder Mensch ist dazu geeignet.“
„Aber ich bin bereits gereist!“
Grannus lachte abfällig. „Du bist bewegt worden – du hast dich nicht selbst bewegt. Dazu bedarf es einer besonderen Befähigung. Die Elemente müssen dich akzeptieren.“
„Welche Elemente? Wovon redest du?“
Grannus stand auf und ging zu der hölzernen Truhe. Er öffnete sie behutsam und holte etwas heraus. Mit vier tönernen Töpfen kehrte er zu der Bettstatt zurück, stellte sie neben mir auf die Felle. In einem befand sich dunkle Muttererde, in einem anderen Wasser. In einem waberte ein seltsames weißes Gas – der Gelehrte in mir wunderte sich, warum es sich nicht verflüchtigte. Im letzten befand sich eine Kerze, die Grannus entzündete.
„Wir werden es gleich wissen. Wer die Elemente beherrscht, beherrscht das Reisen.“
Er forderte mich auf, mich auf die Erde zu setzen und das erste Tontöpfchen vor mir auf den Boden zu stellen, das mit dem Wasser. „Konzentriere dich“, befahl er. „Halte deine Hand über das Elementgefäß. Schließe deine Augen und bitte im Geist das Wasser, dir auf dem Weg durch die Zeit beizustehen. Keine Angst – du bist unerfahren, deine Reise wird also nicht weit gehen. Wenn du überhaupt zu den erwählten Reisenden gehörst.“
Ich gehorchte. Ich kniff die Augen zusammen und wünschte mir von ganzem Herzen, durch die Zeit reisen zu können. Aber es geschah nichts, als dass ich mir zunehmend lächerlich vorkam.
„Das reicht“, sagte Grannus schließlich ruhig. „Nimm die Erde und versuch es damit.“ Aber auch dieser Versuch blieb erfolglos. Als mich Grannus aufforderte, nun im Geist die Luft anzurufen, klang er enttäuscht.
Ich tat mein Bestes, dachte angestrengt an die Luft und stellte mir vor, wie ich auf ihr durch die Zeit ritt wie auf einem Pferd. Doch umsonst.
„Nun gut, du kannst noch das Feuer versuchen“, sagte Grannus. Aber er klang nicht so, als ob er mir einen Erfolg zutrauen würde. Mit zitternden Fingern ergriff ich das Tongefäß, in dem die Kerze – so lang und so dick wie mein Daumen – leise flackerte. Ich stellte sie vor mir ab, wobei das Töpfchen leise auf dem Holzboden klackerte.
Ich wünschte mir nichts so sehr, wie Erfolg zu haben. Was würde das bedeuten – die Zeit bereisen zu können? Die ganze Welt stünde mir offen. Ich holte tief Luft und schloss die Augen. Ich streckte die Hand aus und hielt die Hand über das Gefäß. Die Hitze der Flamme kitzelte meine Handfläche. Ich hörte ein leises Krächzen, dann ein Flattern. Dann spürte ich Vogelkrallen auf meinem Handrücken. Es erforderte meine ganze Konzentration, mich nicht zu rühren. Es war der Rabe des Druiden, ich wollte Grannus nicht verärgern, indem ich sein Tier verscheuchte. Kurz hatte ich das Gefühl, dass von dem warmen Tierkörper ein Blitz durch meine Hand nach unten zuckte und Aufregung erfasste mich. Doch dann flatterte der Rabe wieder davon.
Enttäuschung machte sich in mir breit. „Es funktioniert nicht“, sagte ich und öffnete die Augen. Als erstes sah ich Grannus’ grinsendes Gesicht, erhellt vom Schein einer Lampe. Dann sah ich die Kerze vor mir, die bis auf einen winzigen Stumpf heruntergebrannt war. Draußen war die Dunkelheit hereingebrochen.
„Du hast es geschafft.“ Grannus neigte anerkennend den Kopf. „Nur ein paar Stunden, aber das Feuer hat dich geführt.“
„Es war dein Rabe, oder?“ Ich blickte mich nach dem schwarzen Vogel um, der auf dem Bett saß und äußerst selbstgefällig aussah.
„Mein Rabe?“, fragte Grannus verwundert.
„Es hat nur funktioniert, weil dein Rabe irgendwie die Verbindung zum Feuer hergestellt hat, nicht wahr?“
„Das kann sein – Raben sind Boten zwischen den Welten und bewegen sich durch den dünnen Schleier von Zeit und Raum.“ Grannus schüttelte den Kopf. „Aber das ist nicht mein Rabe. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Er kam mit dir. Und er ist auch mit dir durch die Zeit gegangen.“
Der Rabe krächzte bestätigend.
Grannus erhob sich. „Schlaf jetzt. Deine Lehrzeit beginnt morgen. Alles wird sich ändern. Wie ich schon sagte: Du wirst dich neu erfinden.“ Er wandte sich ab, drehte sich dann noch einmal zu mir um. „Wie lautet dein Name?“
Ich konnte den Blick nicht von dem schwarzen Vogel abwenden, dessen schwarze Knopfaugen mir zublinzelten. Meine Hände wanderten zu dem Amulett. Ich riss es ab. Mein neues Leben hatte bereits begonnen. „Mein Name“, sagte ich, „ist Raben-Stephan.“
Die Marköbeler Region war Funden zufolge bereits in der keltischen Latènezeit besiedelt. Die Römer errichteten auf dem Gebiet Marköbels das Kastell Marköbel auf rechteckigem Grundriss von der Größe der Saalburg, durch das der Krebsbachübergang durch den Limes überwacht wurde. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Marköbel als „cavilla“ im Jahr 839.
Das Jüngste Gericht
Es war still in der Marienkirche. Nicht weiter verwunderlich, schließlich war es früh an einem Freitagvormittag, dem letzten im November. Was die beiden Gestalten, die gerade das Brautportal geöffnet hatten, vielmehr wunderte, war die Tatsache, dass ihr Atem in kleinen Wölkchen in der Luft hängen blieb – einer Luft, die genauso eisig war wie die Luft in den Straßen der Gelnhäuser Altstadt. „Bockmist! Warum ist es denn hier so verflucht kalt?“, brummte der Größere von beiden, und die Worte mochten nicht recht zu der Mönchskutte passen, die er trug. Sein schlaksiger Kumpan, ebenfalls in einer beigen Kutte, zuckte die Schultern: „Vielleicht ist die Heizung im Arsch.“
Der Erste fluchte erneut: „Oh Mann, ausgerechnet heute. Da werden die Leute ganz schön meckern.“ Der Ärger der beiden war berechtigt. In wenigen Stunden sollten Tausende von Besuchern nach Gelnhausen strömen, um die beliebte Weihnachtsführung zu besuchen. Und die Szene, die in der festlich geschmückten Marienkirche spielte, war eigentlich dazu gedacht, die Zuschauer ein wenig aufzuwärmen. Nun jedoch erreichte die Temperatur gerade einmal die mollige Wärme eines Gefrierfachs.
Fluchend holte der große Mönch ein Handy heraus. Er musste im Pfarramt Bescheid geben. Zuvor galt es jedoch, einen dringlicheren Anruf zu tätigen: Die Organisation in der Tourist-Information musste unbedingt Bescheid wissen, um auf die veränderte Situation zu reagieren. Während der Große die missliche Lage am Telefon erläuterte, ging der Schlaksige weiter in die Kirche hinein. Schweinekälte hin oder her – ihre Aufgabe war es, die Requisiten für die Nikolaus-Szene vor dem Lettner zu drapieren, der das Mittelschiff vom Chor trennte. Und damit konnte er ja schon einmal anfangen.
„Nein!“, schnauzte der große Mönch ins Mobiltelefon. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Kirche bis heute Abend wieder warm bekommen …“ Er dreht sich um und sah seinen Kollegen vor sich. Der war bleich wie ein Laken.
„Ich glaube nicht, dass wir heute hier auftreten können“, stammelte er.
„Sag ich doch die ganze Zeit.“ Der Große wollte sich wieder abwenden. Doch etwas im Blick des Anderen ließ ihn innehalten. Der Schlaksige ging einige Schritte an ihm vorbei, beugte sich vor und übergab sich geräuschvoll. Der Große sah einige Sekunden lang zu. „Bleib mal dran“, sagte er dann ins Handy, drehte sich um und ging ebenfalls in die Kirche.
Alles sah normal aus: Das Mittelschiff öffnete sich zu seiner Rechten, links sah er den beeindruckenden Lettner, auf dem das kunstvolle Relief des Jüngsten Gerichts im morgendlichen Dämmerlicht kaum zu erkennen war. Von seinem Standpunkt aus konnte der Mönch nur den Zug der Seligen sehen, an der linken Seite über die Rundbögen des Lettners eingearbeitet.
„Was hat der Trottel denn?“, brummte der Mönch und ging weiter. Plötzlich trat er in eine Pfütze. Unwillig blickte er auf den Boden: „Ist das Dach immer noch undicht?“ Doch es war kein Wasser, in das er getreten war. Die Flüssigkeit, rot und geronnen, bildete eine Lache, die sich aus einem kleinen Bächlein speiste. Das Bächlein war den Absatz zum Altar heruntergelaufen. Sein Ursprung lag vor dem Lettner, unterhalb des Zuges der Verdammten: eine Leiche.
Kommissar Felix Grumm seufzte. Fast 800 Jahre war dieses Gotteshaus alt geworden, hatte den 30-jährigen Krieg, die Reformation und zwei Weltkriege überstanden. Dass der Lettner, diese hölzerne Schranke zwischen Mittelschiff und Chor, noch existierte, war ein Wunder; schließlich waren im 16. Jahrhundert in Folge des von Luther angestoßenen Umschwungs die meisten dieser Kunstwerke zerstört worden. Da die Marienkirche zum Zeitpunkt dieses reformatorischen „Bildersturms“ aber bereits protestantisch war, war dieses Relikt aus der Zeit vor der religiösen Revolution erhalten geblieben.
Die Kirche hatte also einiges mitgemacht - doch noch nie war in diesen ehrwürdigen Mauern ein Mord geschehen. Ein äußerst kaltblütiger Mord, wenn Grumm das Opfer betrachtete. Jemand hatte mit einem stumpfen Gegenstand ihren Schädel bersten lassen. Grumm sah sich um. Vielleicht ein Kerzenständer, vermutete er. Näheres mussten die Leute der Spurensicherung herausfinden, die in ihren weißen Anzügen in der Marienkirche herumwimmelten. Eine Tatwaffe hatten sie bislang noch nicht zutage gefördert.
„Weiß man schon, wer die Tote ist?“, fragte Felix seine Kollegin Natascha Eyrich.
Sie nickte und las von ihrem Notizblock ab, in dem sie akribisch alles zu notieren pflegte, was sie an Tatorten erfuhr: „Eine Gundula Pümpfrich aus Gelnhausen. Sie war Besitzerin einer Boutique in der Altstadt, geschieden, Mitglied des Kirchenvorstands. Deswegen hatte sie wohl den Schlüssel. Gestern Abend war sie auf einem Weihnachts-Benefizkonzert in der ehemaligen Synagoge.“
Felix blickte erstaunt auf: „Das hast du aber verdammt schnell herausgefunden.“ Sie waren erst fünf Minuten am Tatort. Natascha wies mit dem Kopf zum Brautportal, das die Kollegen der Spurensicherung mittlerweile verschlossen hatten. „Der Typ, der uns alarmiert hat – nicht der, der alles vollgekotzt hat, der andere – der wusste ziemlich viel über sie. Sie scheint stadtbekannt gewesenzu sein.“