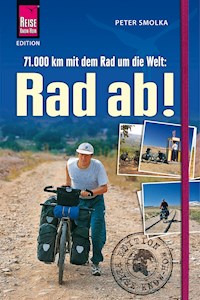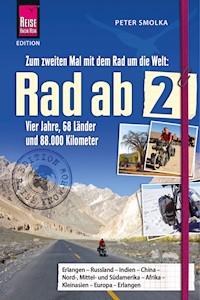
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reise Know-How Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Reise Know-How
- Sprache: Deutsch
Job gekündigt, Auto verkauft, Wohnung leergeräumt und alles, was man für viereinhalb Jahre braucht, in ein paar Packtaschen verstaut – im Frühjahr 2013 lässt der Erlanger Abenteurer Peter Smolka das bequeme Leben hinter sich, um zum zweiten Mal den Globus zu umradeln. Er startet nach Osten. Eine Reise ins Ungewisse. Bis nach Russland begleiten ihn drei Freunde aus Erlangen, jenseits von Moskau ist Smolka dann allein unterwegs. Auf langen Umwegen über Pakistan und Südindien geht es weiter nach China, wo er an der Grenze vier Wochen lang festsitzt. Ein Jahr nach dem Aufbruch steht er in Shanghai am Pazifik. Von dort bringt ihn ein Containerschiff nach Kanada. Als langsam Reisender ist Peter Smolka immer ganz nah an den Menschen und an der Natur. Er nimmt Indien intensiv mit der Nase auf, Südostasien mit dem Gaumen, genießt die Freiheit in der Weite Kanadas. Auf seinem Weg nach Südamerika kann ihn auch ein Überfall in Nicaragua nicht aufhalten. Als ihm nach 60.000 Kilometern in Argentinien allerdings das treue Fahrrad gestohlen wird, steht er kurz vor dem Abbruch der Reise. Von Rio de Janeiro wählt Peter Smolka den Seeweg nach Südafrika und nach der Durchquerung ganz Afrikas von Kapstadt bis nach Kairo kehrt er über den Bosporus nach Europa und nach Erlangen zurück – nach 88.000 geradelten Kilometern durch 68 Länder und viereinhalb Jahre später.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
IMPRESSUM
Peter Smolka
Rad ab 2
erschienen im
REISE KNOW-HOW Verlag
E-Book ISBN 978-3-89662-633-2
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
– Printed in Germany –
© Helmut Hermann
Untere Mühle, D - 71706 Markgröningen
eMail-Adresse des Verlags:[email protected]
Internet-Adresse des Verlags:www.rkh-reisefuehrer.de
Websites von Reise Know-How:
www.reise-know-how.de
www.suedafrikaperfekt.de
Gestaltung und Herstellung
Umschlagkonzept: Carsten Blind
Inhalt Grafik/DTP: Carsten Blind
Lektorat: Nadine Jung, Helmut Hermann, Carsten Blind
Karte: Carsten Blind, iStockphoto.de 579152098 / dikobraziy
Druck: mediaprint, Paderborn
Fotos: Alle Peter Smolka, sowie
Cover iStockphoto.de 475319758 / taesmileland, 165979379 / mustafahacalaki, 508910737 / Rallef und im Inhalt Tilman Schwob, Russ McCoy, S. Wolfgang Renz, Sandra Butler, Stadt Beşiktaş, Stadt Jena, Markus Friedrich
Dieses Buch ist zudem als Print-Ausgabe (ISBN 978-3-89662-526-7, 1. Auflage 2019) erhältlich in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Belgien. Bitte informieren Sie Ihren Buchhändler über folgende Bezugsadressen:
D:
PROLIT GmbH, Postfach 9, 35461 Fernwald
www.prolit.de (sowie alle Barsortimente),
CH:
AVA-Verlagsauslieferung AG, Postfach 27, 8910 Affoltern, www.ava.ch
A:
Mohr Morawa Buchvertrieb GmbH, Postfach 260, 1011 Wien
NL, B:
Willems Adventure, www.willemsadventure.nl
Wer im Buchhandel trotzdem kein Glück hat, bekommt
unsere Bücher auch über unsere Büchershops im Internet (s.o.)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Endlich geht’s los
Russland
Zeitsprung
Steppe
Abgewiesen
Durchgelassen
Reich!
Usbekistan zählt
Die Reise des Reisepasses
High Way – Karakorum
Kailasa – alles nur ein Stein
Ingenieure in Hängematten?
NH5 – Flug nach Kalkutta
Mitgefangen
Die Krone von Thailand
Reifer Reifen
Der lange Freitag
Pfefferspray
Downhill
Green Lake
Hall of Fame
Green Card
Der fliegende Cowboy
Route 66
Viel Wind
Fahr’n, fahr’n, fahr’n …
Sicher? Ist der Tod
Zehn Gramm
Die Lücke
Das Paradies vor Panama
Rückkehr der FARC
Zona Roja
In Ecua-dor kein Äqua-tor…
Wüste ohne Himmel
Der Weiße Planet
6,8 auf der Richterskala
Festgefahren im Paradies
Blauer Dollar
Rad weg!
Mit dem Laster zur Küste
Nach Afrika!
Unsere Antwort? Waffen!
Im Krüger-Park
Endlich mal ein Strafzettel
Fahrrad-Safari
Give me!
Karibu!
Einfädeln ins Nadelöhr
Der strauchelnde Strauß
Das geliebte Land
Zu Gast bei den Schurken
V. I. P.
Alles anders
Friends de Tour
Zurück in Deutschland
Überraschung!
Hochzeit
Endspurt
Epilog
Tipps für die Reise
Dank!
Prolog
Ein halbes Jahr nach der Rückkehr von meiner ersten Weltumradlung hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei meinem früheren Arbeitgeber. Uwe, mein ehemaliger Chef, stellte gleich zu Beginn zwei kritische Fragen: „Wie lange willst du eigentlich bei uns bleiben? Wann haust du denn wieder ab?“
Seine Bedenken waren durchaus berechtigt. Er kannte ja meinen Lebenslauf, und der zeigte ihm deutlich, dass meine Ausdauer am Schreibtisch begrenzt ist. Und außerdem ist das Thema Energieübertragung, der Schwerpunkt unserer Arbeit, eine komplexe Sache – die Anstellung eines Software-Entwicklers für nur zwei Jahre hätte der Firma nicht viel gebracht.
Mein Reisefieber hatte sich nach 71.000 Kilometern im Sattel erst einmal gelegt, das Fernweh war gezügelt. Ich versprach Uwe, sechs bis sieben Jahre zu bleiben. So lange hatte ich es auch schon zwischen den beiden letzten großen Touren im Büro ausgehalten. Der Chef drei weitere Hierarchiestufen höher kommentierte prompt: „Länger wollen wir dich auch gar nicht haben.“ Der hat seinen ganz eigenen Humor.
Wie zu erwarten war, nahm das Fernweh im Laufeder Jahre wieder zu. In Gedanken radelte ich durch Weltecken, die ich auf den bisherigen Reisen noch nicht gesehen hatte: durch Russland, durch Zentralasien, durch Nord- und Mittelamerika. Auf der Russlandkarte fiel mir Wladimir auf, 190 Kilometer östlich von Moskau gelegen und eine Partnerstadt meiner Heimatstadt Erlangen. Bald kam die Idee auf, nicht nur Wladimir zu besuchen, sondern alle Erlanger Partnerstädte. Die meisten von ihnen verteilen sich auf Europa. Die exotischste Partnerstadt aber, San Carlos, liegt in Nicaragua. Somit war bald klar, dass die nächste große Reise eine zweite Weltumradlung werden würde.
Die Pläne wurden allmählich konkreter. Eine grobe Route um den Globus entstand, bei der auch die Jahreszeiten berücksichtigt waren: Indien im Winter, Kanada im Sommer, südliches Südamerika im Südsommer, Sahara im Winter. Ungefähr 80.000 Fahrradkilometer bei einer Reisedauer von gut vier Jahren. Unser Erlanger Oberbürgermeister Siegfried Balleis fand meine Absicht, alle Partnerstädte rund um die Welt zu besuchen, gut und bereitete Grußschreiben an seine Kollegen dort in der Ferne vor. Das Unternehmen bekam nun den Titel Tour de Friends.
Als Startdatum wählte ich den Gründonnerstag 2013. Ohnehin musste ich einigermaßen früh im Jahr aufbrechen, um rechtzeitig vor dem Winter die Südseite des Himalaya erreichen zu können. Die Osterfeiertage boten sich auch deswegen an, weil es dann vielen Freunden und Bekannten möglich war, ohne weitere Umstände die ersten Etappen mitzuradeln. Einige wollten für den ersten Tag mit dabei sein, viele über das Osterwochenende durch Tschechien bis nach Zittau mitfahren, drei bis ins Baltikum, und drei Radler wollten mich sogar bis zur ersten Partnerstadt begleiten – bis nach Wladimir.
Die Monate vor dem Aufbruch waren mit Abmelden, Ummelden, Verkaufen und Kündigen ausgefüllt. Abnabeln von Deutschland. All die Sicherheit, die ich mir in den vergangenen sieben Jahren aufgebaut hatte, wieder aufzugeben, fiel mir nicht gerade leicht. Mein Arbeitsvertrag war unbefristet (trotz meiner klar geäußerten Absicht, nur eine begrenzte Zeit zu bleiben), mit 52 Jahren war ich im Software-Geschäft ein alter Mann. In dieser Situation sollte man sich eigentlich besser am Arbeitgeber festsaugen wie eine Zecke. Aber irgendwie war mir die bevorstehende Reise, die größte meines Lebens, dann doch wichtiger.
Ich verkaufte das Auto, kündigte die Wohnung, ließ mich gegen allerlei schlimme Krankheiten impfen, ergänzte die Ausrüstung. Bei der Wahl des Fahrrades entschied ich mich erstmals gegen 28- Zoll, wählte stattdessen 26er-Felgen. Wenn auch größere, schmale Reifen leichter rollen, so hat doch ein 26-Zoll-Fahrrad zwei maßgebliche Vorteile: Es ist insgesamt stabiler, und 26-Zoll-Reifen sind weltweit besser verfügbar.
Zum Schluss räumte ich die Wohnung leer. Noch so eine destruktive Sache, die für Unwohlsein sorgte. In diesen letzten Wochen und Tagen vor dem Aufbruch hatte ich ständig ein flaues Gefühl in der Magengegend. „Die Welt dreht sich weiter“, ging es mir immer wieder durch den Kopf, „und du springst einfach so ab.“
Als dann aber alles erledigt war und die gepackten Taschen am Fahrrad hingen, war ich erleichtert. Endlich konnte es losgehen. Die Sicherheit war jetzt zwar weg – aber die Freiheit war da.
Vergrößerte Kartenansicht auf der Internetseite des Verlags (hier klicken)
Endlich geht’s los!
Um 5.30 Uhr morgens klingelt das Telefon. Wie zwei Tage zuvor verabredet, meldet sich der Bayerische Rundfunk für ein Interview. Sieben Uhr wäre mir lieber gewesen, aber das passte denen in München nicht in den Zeitplan. „Wegen der Zypernkrise“, hieß es mysteriös. Bis um drei Uhr habe ich die leergeräumte Wohnung noch geputzt, dann etwa zwei Stunden geschlafen. Der Moderator fragt nach meinen Plänen und wie ich mich fühle. Tja, wie fühlt man sich, wenn man alle Zelte hinter sich abbricht? Zweifel sind da, ob die Entscheidung richtig war. Es kribbelt im ganzen Körper.
Dies ist ein Abschied für lange Zeit – von Deutschland, von meiner Familie, von den Freunden. Für mindestens vier Jahre. Denn eines habe ich mir ganz fest vorgenommen: Es wird keine „Heimaturlaube“ geben, keine Rückflüge zwischendurch. Ich will um den Erdball radeln. Und wenn ich, zum Beispiel, gerade durch Thailand fahre, dann werde ich danach in Laos sein. Oder in Kambodscha. Aber doch nicht in Deutschland! Was wäre das für eine eigenartige Weltumradlung, wenn man sie in Etappen machen würde? Körperlich in der weiten Welt unterwegs, aber mit den Gedanken ständig zu Hause.
Versuchen möchte ich außerdem, generell auf Flüge zu verzichten, also auch zwischen den Kontinenten. Weil ein Flug ein Bruch im Reisetempo ist. Ob das in unserer modernen, regulierten Welt noch gelingen kann, ist allerdings fraglich.
Kurz nach acht Uhr kommt Wolfgang, einer der Mitfahrer für die ersten Tage, aus der Nachbarschaft vorbei. Gemeinsam radeln wir zum Rathaus, wo nach und nach die anderen 19 Mitfahrer eintreffen. Außerdem sind viele Freunde da, um „ade“ zu sagen. Da Oberbürgermeister Balleis im Osterurlaub ist, übergibt mir Bürgermeisterin Elisabeth Preuß die Grußschreiben an die Partnerstädte.
Gegen 9.30 Uhr brechen wir am Rathaus auf. Alle fahren mit Handschuhen. Für Ende März ist es zu kalt, die Temperatur liegt knapp über null Grad. Doch ab und zu kämpft sich die Sonne durch den Hochnebel, wir sind guter Dinge. Noch wissen wir nicht, dass sich dieser Winter zu einem Jahrhundertwinter entwickeln wird.
Drei Radler werden bis nach Wladimir mitfahren: Walter (2. v. l.), Gertrud und Jörg (2. v. r.) (Foto: Tilman Schwob)
Für die ersten vier Tage haben wir – wegen der Größe der Gruppe – feste Etappen von jeweils rund 100 Kilometern geplant. Vor allem auch, damit jeder schon vorab Unterkunft nach seinem Geschmack organisieren konnte. Am ersten Abend machen wir auf dem Weg zur tschechischen Grenze beim rustikalen Gasthaus Herrenwald in Speichersdorf Station. Die meisten Mitradler richten ihr Schlaflager in einem Nebenraum der Gaststube ein, einige bauen zusammen mit mir ihre Zelte hinter dem Gebäude auf. Der Abend in der Gaststube wird lang, da ich noch auf meinen Bruder Max warte, der aus Frankfurt anreist und erst morgen aufs Rad steigen kann. Trotz der kurzen letzten Nächte bin ich nicht müde, sondern eher aufgedreht.
Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt schaue, glaube ich für einige Momente, dass wir gar nicht weiterfahren können. Zumindest nicht in dieser großen Gruppe. Über Nacht ist der Winter zurückgekommen – eine dicke Schneedecke liegt über der Wiese, die Fahrräder sind zugeschneit. Ich stapfe die 200 Meter zur Straße vor und kann aufatmen: Auf der Fahrbahn ist die Schneedecke nicht geschlossen.
In der ersten Nacht der Reise ist der Winter zurückgekommen
Wir frühstücken im Gasthaus und verabschieden uns dann von denen, die heute zurück nach Erlangen fahren. Unsere Gruppe zählt nun noch 14 Radler, weiter geht es Richtung Osten. Und genau von dort kommt der kalte Wind. Er bremst uns auf dem Weg durch Tschechien, wir mühen uns, ab und zu schneit es wieder.
Drei Tage später geht am Ostermontag in Zittau die Reise für den Großteil der Mitfahrer zu Ende. Mit der Bahn kehren sie nach Nürnberg zurück. Jetzt sind wir noch zu siebt unterwegs. Das Wetter verschlechtert sich weiter, schneidender Ostwind kühlt uns selbst bei kurzen Pausen aus. Die Stunden im Sattel sind ein einziger Kampf. Ich freue mich über jedes Dorf, weil der Wind durch die Bebauung gebremst wird, fürchte das Ortsende, wo er gleich hinter dem letzten Haus hervorspringen wird, um uns wieder zu ärgern.
Wir suchen Wege durch Wälder, denn auch dort hat der Wind weniger Kraft. Doch in den Wäldern liegt oft hoher Schnee, durch den wir nur schlingernd vorwärtskommen oder die Fahrräder gleich freiwillig schieben. Auf Feldwegen wühlen wir uns mitunter durch tiefen Schlamm.
Die Bedingungen sind wirklich rau. Nach und nach streichen die drei Radler, die bis ins Baltikum mitradeln wollten, die Segel. Als letzter gibt Edgar auf, der eigentlich vorhatte, uns drei Wochen bis zur russischen Grenze zu begleiten. Schon nach einer Woche sind wir im Westen Polens nur noch zu viert: Jörg, Walter, Gertrud und ich.
Jörg war der erste, der als Mitfahrer zusagte. Vor etwas mehr als einem Jahr schaute ich in seinem Fahrradladen Freilauf vorbei, um zu fragen, ob unter seinen Kunden wohl jemand ist, der an einer Tour bis zur Partnerstadt Wladimir teilnehmen würde. Jörg war gerade in der Mittagspause, aber seine Angestellten meinten, sie wüssten schon jemanden: den Chef selbst nämlich. Als Jörg von der Pause zurückkam, empfingen ihn die Worte: „Weißt du schon, was du nächstes Jahr zu Ostern machst? – Du radelst nach Russland!“ Jörg wehrte sich nicht.
Walter ist ein weiterer langjähriger Freund, der immer schon gern in der Natur unterwegs ist. Er reist oft mit dem Fahrrad oder mit dem Faltboot, manchmal schleppt er das Boot auch hinter dem Fahrrad her und wechselt während der Tour zwischen Fluss und Straße. Seine humorvollen Filmvorführungen über diese Reisen haben ihn über die Region hinaus bekannt gemacht.
Gertrud war eine der letzten, die sich dem Tourstart anschlossen. Sie kam nach meinem Abschiedsvortrag über die erste Weltumradlung zur Bühne. Ich kannte Gertrud nicht, aber zumindest ihre sportlichen Erfolge qualifizierten sie als Mitfahrerin: Sie war gerade erst in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin im Wintertriathlon geworden.
Auf dem Weg durch Polen kämpfen wir weiter gegen das Wetter und auch gegen Tristesse. Die Dörfer sind grau, der Himmel ist grau, der bissige Wind bleibt grausam, auch wenn die Temperaturen inzwischen wieder knapp über dem Gefrierpunkt liegen. Rechts und links der Straßen liegt Schnee, der tagsüber den Boden durchweicht. Wir übernachten öfter in festen Unterkünften, als ursprünglich geplant war. Die Masurischen Seen im Nordosten Polens sind noch vollständig zugefroren. Als wir beim nahen Campingplatz Seeblick anrufen, um zu fragen, ob er schon offen ist, antwortet der Besitzer Marian auf Deutsch: „Kommen Sie besser in drei oder vier Wochen.” – Nein, nein, wir sind doch schon fast da! – Er überlässt uns günstige Zimmer zum Vorzugspreis. Ein paar Gläser Tee und Wodka gehen aufs Haus. Wie schon so oft zuvor hören wir jetzt auch von Marian: „Der Winter zieht sich dieses Jahr einen Monat zu lang hin.“
Auf den Nebenwegen liegt zu viel Schnee. Wir müssen wieder zurück auf die Hauptstraße.
In den baltischen Staaten wird alles etwas angenehmer. Der Wind dreht auf südliche Richtungen, schiebt uns nun an und bringt außerdem weniger kalte Luft mit. Manchmal kommt die Sonne heraus, die wir auf ruhigen Nebenstraßen genießen können. Auf den Feldern stolzieren immer wieder Störche durch den Schnee, die sich vermutlich ärgern, dass sie dieses Jahr zu früh aus Afrika zurückgekehrt sind. Die Häuser, viele aus Holz, sind hier bunter als die in Tschechien und Polen – das Baltikum erinnert eher an Skandinavien. In Kaunas, Riga und Tallinn gönnen wir uns jeweils einen Tag Pause, da wir gut im Zeitplan liegen. Gedankenlos können wir mit unserer Zeit nicht umgehen, denn Gertrud, Walter und Jörg haben ihren Rückflug aus Moskau bereits gebucht.
Russland
Die Einreise nach Russland ist der erste „echte“ Grenzübertritt, nachdem wir bisher ja nur in EU-Ländern unterwegs waren, ohne jegliche Kontrollen an den Grenzen. Doch auch hier kommen wir problemlos und schnell durch, denn die Offiziellen geben sich gelassen.
Nach zwei Tagen in St. Petersburg führt die weitere Route nach Osten und um den Rybinsksee herum. Den Großraum Moskau zu meiden, hatten wir schon bei unserer Planung zu Hause beschlossen. Und nach den aufreibenden 45 Kilometern durch St. Petersburg mit dem unglaublich dichten Verkehr und den vielen rücksichtslosen Motorisierten wissen wir, dass diese Entscheidung gut war. Gertrud wurde in der Stadt von einem Auto gestreift.
Da nun der Boden nicht mehr überall aufgeweicht ist, zelten wir meistens irgendwo abseits der Straße. Vor allem die Nächte sind aber weiterhin kalt. Nahe dem Ort Sazonovo sinkt das Thermometer in der Nacht zum 29. April auf minus acht Grad.
Unser erster Frühlingstag ist der 2. Mai, als es tagsüber ungewohnte zehn Grad warm wird. An diesem Nachmittag erreichen wir Jaroslawl, eine der ältesten Städte in Zentralrussland. Wir stellen die Zelte auf dem idyllischen Campingplatz eines Rudervereins am linken Ufer der Wolga auf. Von hier haben wir über den Fluss hinweg einen Blick auf die Altstadt, als würden wir in Theaterstühlen sitzen. Die feine Skyline wird von den Zwiebeltürmen der russischorthodoxen Mariä-Entschlafens-Kathedrale dominiert. An unserem zweiten Abend in Jaroslawl geht mit dem Sonnenuntergang der Himmel über der Wolga in Flammen auf.
Zwei Tagesetappen bringen uns nach Wladimir. Nachdem wir am Ortseingangsschild ein Erinnerungsfoto gemacht haben, fahren wir direkt zum Erlangen-Haus, das in russisch-deutscher Zusammenarbeit aufgebaut und 1995 eröffnet wurde. Es wird jetzt gern als „Botschaftsgebäude der Wladimir-Erlangen-Partnerschaft“ oder kurz als „Erlanger Botschaft“ bezeichnet. Die Leiterin des Hauses, Irina Chasowa, erwartet uns schon. Peter Steger aus dem Erlanger Rathaus hat uns angekündigt, er wird auch in den kommenden Jahren meine Partnerstadt-Besuche koordinieren.
Morgens an der Wolga bei Jaroslawl
Noch am selben Nachmittag gibt es ein Treffen mit dem Oberbürgermeister von Wladimir. Es entwickelt sich ein angeregtes Gespräch mit Sergej Sacharow, wobei es vor allem um unsere Reise geht, aber auch um die Zukunft des Fahrrades als Verkehrsmittel in Wladimir allgemein. Die sieht so rosig nicht aus. Zunächst will man den Autoverkehr mit Ringstraßen aus der Stadt herauslocken, dann erst sei an Radwege zu denken. Aber für die Ringstraßen ist kein Geld da. Dem Radler in Wladimir wird es noch einige Jahre so gehen wie den Radlern in den anderen russischen Städten: Er wird sich seinen Freiraum irgendwo zwischen den starken Motorisierten und den schwächeren Fußgängern suchen müssen.
Von unserer Reise ist der Herr Sacharow derart begeistert, dass er spontan für den folgenden Tag eine gemeinsame Radtour durch die Stadt organisiert. Für 18 Uhr, mitten durch den Feierabendverkehr. Der Oberbürgermeister fährt an der Spitze, zwei weitere Radler aus Wladimir sind mit dabei. Wir fahren zweireihig, den Rücken hält uns ein Offizieller in seinem Auto mit Warnblinklicht frei.
Der Abschied von meinen Erlanger Begleitern steht nun unmittelbar bevor. Den Stress, die 190 Kilometer auf der stark befahrenen M7 von Wladimir nach Moskau zu radeln, will sich keiner von uns antun. Walter, Jörg und Gertrud werden einen Shuttle-Bus nehmen. So bleiben ihnen vor ihrem Heimflug auch noch eineinhalb Tage für die Besichtigung der russischen Hauptstadt. Ich will ganz auf Moskau verzichten und direkt nach Osten in Richtung Kasachstan durchstarten.
Sergej Sacharow ist es, der mich dazu bringt, die Reiseroute zu ändern. Eine Stadt wie Moskau dürfe man doch nicht auslassen, sagt er – lächelnd, aber doch mit Ernst –, als er von meinen weiteren Plänen erfährt. Und gerade jetzt, an dem verlängerten Wochenende um die Feierlichkeiten zum 9. Mai*), sei die Stadt relativ leer, weil alle zu ihren Datschen aufs Land hinausgefahren seien.
Moskau – zweifellos eine ganz besondere Stadt. Wann werde ich wieder die Gelegenheit haben, sie zu besuchen? Ich folge schließlich Sacharows Rat und setze die Reise in die falsche Richtung fort, Richtung Westen. Und ich fahre nicht allein. Denn Anton vom VeloTourklub Veles hat, etwas schüchtern, gefragt, ob er mich mit dem Rad in die Hauptstadt begleiten darf. Oder vielleicht auch noch ein paar Tage länger über Moskau hinaus. – Na klar! Sehr gern. Willkommen bei der Tour de Friends!
Anton hat uns an den vergangenen zwei Tagen in Wladimir begleitet, uns zu den Sehenswürdigkeiten geführt und viel über sein Land erzählt. Er ist ein ruhiger und bescheidener Mensch, 26 Jahre jung. Kennengelernt haben wir uns bereits vor einem Jahr in Erlangen, als er mit vier Tourklub-Kollegen nach Deutschland geflogen ist, um von Erlangen aus zu einer Radtour durch Bayern, Tschechien und Österreich zu starten. Am ersten Tag fuhr ich mit ihnen bis zum Monte Kaolino in Hirschau.
Damals fiel mir auf, dass die Truppe offenbar ein ganz anderes Verkehrsaufkommen gewöhnt ist als wir in Deutschland. Wenn ich versuchte, die B14 zu meiden und den Schleifen der ausgeschilderten Fahrradroute zu folgen, schauten sie mich verwundert an: „Warum dauernd diese Umwege? Die B14 ist doch gut genug als Radweg.”
Oh ja! Jetzt – hier in Russland – erkenne ich es auch: Unsere B14 ist eigentlich ein Radweg!
Anton und ich starten nach Moskau. Wir schmeißen uns auf die vierspurige M7. Bezeichnenderweise sind selbst die unerschrockenen Radler vom VeloTourklub diese Strecke noch nie gefahren. „Gibt es denn keine Ausweichroute, Anton?“ – „Nein, wir können nur auf der M7 fahren.“
Der Verkehr ist wie ein reißender Fluss. Ein Auto dicht nach dem anderen rast an uns vorbei, es gibt keine Pausen, der Strom ist unaufhörlich – als würden sie alle in einem riesengroßen Kreis fahren.
„Obst und Gemüse von Niederrhein“ überholt uns. So steht es auf einem der Lastwagen. Auch die Spedition Altmeyer ist unterwegs. Und gleich mehrere LKW der bankrotten Firma Pfleiderer aus der Oberpfalz fahren Richtung Hauptstadt. Alle natürlich mit russischen Kennzeichen. Die Lastwagen aus Deutschland sind beliebt und werden gar nicht erst umetikettiert.
Mit Anton auf dem Weg nach Moskau
60 Kilometer vor dem Moskauer Zentrum und nur noch zehn Kilometer vom Stadtrand entfernt finden wir an einem Fluss einen geeigneten Platz zum Zelten. Ein kleines Wäldchen bietet Sichtschutz gegen das nahe Dorf, zu schaffen machen uns allerdings Wolken kleiner schwarzer, aufdringlicher Fliegen. Das war wirklich ein Vorteil der Kälte auf dem bisherigen Weg: Es gab keine Belästigung durch Insekten.
Bevor wir uns am nächsten Tag mit den Erlanger Freunden an der Basilius-Kathedrale treffen, machen wir eine ausgedehnte Besichtigungstour durch Moskau. Insgesamt sind wir 110 Kilometer mit den Rädern in der Stadt unterwegs, oft auch auf Gehsteigen, wie das in Russlands Großstädten üblich ist. Die Fußgänger regen sich nicht darüber auf, lassen sich sogar beiseiteklingeln. Dafür werde ich von einem Polizisten gestoppt, weil ich eine achtspurige Straße nicht auf dem Zebrastreifen überquere. Meine russische Erklärung „Ich verstehe nicht“ tut der Polizist mit einem „Ja, ja …“ ab – bis Anton zu Hilfe eilt und ihm versichert, dass er wirklich einen Ausländer vor sich hat.
Unser Übernachtungsproblem im sündhaft teuren Moskau löst sich, als wir am Roten Platz die Erlanger Freunde treffen. Um schon möglichst nahe am Domodedovo-Flughafen zu sein, hatten sie ihre Zelte auf dem Campingplatz des Rus-Hotels im Süden Moskaus aufstellen wollen. Aber mit „Campingplatz“ ist nur der bewachte Parkplatz des Hotels gemeint, auf dem man sein Wohnmobil parken darf. Für wirkliches Camping fehlt jegliche Infrastruktur. In den Doppelzimmern, die sie daraufhin nehmen mussten, ist noch ein Bett frei.
Das zweite Bett findet sich bei Antons Bruder, ebenfalls im Moskauer Süden. Anton hatte seinen Bruder eigentlich nicht behelligen wollen, weil er recht beengt wohnt. Trotz guten Einkommens kann er sich zusammen mit seiner Freundin nicht mehr als eine Einzimmerwohnung leisten. Die nämlich kostet schon fast 1000 Euro Miete im Monat. Moskau gilt als eine der teuersten Städte der Welt. Forbes will herausgefunden haben, dass es nirgendwo so viele Milliardäre gibt wie in dieser Metropole.
Am nächsten Morgen endet, was vor über sechs Wochen am Rathaus in Erlangen begann: die lange Reise mit Jörg, Walter und Gertrud nach Russland. Wir verabschieden uns vordem Hotel. Von Domodedovo werden sie sich in die Luft erheben und nur zwei Stunden später wieder deutschen Boden unter den Füßen haben.
Vom Süden Moskaus aus in die Spur nach Südosten zu kommen, ist gar nicht so einfach. Man ist umgeben von Autobahnen, ring- und sternförmig verlaufend, die nur an wenigen Stellen überquert werden können. Also beschließen Anton und ich, direkt auf dem äußeren Autobahnring zu fahren. Er ist ausdrücklich für Radfahrer verboten, hat aber sechs Spuren in jeder Richtung. Da sollte doch für Radler wenigstens eine Spur frei sein.
Rückenwind treibt uns voran, dazu kommen die Druckwellen, die die Lastwagen vor sich herschieben. Die fahren unverschämterweise auch auf unserer Radspur. Und sie fahren nicht, sie fliegen geradezu! Unwillkürlich ducken wir uns zum Schutze, so wie ein kleines Kind die Augen schließt, um nicht gesehen zu werden. Nach zwölf Kilometern ist der Stress vorbei. Wir biegen ab und sind jetzt nur noch auf doppelspuriger Straße unterwegs.
Rund 400 Kilometer radeln wir hinter Moskau gemeinsam. Im Städtchen Shazk verabschiedet sich schließlich auch Anton von mir. Er nimmt von hier aus den direkten Weg zurück nach Wladimir. Zwei Tage später ist er wieder zu Hause. Dort angekommen, findet er eine überraschende Nachricht vor, die sein Leben verändern soll – und uns noch ein unerwartetes Wiedersehen bescheren wird.
*) Tag des Sieges über das Deutsche Reich
Zeitsprung
Jedes Jahr zur Umstellung auf die Sommerzeit – und danach wieder beim Zurückstellen der Uhren – gibt es die einschlägigen Berichte in den deutschen Medien: Der Zeitsprung um eine ganze Stunde fügt uns gesundheitliche Schäden zu!
Kann man also eine Reise von Samara nach Ufa, ganz im Osten des europäischen Russlands, überleben? 150 Kilometer vor Ufa nämlich wird man urplötzlich um zwei Stunden nach vorn katapultiert.
Bis 2010 hatte Russland noch elf Zeitzonen, die dann aber aus wirtschaftlichen und administrativen Gründen auf neun reduziert wurden. Seitdem fehlt die Zeitzone UTC+5, in der Samara bis dahin lag. Jetzt hat man dort die gleiche Uhrzeit wie im 1000 Kilometer weiter westlich liegenden Moskau. Dadurch geht in Samara die Sonne im Sommer gegen vier Uhr auf, aber schon um 21 Uhr unter. Das führt auch dazu, dass die Menschen zum Teil schon um fünf Uhr auf den Beinen sind. Nach dem Zeitsprung kurz vor Ufa ist nun wieder alles normal, und die Abende sind angenehm lang.
Mit Ufa erreiche ich die Hauptstadt der autonomen Republik Bashkortostan. Die Bashkiren sind ein muslimisches Turkvolk aus dem Gebiet der heutigen Mongolei. In ihrer autonomen Republik stellen sie allerdings nur ein Drittel der Bevölkerung, die Mehrheit sind Russen und Tataren.
Die Hauptstadt hat gut eine Million Einwohner und ist eingezwängt zwischen den Flüssen Belaya und Ufa. Die Stadt zieht sich über 30 Kilometer in die Länge. Hier bin ich bei Nuriya angemeldet, einem Mitglied der weltweiten Warm-Showers-Gemeinde. Das Prinzip dieses Verbundes ist das gleiche wie beim bekannteren Couch Surfing: Jedes Mitglied bietet bei sich zu Hause einen oder mehrere Übernachtungsplätze an. Wer gerade selbst auf Reisen ist, darf im Gegenzug bei anderen Mitgliedern um Unterkunft bitten. Für mich ist es das erste Mal, dass ich Warm Showers als Gast nutze.
In den gleichförmigen Betonblocks einer russischen Großstadt eine bestimmte Wohnung ausfindig zu machen, ist für den Neuling eine Herausforderung. Wenn man den Wohnblock gefunden hat, sucht man weiter nach dem richtigen Blockabschnitt, was wegen verwitterter Markierungen bedeuten kann, dass man sich durchfragen muss. Schließlich steht man unten am Eingang wie vor einem Panzerschrank, vor einer glaslosen Tür aus schweren Metallplatten. Namensschilder gibt es nicht, auch keine einzige Klingel. Dafür aber neben der Tür ein Tastaturfeld, ähnlich dem eines öffentlichen Telefons. Man gibt die Nummer des Appartements ein und – auch das muss man erst einmal wissen – drückt dann noch das „B“.
Nuriyas Stimme klingt aus dem Lautsprecher, kurz danach ertönt der Summton des Türöffners. Im dritten Stock stehe ich noch einmal vor einer Tresortür. Dahinter verbirgt sich Nuriyas Einzimmerwohnung. Ihr Fahrrad, das im engen Flur geparkt ist, wandert auf den Balkon, meines steht jetzt im Flur. Mischa, ihr Sohn, schiebt seine Spielsachen zusammen, um Platz für meine Packtaschen zu schaffen.
Im Zimmer lehnt ein großer Rucksack an der Wand. Er gehört dem Russen Alexandre, der sich über Couch Surfing bei Nuriya gemeldet hat und gerade einen Stadtrundgang macht. Abends sitzen wir zusammen und plaudern. Solange Nuriya dabei ist, sprechen wir Englisch. Mit Alexandre allein kann ich mich auf Deutsch unterhalten. Er wohnt seit 18 Jahren in Berlin und arbeitet als freier Journalist, unter anderem für GEO. Eines seiner aktuellen Projekte – auf mehrere Jahre ausgedehnt – ist der Besuch aller autonomen Republiken der Ex-Sowjetunion. Insgesamt 20 solche Republiken gibt es zwischen dem Kaukasus und der Beringstraße.
Nuriya hat Medizin studiert, arbeitet aber seit der Trennung von ihrem Mann ebenfalls als Journalistin. Ihr Themenschwerpunkt ist die Öl- und Gasindustrie. Damit verdiene sie doppelt soviel wie als Ärztin, sagt sie; nur so könne sie den Lebensunterhalt und die Wohnung überhaupt bezahlen.
Mischa schläft in dieser Nacht auf der Matratze neben Nuriya, Alexandre auf dem Sofa, ich ziehe mich mit meiner Schlafmatte in die winzige Küche zurück.
Auf dem weiteren Weg nach Osten wird es bergig, und damit wird auch die Landschaft abwechslungsreicher. Um Moskau herum war sie völlig flach mit endlos weiten Wiesen und Feldern. Mit der Annäherung an die Wolga bei Samara wurde es hügelig, aber der Ausblick blieb weit, solange keine Wälder die Sicht begrenzten. Das Uralgebirge mit seinen ersten Ausläufern zwingt nun die Straße in Kurven und gelegentlich auch zu Serpentinen. Ein erfrischendes Auf und Ab, viel Wald, große Seen, tiefgrüne Täler – Erinnerungen an den Schwarzwald kommen auf.
Dass der Ural als Grenze zwischen Europa und Asien gilt, ist keine willkürliche Festlegung. Das Gebirge entstand vor rund 300 Millionen Jahren durch das Ineinanderschieben zweier Urkontinente. Hier, im südlichen Teil der Gebirgskette, sind die Berggipfel bis zu 1600 Meter hoch. Die Straße nach Chelyabinsk erreicht an der höchsten Stelle gut 800 Meter.
Chelyabinsk ist eine triste Industriestadt und wie Ufa etwas über eine Million Einwohner groß. Noch einmal mache ich mich zwischen monotonen Betonblöcken auf die Suche nach einem Warm-Showers-Mitglied, auf die Suche nach Anton Wahl. Da die angegebenen GPS-Daten einen Kilometer von seinem tatsächlichen Standort abweichen, brauche ich eine halbe Stunde länger als verabredet, bis ich vor seiner Panzertür stehe.
Wie sein Nachname vermuten lässt, hat Anton deutsche Vorfahren. Sein 93 Jahre alter Großvater lebte nach dem Krieg mehrere Jahrzehnte als Deutscher in Russland, wo er eine Russin heiratete. Inzwischen ist er nach Frankfurt zurückgekehrt. Ein Teil der Familie, so erzählt Anton, ist dorthin nachgezogen. Er hat aber praktisch keinen Kontakt zu diesem Zweig der Verwandtschaft. Er wird seinen Großvater auch nicht besuchen, wenn er demnächst für zwei Monate durch Mittel- und Nordeuropa radelt.
Als vor vier Monaten ein großer Meteorit über Russland niederging und die westeuropäischen Medien ausführlich darüber berichteten, war das für mich „irgendwo in Russland“. Irgendwo in diesem unfassbar großen Land, in das Deutschland fast 50-mal hineinpasst. Heute erfahre ich, dass der Meteorit quasi über Antons Kopf hinweg geflogen ist.
Er hatte in seiner Wohnung gerade mit dem Rücken zum Fenster gestanden, als plötzlich die Blitze kamen, drei hintereinander. Danach hat er aus dem Fenster geschaut, um zu sehen, was denn dort vor sich geht. Glücklicherweise hat er nicht zu lange am Fenster gestanden. Denn zwei Minuten später kam mit dem Donner auch die Druckwelle, die Abertausende von Scheiben in der Region Chelyabinsk hat bersten lassen. Schnittwunden waren die häufigsten Verletzungen, die der Meteorit verursacht hat. 1500 Menschen mussten ärztlich behandelt werden.
Das Städtchen Sim im Ural. Die Gasleitungen verlaufen oberirdisch.
Die meisten Einzelteile des explodierten Meteoriten fielen in den Chebarkul-See 80 Kilometer westlich von Chelyabinsk. Aus der Größe des Loches in der Eisdecke und nach Auswertung vieler weiterer Daten schlossen Wissenschaftler auf die Dimensionen des Meteoriten vor der Explosion: Er hatte vermutlich einen Durchmesser von 20 Metern und ein Gewicht von 10.000 Tonnen. Ein paar Gramm davon hat Anton gefunden, ein Gramm hat er mir geschenkt – ein schwarzes außerirdisches Kügelchen.
Der letzte Ort in Russland, das Städtchen Troitsk, ist wesentlich entspannter, als ich es erwartet hatte. Grenzorte haben oft eine unangenehme Atmosphäre mit Kleinkriminellen und finsteren Charakteren, die dunkle Geschäfte mit dir machen wollen. Aber hier, in Troitsk, spürt man überhaupt nicht, dass ein Grenzübergang bevorsteht. Es gibt auch keine Ansammlung von Lastwagen, kein hektisches Treiben von fliegenden Händlern. Troitsk ist eine ganz normale russische Kleinstadt.
Der blonde Russe am Schalter des Grenzpostens spricht kein Englisch, doch er lässt mich kurz aufhorchen, als er sagt: „Visum kaputt“. Er spricht eigentlich auch kein Deutsch, aber das Wort „kaputt“ kennt jeder in Russland. Normalerweise allerdings im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals war nämlich „CHitler kaputt“.
Mein Visum ist ungültig? Kann nicht sein! Es stellt sich heraus, dass „Visum kaputt“ keine Feststellung war, sondern eine Frage: Soll ich Sie wirklich ausstempeln? Sie können dann nicht mehr zurück. – Ja, ich weiß, so sind die Regeln.
Die Beamten auf der kasachischen Seite haben alle eine sehr asiatische Erscheinung: runde, flache Gesichter mit schmalen Augen, schwarzes Haar. Es ist, als wäre ich innerhalb von fünf Minuten von Hamburg in die Mongolei geradelt.
In Kostanay, der ersten Stadt 200 Kilometer nach der Einreise, bekomme ich bei der Migrationspolizei nur eine vorläufige Registrierung (wie in Russland muss man sich auch in Kasachstan in den ersten Tagen behördlich melden). Die endgültige Registrierung müsse ich in der Hauptstadt machen, erklären mir zwei freundliche Damen.
Also eile ich weiter ins 700 Kilometer entfernte Astana. Dort wundern sie sich im Migrationsamt, was ich denn bei ihnen will – man habe mich doch in Kostanay schon registriert. Hoffentlich gibt’s da nicht noch eine weitere Auslegung der Gesetze, wenn ich in ein paar Wochen aus Kasachstan ausreisen will.
Steppe
Wenn man die Landkarte auf der Lenkertasche 3000 Kilometer lang nicht wenden muss, dann ist entweder die Lenkertasche so groß wie ein Schreibtisch oder die Landkarte hat einen eher kleinen Maßstab.
Meine Lenkertasche hat Normalgröße, ungefähr die eines Schuhkartons. Ungewöhnlich ist die Landkarte. Eine Radwanderkarte sieht jedenfalls anders aus. Seit sechs Wochen fahre ich nun schon mit einem 1:10.000.000-Maßstab durch die Landschaft, ein Zentimeter auf dem Papier entspricht 100 Kilometern in der Natur.
Deutschland würde bei diesem Maßstab auf eine Zigarettenschachtel passen. Aber ich bin froh, dass der Verlag auf die Rückseite seiner großen Russlandkarte wenigstens diese grobe Übersicht über Kasachstan gedruckt hat. Sonst stünde ich jetzt ganz ohne Landkarte da. Die Suche nach Anschlussblättern ist in den letzten Wochen erfolglos geblieben. Weder Buchläden (das sind hier in der Gegend ohnehin nur bessere Schreibwarengeschäfte) noch Tankstellen hatten etwas im Angebot.
In der Steppe Kasachstans kommt man allerdings selbst mit diesem Minimaßstab ganz gut zurecht. Das Land ist so weiträumig, dass selbst kleinste Orte in der 1:10.000.000-Karte eingetragen sind, so etwa Kalshengel, ein Dörfchen mit 60 Einwohnern im Südosten des Landes.
Die beiden Mobilfunkmasten des Ortes zeichnen sich schon aus 20 Kilometern Entfernung in der platten Landschaft vor dem blauen Himmel ab. Dann, langsam, werden Gebäude erkennbar. Der Ort erscheint zunächst groß, es gibt sogar einen zweistöckigen Komplex. Eine Fabrik?
Ich meine, nur noch 500 Meter vor mir zu haben, als es tatsächlich noch drei Kilometer sind. Mit der weiteren Annäherung wird das Dorf überraschenderweise wieder kleiner. Jetzt lösen sich nämlich die Gebäude voneinander, man kann sie abzählen. Links der Straße liegt, zwischen mehreren Baumgruppen, die eigentliche Siedlung mit den Häusern der Viehzüchter. Allein die Bäume sind in der weiten, heißen Steppe schon eine Wohltat für die Seele. Auf der rechten Seite der Straße reiht sich ein quaderförmiges Kafe an das andere. Etwa zehn dieser Imbissstuben gibt es hier, vor jedem Eingang steht ein Grill, auf dem Schaschlik zubereitet wird. Kalshengel ist für den Reisenden, der aus Norden kommt, die erste Versorgungsstation nach 100 Kilometern. Bis zur nächsten sind es 80 Kilometer: Kurty – natürlich auch auf meiner Landkarte vermerkt, acht Millimeter weiter im Südosten.
Es ist 17 Uhr und immer noch 30 Grad warm. Zwei Dörfer habe ich heute schon gesehen, 150 Kilometer in den Beinen. Noch einmal 80 Kilometer – bis nach Kurty – schaffe ich nicht, auch wenn die Leute hier meinen, dass es doch nicht mehr weit sei.
Monotonie in der kasachischen Steppe
Gaukhar Jeljubaeva bedient im Kafe von Marinovka
Es ist witzig: Auf der einen Seite bewundern sie den Radler, der sich diese ungeheure Weite antut. Sie bremsen ihr Auto ab von 120 auf Null und bleiben mitten auf der Straße stehen, um zu fragen, woher ich denn komme, wohin ich denn will. Sie sagen: „Unglaublich!“ Sie wollen sich immer wieder mit mir fotografieren lassen – das passiert so oft, dass diese photo shootings mich manchmal aus dem Fahrrhythmus bringen. Sie beschenken mich mit Obst, reichen mir aus dem fahrenden Auto heraus Getränke. In den Ortschaften muss ich mitunter kleinere Einkäufe nicht bezahlen, mehrmals auch nicht meine Rechnung in den Kafes. Sie sind herzenswarm, und ihre Gastfreundschaft gehört zur kasachischen Kultur.
Auf der anderen Seite überschätzen sie aber die Geschwindigkeit, mit der sich ein Radfahrer bewegt, völlig. Drei junge Burschen aus Karaganda, die ihr Auto 300 Kilometer vor Balkhash stoppten und mir Obst in die Hand drückten, meinten, wir könnten uns ja in Balkhash wiedersehen. „Klar“, sagte ich, „in zwei Tagen bin ich auch dort.“ Sie wunderten sich: „Ach so. Da sind wir schon wieder zurück in Karaganda.“ – Vielleicht ist diese Fehleinschätzung auch der Grund dafür, dass erst zweimal Autofahrer anhielten, um mir eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Angebote übrigens, die durchaus verlockend sind, wenn sich der halbfrontale Wind wieder einmal zu Sturmstärke gesteigert hat. Besonders gefährlich sind die heftigen Böen, die mich manchmal bis auf die Gegenfahrbahn drücken.
Der zweistöckige Komplex steht am Ende von Kalshengel und ist keine Fabrik, sondern eine Bauruine. Ein völlig unpassender Klotz, der einmal als Hotel geplant war. Direkt vor dem zerfallenden Gebäude hat, ein wenig unromantisch, Uydal seine Jurte aufgebaut. Er betreibt das letzte Kafe vor dem Ortsausgang.
Ich stelle mein Zelt neben der großen Ruine auf und geselle mich dann zu Uydal. Außen an der Jurte hängt ein Stromzähler. Das ist gut, denn das bedeutet, dass es kaltes Bier gibt. Dazu grillt er mir zwei saftige Schaschlikspieße, die er mit Fladenbrot serviert.
Die Luft ist klar, die Sonne versinkt langsam und in kräftigen Farben. Die Wolken türmen sich auch heute wieder hoch hinauf in den kasachischen Himmel, sie sind lila, gelb und orange. Wir sitzen vor der Jurte und schauen auf die Straße, auf die M36 – in den Fernseher von Kalshengel. Auch in den Abendstunden bewegt sich da alle Minute mal etwas. Uydal erklärt mir jedes Modell, das über unseren Bildschirm huscht. „Das ist ein Toyota FJ Cruiser.“ – „Da, ein Mercedes GLK“. Und dann kommt noch ein simpler VW Golf vorbei. Uydal ist, wie so viele Kasachen, begeistert von mashinas. Er fragt, wie viel in Deutschland ein Maybach kostet. Ich habe nur eine ungefähre Ahnung, werfe „200.000 Euro“ in den Raum. Später lese ich nach, dass es eher zwei- bis dreimal so viel ist. Auf jeden Fall muss man dafür eine Menge Schaschlikspieße verkaufen.
Uydal möchte auch wissen, ob Russland denn nicht gefährlich gewesen sei.
Russland gefährlich? Warum? Nein, war es nicht. Oder … Moment … jedenfalls nicht in dem Sinne, wie du es wahrscheinlich meinst. Keine spürbare Kriminalität, nicht die Gefahr, beraubt zu werden. Gefährlich allerdings war der Straßenverkehr, und der war teilweise extrem gefährlich. Außerdem sollte man zusehen, dass man am Wochenende den Betrunkenen aus dem Wege geht. Aber das ist in Kasachstan ja nicht anders.
Und Skinheads? Keine Gefahr durch Skinheads?
Nein, mir sind keine begegnet, auch damit wurde ich nicht konfrontiert. Tatsächlich aber ist übertriebener Nationalismus offenbar ein zunehmendes Problem in Russland. Und die Aggression zielt vor allem auf die Bewohner des Kaukasus und die der zentralasiatischen Nachbarn. Also eben auch auf Uydal.
Die Sonne ist inzwischen hinter dem Horizont verschwunden. Uydal hat neue Kundschaft, ich ziehe mich in mein Zelt zurück. Da es hier keine Mücken gibt, kann ich die Eingänge offen lassen und ins Weltall schauen. Der Himmel wird dunkler, der Sternenteppich immer dichter. Einige Sternschnuppen ziehen kurze Bahnen durch die Nacht.
Während Kalshengel von artesischen Brunnen lebt, bezieht Kurty sein Wasser aus dem gleichnamigen Fluss, der sich wie ein Fremdling durch die dürre Steppe zieht. Der Kurty fließt in den Ili-Fluss und speist damit den Balkhash-See, an dessen Ufer ich zwei Tage lang entlanggefahren bin. Er ist inzwischen der größte See Zentralasiens, nachdem der Aralsee auf ein Fünftel seiner ursprünglichen Größe geschrumpft ist. Der Balkhash-See hat etwa die Fläche Sloweniens, ist aber an der tiefsten Stelle gerade einmal 26 Meter tief. Auch er ist von der Austrocknung bedroht, weil an seinen Zuflüssen zu viel Wasser für die Landwirtschaft entnommen wird.
Südlich von Kurty verändert sich das Landschaftsbild rasch. Erst sind es Büsche, dann Bäume, die plötzlich wieder allgegenwärtig sind. Zugleich zeichnet sich am Horizont eine langgezogene Bergkette ab – die nördlichen Ausläufer des Tian-Schan-Gebirges. Auf den bis zu 5000 Meter hohen Gipfeln liegt Schnee. Nach über vier Wochen in der schier endlosen Steppe wirken die Berge wie eine Wand.
In Almaty, am Fuße der Bergkette, quartiere ich mich in einem alten Sowjethotel ein. Nicht nur der Putz bröckelt hier, vieles ist marode, eigentlich alles. Aber das Wasser läuft und Strom fließt. Und günstiger kann man in Almaty kaum unterkommen. Außerdem ist das Personal durchaus freundlich.
Besonders flink ist ein einschlägiger Dienstleistungssektor: Nach einer Stunde ruft eine singende weibliche Stimme auf dem Zimmertelefon an: „Sex Lady …?“ – In Kostanay, kurz nach der Einreise aus Russland, war es ein „Sex Girl“, das seine Dienste anbot, nur eine halbe Stunde, nachdem ich eingezogen war. Irgendwie scheinen die Damen ihre Informationen über neue Gäste von den an sich seriös wirkenden Hotels zu bekommen.
Almaty war bis 1997 die Hauptstadt Kasachstans, verlor diesen Status aber an das im Norden gelegene Astana. Staatsoberhaupt Nazarbaev, inzwischen seit über 20 Jahren im Amt, gab als Gründe für die Verlegung des Regierungssitzes die dezentrale und zudem erdbebengefährdete Lage Almatys an. Außerdem sei Almaty zu eng geworden. Es wird aber auch vermutet, dass Nazarbaev separatistischen Bestrebungen der russischen Bevölkerung vorbeugen wollte, die den Norden dominiert.
Der Präsidentenpalast in Astana
Seitdem wächst die neue Hauptstadt unaufhörlich, Astana wird gern mit Dubai verglichen. Bedeutende internationale Architekturbüros, zum Beispiel Foster + Partners, haben hier ihre Visitenkarten abgegeben, mit extravaganten und futuristischen Gebäuden wie Khan Shatyr (ein schiefes, 150 Meter hohes halbdurchsichtiges Zelt), der Pyramide und dem Bayterek-Turm, der mich sehr an einen Fußball-Pokal erinnerte.
Ihren heutigen Namen trägt die Stadt erst seit 1998. Davor lebten die etwa 300.000 Einwohner in Akmola, dem „weißen Grab“. Vor langer Zeit sollen hier in der winterlichen Steppe bei einem gewaltigen Schneesturm zwei komplette Karawanen lebendig begraben worden sein. Um diese Erinnerung abzuschütteln, hat man die neue Metropole einfach in „Hauptstadt“ umbenannt: Astana.
In den letzten 15 Jahren ist die Einwohnerzahl auf 700.000 gestiegen, aber die Stadt befindet sich noch immer in der Aufbauphase. Bis 2030 soll sie sich vor allem nach Süden ausdehnen und dann mehr als eine Million Bewohner zählen.
Wie das weitläufige Astana ist auch Almaty entspannt und frei von Hektik, selbst wenn Präsident Nazarbaev vorgibt, der Platz reiche in Almaty nicht mehr aus. Als gewachsene Stadt und mit den Hausbergen im Süden bietet sie ungleich mehr Lebensqualität als die sterile Hauptstadt. Man kann sich die langen Gesichter all der vielen Diplomaten gut vorstellen, als sie aus heiterem Himmel erfuhren, dass sie in das staubige Astana umziehen müssen.
Ich werde die gute Infrastruktur nutzen, um in Almaty den bevorstehenden Reiseabschnitt bis nach Indien vorzubereiten. Bald wird sich herausstellen, dass es „visumtechnisch“ einer der schwierigsten Abschnitte der gesamten Reise sein wird.
Abgewiesen
Issyk-Köl, der große See im Osten Kirgistans, ist von Almaty keine 70 Kilometer entfernt. Auf der Luftlinie. Da aber hohe Bergketten dazwischen liegen, sind es auf der Straße bis nach Cholpon Ata am Nordufer des Sees 450 Kilometer – gleich, ob man das Gebirge westlich oder östlich umfährt.
Der östliche Bogen wurde mir als ruhiger und landschaftlich sehr reizvoll beschrieben. Es gibt hier, im Hochtal des Karkara-Flusses, einen winzigen Grenzübergang zwischen Kasachstan und Kirgistan, der von April bis Oktober geöffnet ist. Allerdings gehen Gerüchte um, dass die Grenze dort wegen Unruhen vor einigen Tagen geschlossen wurde. Als ich auf dem Weg durch Almaty an einem Tourist Office vorbeikomme, erkundige ich mich nach der Lage. Die Dame hinter dem Schreibtisch ist jedoch ständig abgelenkt durch ihren Computer, und so entwickelt sich ein etwas merkwürdiges Gespräch:
„Ich möchte gern durch das Karkara-Tal nach Kirgistan ausreisen – ist die Grenze offen?“
„Ja, das geht. Am besten fliegen Sie.“
„Äh, danke. Und auf dem Landweg? Durch das Karkara-Tal? Ist die Grenze offen?“
„Ach so, das geht auch. Es fahren täglich mehrere Busse direkt nach Bishkek.“
„Danke. Ich möchte allerdings nicht nach Bishkek fahren, sondern nach Osten und durch das Karkara-Tal nach Kirgistan ausreisen. Ist die Grenze dort offen?“
„Ja, klar, die Grenze ist offen.“
Die Antwort gefiel mir natürlich. Aber einer Glaskugel hätte ich genauso viel Vertrauen geschenkt.
Östlich von Almaty verläuft auf etwa 100 Kilometern Länge der Almaty-Kanal – parallel zu den Bergketten und quer zu den Flüssen, die dort oben entspringen. Er ermöglicht die Bewässerung auch der flussfernen Landstriche. Der Kanal wird von einer kleinen Straße begleitet, auf der nur alle Viertelstunde mal ein Auto vorbeikommt. Hier fährt es sich wie auf einem europäischen Radwanderweg.
Als ich zurück auf der Hauptstraße bin, überholt mich ein Bus mit chinesischem Kennzeichen. Mir wird plötzlich bewusst, wie nah China schon ist: Der Bus wird in zwei Stunden in seiner Heimat sein. Für mich ist China allerdings noch weit weg, denn neben Kirgistan möchte ich mir auch noch Usbekistan und Tadschikistan anschauen.
Hinter Shilik wird es bergig, die Straße steigt an und führt zum Charyn-Canyon, der recht spektakulär sein soll. Ich kann es nicht beurteilen, denn ausgerechnet hier brechen die Wolken auseinander. Ein furchterregendes Gewitter setzt ein, das alles verhüllt. Den Canyon erkenne ich daran, dass es bergab und gleich nach der Flussüberquerung wieder bergauf geht.
Mit dem Städtchen Kegen erreiche ich das Hochtal der Flüsse Kegen und Karkara, die hier zusammentreffen. Nun ist die Grenze nur noch knapp 30 Kilometer entfernt. Längst bin ich zuversichtlich, dass sie tatsächlich offen ist, denn in beiden Richtungen sind auch kirgisische Autos unterwegs.
Um acht Uhr morgens breche ich in Kegen auf. Starker Wind bläst mir ins Gesicht, die Straße steigt immer noch leicht an, hinter dem Dorf Karkara geht sie in eine Piste über. Links windet sich der Karkara-Fluss durch saftige Wiesen, auf denen Pferde und Schafe grasen, vereinzelte Jurten stehen im Tal. Dahinter erheben sich schneebedeckte Berge.
Moslemischer Friedhof bei Karkara
Die Grenzstation ist schon aus etlichen Kilometern Entfernung auf der langen Pistengeraden zu erkennen. Nur langsam arbeite ich mich voran, der Wind hat nicht nachgelassen. Für die 28 Kilometer von Kegen bis zur Grenze brauche ich drei Stunden.
Zuerst muss ich zum Zoll. Der Zöllner sitzt in einer kleinen Baracke und fragt etwas muffelig, was ich in den Taschen habe. Das kann ich auf Russisch gar nicht ausdrücken, nur palatka (Zelt) fällt mir ein. Er scheint aber keine Lust zu haben aufzustehen, um selbst einen Blick in die Taschen zu werfen. Seine Pflicht erfüllt er dadurch, dass er sich den Inhalt der Lenkertasche, die ich in der Hand halte, genau zeigen lässt.
Am Schalter für die Passkontrolle wird eine Kamera auf mich ausgerichtet. Offenbar zeichnen sie hier alles auf. Der Mann macht einen freundlicheren Eindruck. Aber er stutzt, als er auf die Migrationskarte im Pass schaut: Registrierungen nur für Juni? Wo ist denn die für den Juli?
Wie bitte? Eine Registrierung für jeden Monat? Das ist ja jetzt schon wieder eine neue Interpretation eurer Regeln! Da holt mich dieses Registrierungsproblem also doch noch ein. Es scheint keine klaren Bestimmungen zu geben, zumindest sind sie nicht allgemein bekannt. In Kostanay im Norden sagte man mir kurz nach der Einreise, ich müsse mich in Astana noch einmal registrieren. Dort meinten sie aber, es sei nicht nötig. Trotzdem gaben sie mir den Stempel. Und hier an der Grenze reichen nun gar die zwei Registrierungen nicht?
Nein, sagt der Uniformierte, die für den Juli fehlt. Die muss mir die Immigrationspolizei in Kegen geben.
Ich soll zurück nach Kegen? Ich bin mit dem Fahrrad da!
Der Mann zuckt mit den Schultern. Da könne er nichts machen, er sei Soldat. Immigration sei Polizeiangelegenheit.
Aber eine Registrierung muss doch reichen, man muss sich doch nicht jeden Monat melden.
Doch, muss man. Und er könne mich nicht einfach durchlassen, sagt er. „Mein Boss sperrt mich ein, wenn er diese Migrationskarte sieht.“
Es ist nichts zu machen, da hilft kein enttäuschtes Gesicht – ich muss zurück.
Wind und Wut treiben mich auf dem Rückweg an. Nach weniger als eineinhalb Stunden bin ich wieder in Kegen. Hoffentlich kommt die Polizei hier nicht zu dem Schluss, dass ich schwerwiegend gegen die Meldepflicht verstoßen habe. Sonst bekomme ich sogar noch einen kostenlosen Transfer zurück nach Almaty.
Durchgelassen
Ein kleiner Appell vorab:
Liebe Innenminister Russlands, Kasachstans
und all der anderen Ex-Sowjet-Staaten!
Denkt doch bitte mal über den Sinn Eurer Registrierungspflicht nach! Braucht Ihr die wirklich noch? Man kann sich doch längst frei bei Euch bewegen. Die Meldepflicht ist nicht nur für den Reisenden lästig, sie führt auch bei Euch zu unnötiger Bürokratie. Sie ist ein Relikt aus alten Sowjet-Zeiten – Ihr habt nur vergessen, sie abzuschaffen. Schafft sie jetzt ab, am besten noch heute!
Auf der Polizeistation in Kegen wird wieder offensichtlich, dass es bei der Registrierung in Kasachstan keine einheitliche Regelung gibt: Die Beamten wollen mir den Stempel nicht geben. Er sei nicht nötig, ich sei doch schon registriert. – Ja, das meine ich ja auch! Aber ohne die Registrierung aus Kegen lassen sie mich an der Grenze nicht ausreisen.
Etwas widerwillig drückt einer der Uniformierten schließlich den Stempel auf die Migrationskarte. Jetzt habe ich drei solche Registrierungen, und eine hätte eigentlich reichen müssen.
Es ist inzwischen 16 Uhr. Da die Grenze um 18 Uhr schließt, übernachte ich noch einmal in Kegen. Der nächste Morgen ist windstill, diesmal schaffe ich es in zwei Stunden bis zu dem einsamen Grenzposten. Der Soldat vom Vortag begrüßt mich freundlich. Wieder richtet er die Videokamera am Schalter auf mich aus.
„Und? Haben Sie jetzt die Registrierung?“ – „Ja, habe ich.“ – Er schaut sich die Papiere genau an; diesmal ist auch aus seiner Sicht alles in Ordnung.
Man hat viel Zeit in diesem abgelegenen Hochtal. Keine fünf Fahrzeuge überqueren pro Stunde die Grenze. Drei Tage am Stück schiebt die Mannschaft ihren Dienst, bis sie von Kollegen abgelöst wird. Der Mann am Einreiseschalter möchte noch ein bisschen über Deutschland plaudern. „Michael Ballack“ fällt ihm ein.
„Ja, der ist aus Deutschland. Allerdings ist er als Fußballspieler nicht mehr aktiv.“
Der Soldat macht eine Bewegung wie jemand, der etwas an den Nagel hängt.
„Genau. Aber finanzielle Sorgen hat er bestimmt nicht, er sollte eigentlich ausgesorgt haben.“
„Ist er Millionär?“
„Klar, all die bekannten Fußballspieler sind Millionäre.“
„Die fahren also alle einen Rolls-Royce?“
„Nee, eher Porsche oder schnelle BMWs oder so was.“
Jenseits der Grenze fällt dem kirgisischen Zöllner zu Deutschland wieder nur „Hitler“ ein. Wie schon so vielen anderen, die fragten, woher ich denn käme. An ihren Reflex habe ich mich längst gewöhnt. Ebenso an ihr Lächeln, wenn sie den Namen aussprechen. Sie glauben wohl wirklich, dem deutschen Gast damit zu gefallen.
Die Landkarte auf der Lenkertasche zieht alle in ihren Bann
Aus dem Weideland des Karkara-Tales führt die Piste über einen flachen Pass in das Tal des Tup-Flusses, das hier, im oberen Verlauf, noch sehr eng ist. Die Berghänge sind steil und mit hohen Nadelbäumen bewachsen. Der Tup mündet schließlich in den Issyk-Köl, den größten See Kirgistans. 180 Kilometer lang, bis zu 60 Kilometer breit und 1600 Meter über dem Meer gelegen, gilt er als „zweitgrößter alpiner See der Erde“ – der größte ist unumstritten der Titicacasee im Andenhochland. Vor allem das Nordufer des Issyk-Köl ist touristisch erschlossen, im Hauptort Cholpon Ata liegt auch die luxuriöse Yacht des kirgisischen Präsidenten.
Kirgistan ist ein vielbesuchtes Land, was nicht zuletzt daran liegt, dass es für viele Nationalitäten inzwischen visumfrei ist. Zwei Monate lang habe ich im Süden Russlands und in Kasachstan keinen einzigen Touristen gesehen, als ersten dann in Almaty Thorsten aus Hamburg. Er ist von der Mongolei aus mit dem Fahrrad nach Westen gestartet und über China nach Kasachstan eingereist.
In Kirgistan sind nun Begegnungen mit Reiseradlern an der Tagesordnung. Sophie und Ingo kamen mir kurz nach der Einreise entgegen; wir standen über eine Stunde lang auf der Schotterpiste und quatschten. In den kommenden Tagen treffe ich viele, viele andere Reisende aus Europa. Das Gespräch ein paar Tage später mit zwei finnischen Radlerinnen, die für ein paar Wochen nach Kirgistan geflogen sind, dauert nur noch fünf Minuten – weiter in der Landesmitte winkt man sich bei Begegnungen auf der Straße oft nur noch zu.
Thorsten treffe ich in der Unterkunft in Bishkek wieder, ohne dass wir verabredet sind. Das Nomad’s Home ist der Treffpunkt für Radfahrer und Rucksackreisende in der kirgisischen Hauptstadt; man übernachtet im Schlafsaal, in einer Jurte oder baut im Garten das eigene Zelt auf. Der Innenhof ist voller Reiseräder von Kurz- und Langzeitradlern. Es wird geschraubt und gebastelt, jeder nutzt die gute Infrastruktur und bessert die kleinen und großen Schäden am Fahrrad aus.
Wieder einmal ein bequemer und angenehmer Ort, an dem ich länger bleibe als geplant. Nach einer Woche ziehe ich weiter – Richtung Usbekistan.
Der Toktogul-See in Kirgistan
Reich!
„Wir sind nicht reich“, sagt Tulkun Khodjaev, der Vater von Sardor, als ich in den Hof seines Hauses eintrete. Als müsste ersich auch noch dafür entschuldigen, dass sein Sohn mich von der Straße weg zu seiner Familie eingeladen hat. Was meint er wohl mit „nicht reich“? Befürchtet er, dass ein Europäer mit den einfachen sanitären Einrichtungen Probleme haben könnte?
Vor einer Stunde erst bin ich nach Usbekistan eingereist und nun im Städtchen Uchkurgan angekommen. Eigentlich war mein Tagesziel das 40 Kilometer entfernte Namangan, aber auf der Suche nach dem Grenzübergang war ich zum alten Grenzposten gefahren. Ein paar Hundert Meter von Uchkurgan entfernt stand ich vor einem tiefen, breiten Graben, über den einmal eine Brücke führte. Ein Kirgise kam aus seinem Haus heraus und bestätigte es:
„Ja, das da drüben ist Usbekistan.“ – „Aber der neue Grenzübergang liegt 20 Kilometer von hier entfernt.“
Auf der usbekischen Seite hatte sich unterdessen ein Soldat im Tarnanzug und mit umgehängtem Gewehr aus der sandfarbenen Umgebung herausgelöst. Er stand uns jetzt gegenüber – wir hätten ihm beinahe die Hand reichen können. Wir sprachen mit ihm, und es war keine Überraschung, dass er mich nicht einlud, einfach zu ihm herüberzukommen. Auch den Kirgisen hätte er nicht eingeladen. So etwas wie „Kleinen Grenzverkehr“ gibt es hier nicht – die beiden Nachbarn sind sich nicht grün. Im Zweifelsfall wird schnell geschossen. Vor zwei Wochen erst gab es zwei Tote bei einem Grenzkonflikt. – Wann immer ich erzählte, dass ich nach Usbekistan fahre, rümpfte man in Kirgistan die Nase.
Auf dem Weg zurück zur Fernstraße fuhr ich irgendwo auf der schmalen, buckligen Asphaltpiste den 10.000sten Kilometer dieser Reise. Erstaunlicherweise ist es mir gelungen, bis hierher auch wirklich jeden Meter aus eigener Kraft zurückzulegen. Auf früheren Reisen gab es immer irgendein Hindernis nach ein paar Tausend Kilometern, zum Beispiel 1988 die Straße von Gibraltar auf dem Weg nach Westafrika oder die Bosporusbrücke, über die mich die türkische Polizei 1985 nicht radeln ließ. 2001 konnte ich die Polizisten austricksen und jene Brücke radelnd meistern, aber dann waren es visumtechnische Gründe, die mich nach 5000 Kilometern zwangen, Israel vom jordanischen Aqaba aus mit der Fähre zu umgehen.
Während dieser Reise hatte ich mich nach neuneinhalbtausend Kilometern schon damit abgefunden, dass die Serie ununterbrochenen Radelns ein Ende haben würde. Auf dem Weg von Bishkek nach Usbekistan markiert die Nelles-Landkarte in den kirgisischen Bergen einen Tunnel in 2550 Metern Höhe. Wegen Erstickungsgefahr sei er für Fußgänger und Radfahrer gesperrt, hatte ich mehrmals gehört. Man werde mit dem Rad auf einen Laster zwangsverladen. Da der Tunnel tatsächlich aber 3100 Meter hoch liegt, musste ich am Tag des Aufstiegs nicht 1900, sondern mehr als 2400 Höhenmeter absolvieren, kam erst am späten Nachmittag oben an und beschloss, noch vor dem Tunnel das Zelt aufzubauen.
Bis zum nächsten Morgen hatte sich eine Lastwagenschlange von mehreren Hundert Metern vor dem Tunnel gebildet. Noch bevor die Laster einfahren durften, mogelte ich mich an ihnen und den Wächtern vorbei und konnte so auch diese knapp drei Kilometer durch den Tunnel mit dem Fahrrad zurücklegen.
Der neue Grenzposten liegt direkt hinter einem kleinen, unscheinbaren Abzweig von der Hauptstraße, bis zum letzten Moment verdeckt durch Büsche und Bäume am Straßenrand. Er besteht nur aus einigen Bauwagen. Drei Männer sitzen im Schatten und spielen Karten. Alles macht eher den Eindruck, als sei ich auf einen Waldarbeitertrupp gestoßen. Sie könnten noch heute Abend hier alles zusammenpacken und abziehen – morgen schon würde niemand mehr erahnen, dass es hier einen Übergang zwischen den beiden Ländern gab. Der nächste Grenzübergang liegt 200 Kilometer entfernt.
Bei den Kirgisen ist nach fünf Minuten alles erledigt. Sie wünschen mir viel Glück in Usbekistan. Nach einem Kilometer Niemandsland stehe ich mitten in den Feldern vor einem großen, verschlossenen hellblauen Tor. Rechts und links davon hohe weiße Mauern. Das Tor öffnet sich, eine Hand streckt sich grüßend entgegen – sie gehört einem Kollegen des bewaffneten Usbeken am alten Grenzübergang.
Die Einreiseprozedur dauert eine Stunde, aber die Beamten sind überaus korrekt und sehr gut ausgebildet. Neben Russisch sprechen sie als zweite Fremdsprache bestes Englisch. Während mein Reisepass in den Hinterzimmern unterwegs ist, fragt mich die Zöllnerin zu den Lebensumständen in Deutschland aus.
Welche Berufsgruppen gut, welche weniger gut bezahlt sind, möchte sie wissen. Und wie es denn mit Zollbeamten aussieht. Sie ist empört, dass sie in Deutschland weniger verdienen würde als eine Lehrerin, schließlich habe doch auch sie einen Hochschulabschluss. – Ach so, daher auch das exzellente Englisch. Ich korrigiere mich und zahle ihr nun ein Lehrergehalt. – Natürlich will sie jetzt konkrete Zahlen hören: Wie viele Dollar wären denn das im Monat? – Da das Preisniveau Europas und das Zentralasiens so unterschiedlich ist, drittele ich besser die Wahrheit. Sonst will sie mich garantiert sofort heiraten. Außerdem gebe ich ihr noch eine Lektion „Lebenshaltungskosten in Deutschland“, die ihre Schockwirkung nicht verfehlt.
Ach ja, und dann habe sie ja aus dem Fernsehen erfahren, dass es in Deutschland einen nationalen Bierfeiertag gibt. – Oh! Ich bin überrascht! Der ist dann erst in den letzten Monaten eingeführt worden. Bei meiner Abreise gab es diesen Feiertag noch nicht.
Der Pass kommt zurück, jetzt folgt die Kontrolle meines Gepäcks. Der Kollege meiner wissensdurstigen Gesprächspartnerin bittet höflich, aber bestimmt um Verständnis dafür, dass er sich in meinen Packtaschen umsehen muss. Er schaut sich etwa die Hälfte an und lässt mich dann wieder frei – durch das westliche hellblaue Tor darf ich hinaus nach Usbekistan.
Als Sardor mich kurz vor Einbruch der Dunkelheit zusammen mit Freunden in Uchkurgan anhält und zu seiner Familie einlädt, lehne ich zunächst ab. Manchmal sind solche Einladungen höfliche Gesten, die nicht unbedingt ernstgemeint sind. Aber Sardor bleibt hartnäckig.
Das Dreigenerationenhaus umgibt ebenerdig mit vielen Zimmern einen Hof und einen großen Garten, in dem Obst und Gemüse wachsen. Einige der Zimmer sind von Sardor, seiner Frau und dem einjährigen Sohn bewohnt. Im Hof kann ich zum Trocknen das Zelt aufbauen, das in der letzten Nacht einen Gewitterguss abbekommen hat. Übernachten solle ich aber in einem der Zimmer, ermahnt mich Mukhsin, einer von Sardors Freunden. Das dürfe ich nicht ablehnen. Ebenso wenig natürlich das angebotene Abendessen. Als das Zelt steht, kommt die Mutter mit einer Wasserkanne, Seife, einer Schale und einem Handtuch herbei, damit ich mir die Hände waschen kann.
Mit verschränkten Beinen hocken wir Männer dann auf Sitzkissen vor einem flachen Tisch. Der Boden des Raumes ist vollständig mit Teppichen ausgelegt, weitere Möbel gibt es nicht. Auf dem Tisch sind Maiskolben, Tomaten, Obst und Mandeln aus dem Garten verteilt, dazu gibt es Fladenbrot, außerdem süßes Konfekt aus Russland. Die Mutter bringt Tee, in dem wir riesige beigefarbene Zuckerkristalle versenken.
Von Maiskolben, Brot und Obst bin ich bereits satt, da erscheint die Mutter wieder im Zimmer. Jetzt erst kommt die Hauptmahlzeit: Plov, ein Riesenhügel Reis mit Fleischstückchen und Hammelfett, außerdem steht noch eine Schale mit Reissuppe vor mir. „Iss, iss!“ befiehlt Tulkun, der Hausherr. Ein bisschen geht noch, aber dann kapituliere ich.
Dass das Fett vom Hammel ist, verstehe ich übrigens nur, weil der Vater doch tatsächlich ein altes Russisch-Deutsch-Wörterbuch ausgekramt hat. Er möchte es mir sogar schenken, aber es übersetzt für mich in der falschen Richtung. Darüber bin ich froh, denn ich hätte dieses Geschenk nicht auch noch annehmen wollen – er ist einfach viel zu großzügig.
Der Kardiologe Tulkun Khodjaev
Tulkun ist Kardiologe, er schwärmt vom berühmten Christiaan Barnard. Tulkuns Hobbys sind Weltraumfahrt und Geographie. Er hat die ganze Weltkarte im Kopf und scheint jeden Kosmonauten beim Namen zu kennen, so auch die Deutschen Sigmund Jähn und Ulf Merbold.
Die aufmerksamen Gastgeber erkennen, dass ich langsam müde werde. Erfreulicherweise kann ich doch im Zelt schlafen, ohne sie zu beleidigen. Das ist mir sehr recht, denn auch abends um elf Uhr ist es noch 30 Grad warm. Im Zelt lasse ich beide Eingänge offen, so dass ein wenig Luft durchziehen kann.
Als ich am Morgen aus dem Zelt krabbele, steht die Mutter gleich wieder mit Seife, Wasserkanne und Handtuch für eine Katzenwäsche bereit. Natürlich lassen sie mich nicht ohne ein Frühstück losziehen. Und weil sie gesehen haben, dass meine Landkarte veraltet ist, zeichnet Tulkun noch schnell eine aktuellere mit der Route bis Tashkent auf ein leeres Blatt Papier.
Zum Abschied kommen sie alle hinaus auf die Straße: Sardor, seine Frau und der kleine Sohn, Sardors Mutter und der Vater stehen vor dem Haus und winken mir fröhlich nach.
Was meinte Tulkun nur mit: „Wir sind nicht reich“?
Diese tiefgreifende Herzlichkeit! Wenn sie nicht reich sind – wer ist es dann?
Usbekistan zählt
Geldtransporter sind in Kasachstan und in Kirgistan beige Autos mit einem grünen Streifen, vom Format eines VW Caddy. Auch in Usbekistan sind die Geldtransporter beige mit einem grünen Streifen – aber es sind ausgewachsene Lastwagen.
Kein Wunder, denn die größte usbekische Geldnote, der 1000-Sum-Schein, hat einen Wert von gerade einmal 28 Euro-Cent. Folglich sind nicht nur die Geldtransporter groß, sondern auch die Geldbündel, die man bei sich trägt.