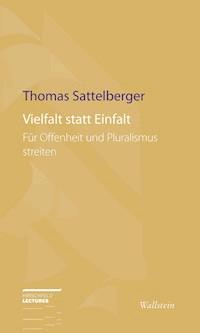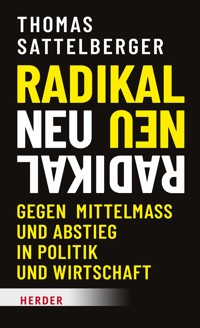
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Thomas Sattelbergers zentrales Thema als Topmanager, Spitzenpolitiker und Privatmensch ist immer gleich geblieben: Wie lassen sich Menschen, Unternehmen, Institutionen und Gesellschaften dazu befähigen, ihr Potential bestmöglich zu entfalten? Die zentrale Voraussetzung dafür ist aus seiner Sicht eine Kultur der permanenten Veränderung, die Bereitschaft auch zu radikaler Erneuerung. Und genau die fehlt uns heute in einer Zeit, die von radikalem Wandel geprägt ist wie keine andere in den letzten Jahrzehnten. Machen wir weiter wie bisher, ist weiterer Abstieg unvermeidlich – politisch, ökonomisch, gesellschaftlich. Persönliches Mittelmaß können wir uns nicht mehr leisten. Thomas Sattelberger teilt mit kritischem Insiderblick auf die aktuellen Entwicklungen in Politik,Gesellschaft und Wirtschaft seinen riesigen Erfahrungsschatz zum Thema Transformation, auch die der eigenen, persönlichen. Und er entwirft das positive Zukunftsbild einer unternehmerischen Innovationsgesellschaft, die uns allen, insbesondere auch unseren Führungspersönlichkeiten, viel Neues abverlangt, und die sich so Kreativität, Freiheit und Wohlstand neu erarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Sattelberger
Mit Jan Dermietzel
Radikal neu
Gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: total italic Grafik Design Studio, Berlin
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN (Print): 978-3-451-39597-0
ISBN (EPUB): 978-3-451-83154-6
Inhalt
Warum ich wirklich Schluss gemacht habe: das radikale Ende meiner Berliner Hoffnung
Eine Lebensaufgabe: die eigene, radikale Transformation
Sich zu verändern heißt: sein Selbst zu werden
Walk the talk!
Schmerz ist lehrreicher als Schönwetter
Finde dein Lebensthema!
Work-Life-Balance: oft Fluchtweg der Müden und Trägen
Vakuum in meiner Transformation hat mich depressiv gemacht
Wer Aufbruch wagt, muss die Tragfähigkeit seiner Zukunftsoptionen prüfen
Wer Zukunft machen will, braucht die Jungen
Transformation braucht ruhende Pole: meiner ist mein Mann
Ein halbes Jahrhundert erlebte Transformation: Führung in der Wirtschaft
Meine 50 Jahre Wirtschaft: episodischer Wandel als erste Phase
Die zweite Phase des Wandels: Entgrenzung
Die dritte Phase: Disruption
Allmachtsfantasien der Mächtigen
Transformation braucht Effizienzmaschinen wie Innovationswerkstätten
Deutsche Unternehmen: im Status quo verhaftet
Disruptiver Wandel zwingt Systeme, sich für Disruptoren zu öffnen
Niedriglohnsektor statt Technologie: der große Irrtum
Merkposten 1: Führung muss sich der Transformation aufrecht stellen
Merkposten 2: Wer in der Krise keine Zeit für Reflexion hat, verliert den Kompass für Zukunft
Merkposten 3: Authentizität in der Führung!
Merkposten 4: Transformation ist nicht friedfertig
Merkposten 5: Konfliktscheu schadet
Merkposten 6: Krisen übersteht besser, wer Krise kann
Merkposten 7: Interne Vertraute sind nötiger als externe Getreue.
Merkposten 8: Abschweifende Debatten killen
Merkposten 9: Fokus statt Perfektion
Warum Unternehmen früher sterben oder länger leben
Auslöser von Wandel
Lufthansas Transformationsfähigkeit? Tiefflieger
Unternehmen brauchen Transformationsmotoren von unten: Graswurzelbewegungen.
Contis Transformationsfähigkeit? Gebremst
Innovation nicht erst, wenn man sie händeringend benötigt
Telekoms Transformationsfähigkeit: ein Inlandsgespräch
Speedboats: unumgänglich für Transformation
Radikal neu: Quereinstieg in die Politik
Der Kampf vor dem ersten Wahlkampf
Die Ochsentour im Schnelldurchlauf
Der Sprung auf die Liste
Anfang und Ende von Jamaika
Territoriale Kleinstkriege
Meine drei öffentlichen Kritiken an der FDP
Mühseliger Kampf für Innovation, Bildung, Diversity
Politische Routine und Unroutine
Am Start: die Übernahme der Regierungsverantwortung
Endlose, oft unsinnige Arbeit
Mein 100-Tage-Programm
Die Ampelkoalition: eine unübersehbare Zwangsheirat
Hindernisse und Verbündete im Ministerium
Strangulierte Innovation: Opfer von Staat, tradierter Wissenschaft und Forschung
Warum Abgeordnete nix von Innovation verstehen (wollen)
Fremdwort Strategie
Forschungsoutput und Forschungstransfer: lange verpönt
Blinder Fleck: Throughput oder was innendrin passiert
Hochschulen müssen sich endlich profilieren
Innovationsregionen um DeepTech-Hochschulen herum
Mythos Staat: der Rohrkrepierer bei Innovation
Fehlschläge staatlicher Innovationssteuerung
Freiheitliche Innovationsarchitekturen werden sabotiert
Deutschland in spätrömischer Dekadenz: kranker Mann Europas
Macht und Ohnmacht
Die Arroganz der Macht hat keine Substanz
Ohnmacht folgt auf Sorglosigkeit und Kontrollverlust des Mächtigen
Mächtige sind Schachfiguren der noch Mächtigeren
Machtkämpfe sind Revierkämpfe
Omnipotenz und Tränen
Volkswagen: gescheiterter Prototyp von Machtkultur
Macht braucht ihre Jasager
Was kann man gegen die Falschen an der Macht tun?
Handwerklichkeit und Leistung
Ohne »Training, Training, Training« keine Handwerkskunst
Arbeit um ihrer selbst willen
Sich auf die Meisterprüfung vorbereiten
Der Unterschied zwischen Verwaltung und Verantwortung
Handwerklichkeit verludert hierzulande
Projekttourismus und Teamarbeit: organisierte Verantwortungslosigkeit?
Organisation ertüchtigen statt Gehirn outsourcen
Handwerklichkeit bei Karrierepolitik
Prototypen handwerklich designen für Zukünfte
Dahin gehen, wo Handwerkliches geleistet wird
Führung ist professionelles Handwerk
Motivation und Ethos handwerklicher Arbeit
Karrieren und Potenzialentfaltung
Mein Wirtschaftsleben: Quereinsteiger in Apparaten
Konzernkarriere heißt: mehr und mehr Komplexität meistern
Rarität in alten Unternehmen: Wertschätzung für junge Rebellen
Gen-Z-Karriere: Freiheit oder Flucht in die Sicherheit?
Den Vampiren entkommen: selbst Karriere planen
Disruptive Karrieren: von Piraten lernen?
Entrepreneurship-Karrieren gegen deutsches Mittelmaß
Freelance-Karrieren haben Zukunft: außer in Deutschland
Der nichtunternehmerische Staat und seine Karrieren
Irrlichternde Politjunkies ohne Praxis
Der alte Edgar Schein wusste es alles schon
Vielfalt und Diversity of Mind
Ich und Frauenquote? Heute nein!
Quoten für alles und jeden
Quotenhammer statt kluger Talent- und Kulturpolitik
Überzeugungstäter für Diversity
Die Spitze ist nicht schwul – don’t come out
Archaische Vorurteile in den Eliten
Don’t ask, don’t tell
Grenzen achten und ziehen
Drei Zielsetzungen von Diversity
Schmidt sucht Schmidtchen
Habitus nicht vergessen!
In den Katakomben des Übergriffs
Wer sind die Opfer, wer die Täter?
Gendern und Transgendern bringt mich zur Weißglut
So sexistisch ist die deutsche Gründerszene
Resiliente Organisationen sind diverse in mind
Für eine Renaissance der deutschen Leitkultur
Parallelwelten zerstören den Pluralismus
New Education und New Learning
Wirtschaft als Inspiratorin für Fortschritt in der Bildung
Erste Debatte: Nicht Abschottung und Stereotype, sondern soziale Durchlässigkeit
Unvollendet: Reformschritte für Durchlässigkeit
Zweite Debatte: Humankapital versus Humanismus
Dritte Debatte: Kreation versus industrielle Instruktion
Kompetenzen schlagen Noten und Abschlüsse
Stellhebel I: Dritte Orte – Lernen für die Zukunft
Deutsche Schulen: reformunfähig!
Stellhebel II: Schulfreiheitsgesetze
Stellhebel III: Chancenfairness für private Schulen
Stellhebel IV: Kooperationspflicht von Bund und Ländern
Innovationsarme Hochschulen
Weniger Wilhelm, mehr Alexander von Humboldt
Science Leadership statt Hochschultechnokratie
Die Mär vom Erfolgsschlager deutsche Berufsausbildung
Talentvergeudung: erschreckende Zahlen in der beruflichen Bildung
Diskriminierung den Kampf ansagen
Betriebskulturen erneuern
Berufsausbildung in die Breite: die Pyramide drehen
Auch in der beruflichen Bildung die Allerbesten fördern
Weiterbildung in sich digitalisierenden Arbeitsmärkten
In Deutschland: Skill-Shift statt Jobabbau
Future Skills für Arbeitsmärkte
Growth Mindset contra Fixed Mindset
New Work: Neu arbeiten und Neue Arbeit
Humanisierung der Arbeit ab den 1970er Jahren
Die Angst der Politik vor New Work
Von Produktivität zu Talent
Verzwergungen von New Work
Überfällige Debatte über mehr Präsenz und weniger Distanz
Homeoffice: Kampfansage an Normalarbeit und für digitales Freelancing
Organisation neu erfinden mit Social Labs
Digitale Transformation verflüssigt Arbeitsmärkte
New Work und New Business sind Zwillinge
Sozialpartnerschaft 2.0
Neue Arbeit schaffen, nicht nur anders arbeiten
New Work inmitten schöpferischer Zerstörung
New Economy und New Society
Territorien der Freiheit statt radikal neuer Gesellschaftsentwürfe
Wettbewerb zwischen Unternehmenstypen ermöglichen
Neues Geschäftsmodell für Deutschland
Eine Vision für danach habe ich!
Gewerkschaften: bewegt euch!
Szenarien gesellschaftlicher Entwicklung
Evolutionärer Systemwettbewerb der Zukunftswelten
New Politics: erneuerte Parteien und Parlamente
Parteiinteressenten: Bittsteller oder Gesuchte?
Quereinsteiger und Parteilose: ungeschliffene Juwelen
Parteien als offene Plattformen
Personalmanagement für Parteien
Das Parlament als offenes System
Epilog
Nachwort von René Obermann
Über die Autoren
Warum ich wirklich Schluss gemacht habe: das radikale Ende meiner Berliner Hoffnung
19. Mai 2022, der Donnerstag einer Sitzungswoche. Am Morgen hatte ich mich mit Professor Michael Baumann vom Deutschen Krebsforschungszentrum ausgetauscht. Nun nahm ich seit 11 Uhr virtuell an einer Sitzung des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft teil, der heute drei neue Vorstände berief. Parallel verfolgte ich in kurzen Abständen meine Mail- und Messenger-Apps. Plötzlich erreichte mich die Kurznachricht eines Kollegen aus dem Haushaltsausschuss. Die Koalitionsmehrheit hatte soeben meine beiden großen Projekte für diese Legislaturperiode zerschossen.
Die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) erhielt nur minimale Gelder. Mehr Mittel gebe es erst, wenn wir ein »schlüssiges Konzept« vorlegten. Und für die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SprinD) hielt der Haushaltsausschuss einen Großteil der Mittel zurück. Für die Entfesselung der SprinD hatte ich seit 2018 mit Herzblut gekämpft. Unverschämt war die Begründung für die Budgetverweigerung bei der DATI: auf dem Tisch lag das schlüssigste Konzept. Wenn die Opposition sowas fordert: geschenkt! Wenn es die eigenen Fraktionskollegen und Koalitionäre tun, greift man sich nur noch an den Kopf. Und bei SprinD war das schlüssige Konzept schon als Referentenentwurf in der interministeriellen Abstimmung unterwegs – dies aber war den Haushältern keine Silbe wert.
Mein Herz und meine Seele erstarrten. Mein Entschluss stand binnen Sekunden fest. Ich nahm mein Mobiltelefon und tippte sofort meine Rücktrittserklärung als Parlamentarischer Staatssekretär an Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie versuchte mich umzustimmen, aber mein Entschluss war unumstößlich. So wie die Entscheidung des Haushaltsausschusses in Stein gemeißelt war; sie lag dem Bundesfinanzministerium bereits offiziell vor. Jahrelange Arbeit für die Katz! Selbst wenn ich mit Zähnen und Klauen dafür gekämpft hätte, das Geld in der nächsten Haushaltsrunde doch noch zu bekommen, hätten wir die entscheidende Zeit verloren, um DATI und SprinD wetterfest in dieser Legislaturperiode aufzustellen. Der sich abzeichnende Bundestagswahlkampf ab dem Jahreswechsel 2023/24 würde zudem sämtliche pragmatischen Entscheidungen wieder verhageln.
Nicht im schlimmsten Albtraum hätte ich eine derartige standrechtliche Erschießung meiner beiden Babys erwartet. Vor Tagen noch hatten SPD-Haushälterin Wiebke Esdar und ich uns ausgetauscht; und ich hatte geglaubt, ihre letzten Bedenken gegen DATI und SprinD ausgeräumt zu haben. Ich war ihr an mehreren Stellen entgegengekommen: etwas weniger Avantgarde, dafür etwas mehr Herz-Jesu-Sozialismus. Ich hatte Frau Esdar dabei klar gesagt, wo meine rote Linie im Haushalt verläuft: zum Beispiel bei einem Mindestbudget für DATI und SprinD über mehrere Haushaltsjahre hinweg sowie bei einer Projektförderlogik für die DATI, die nicht staatlich geprägt ist, sondern durch Entscheidungsprozesse vor Ort. Daneben war mir wichtig, dass die SprinD unabhängig werden müsse von der Fachaufsicht des Ministeriums. Ich hätte es bei ihr, einer Sprecherin der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, besser wissen müssen.
Ein junger Berufspolitiker hätte sich eine solche Demütigung gefallen lassen und sich taktisch für die weitere Karriere entschieden. Ich aber war 73. Ich wollte kein Geld mehr verdienen und auch nicht mehr Karriere machen. Das hatte ich alles schon hinter mir. Alles, was ich wollte, war: einige wenige wichtige Projekte aufs Gleis zu setzen, damit Deutschland bei seiner Innovationskraft nicht noch weiter zurückfällt, sondern wieder aufholen kann.
Die Pressemitteilung über meinen Rückzug aus der Politik enthielt keine Silbe über den Haushaltsausschuss. Ich selbst schlug vor, von persönlichen und gesundheitlichen Gründen in meinem engsten Umfeld zu sprechen, um die Ministerin zu schützen. Das war zwar nicht die volle Wahrheit. Es war aber auch nicht geschwindelt. Nur die Ministerin und meine engsten Mitarbeiter in Bundestag und Ministerium wussten, dass mein Ehemann Steven gesundheitlich schwer angeschlagen war und meine hochbetagte Mutter seit vielen Wochen schwerkrank im Krankenhaus lag. Hinzu kam meine akute Arbeitsbelastung, die mir kaum Zeit ließ, mein Privatleben zu balancieren (dies beschreibe ich näher im Kapitel »Radikal neu: Quereinstieg in die Politik«). Ich arbeitete wie ein Schwein, schlief kaum, kam wenig dazu, zuhause anzurufen. Ich verzweifelte ab und an, aber ich managte es. Doch der Beschluss des Haushaltsausschusses hatte jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht.
Kurz rang ich mit mir, ob ich mein Bundestagsmandat behalten sollte. Dann aber gingen mir Armin Laschet und Martin Schulz durch den Kopf, die beide so oft wie lahme Enten durch die Reihen im Plenarsaal watschelten auf der Suche nach Menschen, die sich noch für sie interessieren. Viele politische Freunde fragten mich, warum ich nicht wenigstens das Mandat behielte. Erst später erkannte ich, dass sie eigentlich wissen wollten, wieso ich 150.000 Euro im Jahr einfach so in den Wind schlug.
Beim Lesen haben Sie es vielleicht schon festgestellt: Ich kann nicht halbe Kraft. Nur volle Kraft voraus. Und mir war auch schlagartig die Lust auf einen politischen Betrieb vergangen, der jahrelang mit Schweiß, Tränen und Gehirnschmalz vorbereitete Projekte mit geschlossenem Visier und ohne Vorwarnung guillotinierte, weil egozentrische oder ideologische Interessen dagegen standen.
Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie die Ampelmehrheit im Haushaltsausschuss urplötzlich auf die Idee kommen konnte, DATI und SprinD und damit die beiden Forschungsleuchttürme des BMBF notzuschlachten. Niemand wüsste das lieber als ich. Und auch ich kann nur Indiz an Indiz reihen.
Nach allem, was ich weiß, war der zweite Judas Otto Fricke, FDP-Chefhaushälter im Bundestag. Bis 2013, als die FDP aus dem Bundestag flog, war er Parlamentarischer Geschäftsführer, zwischen 2005 und 2009 saß er dem Haushaltsausschuss vor. Als die FDP 2017 in den Bundestag zurückkehrte, erhielt er keine relevante Position in der Fraktion. Und dies wiederholte sich 2021. Ich habe gehört: Otto Fricke war zwar in der Fraktion als kühler Rechner geschätzt, aber nicht als Mensch. Dass ich selbst einmal Gegenstand seines Spiels werden würde, hatte ich nicht vorausgesehen. Man unterliegt ja bisweilen der Gefahr, den wirklichen Gegner nicht zu erkennen. Freund, Feind, Parteifreund. Hätte ich es riechen müssen? Otto Fricke war aschfahl im Gesicht, als am 7. Dezember 2021 in der Fraktionssitzung meine Ernennung zum Staatssekretär öffentlich wurde. Er hingegen war erneut komplett leer ausgegangen. Seitdem konnte er mir nicht mehr in die Augen sehen. Physiognomie und Psychognomie.
Über Neid und Missgunst hinaus habe ich allerdings noch einen weiteren handfesten Anhaltspunkt. Und der hat mit der Fraunhofer-Gesellschaft zu tun und deren damaligem Präsidenten Reimund Neugebauer. Ihm war ich wegen unzähliger Verfehlungen als Führungskraft seit vielen Monaten auf der Spur, und schließlich musste er Ende Mai 2023 vorzeitig von seinem Amt zurücktreten. Ich gehe im Kapitel »Radikal neu: Quereinstieg in die Politik« näher darauf ein. Ein Jahr zuvor jedoch war er noch im Amt, wähnte sich in Saft und Kraft und baute fleißig Wagenburgen, um seine autoritäre Herrschaft bei Fraunhofer zu sichern. Nicht zuletzt hatte Neugebauer nach der Bundestagswahl 2021 begonnen, Anfang 2022 Mitglieder des Haushaltsausschusses für seinen Senat auszuwählen. Das hatte er zwar nicht zum ersten Mal gemacht. Unsittlich, statuten- und compliancewidrig war es trotzdem. Nur war vor mir niemand dagegen vorgegangen. Ich nehme an, um den inner- wie zwischenparteilichen Frieden zu wahren und den mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
Doch ich wollte wie ein getreuer Eckart den Koalitionsvertrag erfüllen, der aufgab, die Compliance der Wissenschaftsorganisationen zu verbessern. Wir Forschungs-Koalitionsverhandler von SPD, Grünen und FDP hatten gegen Ende der Verhandlungen beschlossen, gemeinsam auf Bärbel Bas zuzugehen, die damals noch im Fraunhofer-Senat saß. Wir baten sie, dort explizit Stellung zu beziehen zu Neugebauers mangelndem Compliance-Gebaren, bevor sie ob ihres neuen Amts als Bundestagspräsidentin den Senat verlassen würde. Leider lehnte sie ab. Gleichwohl wollten wir Vertreter aller drei Parteien Neugebauers schmutzigem Spiel ein Ende setzen. Folgenden Satz verankerten wir im Forschungskapitel des Koalitionsvertrags:
»Standards für Führung und Compliance-Prozesse sind im Wissenschaftssystem noch stärker zu berücksichtigen.«
Wer mich kennt, weiß: Seit Jahrzehnten ist es mir ein unverzichtbares Anliegen, dass Führungshandeln mit gesetzlichen Vorgaben, Statuten, Leitbildern, Führungsgrundsätzen im Einklang steht. Mein Wertekanon ist an dieser Stelle unbeugsam. Die Satzung des Fraunhofer-Senats sieht keine Abgeordneten als Mitglieder vor, dafür andere Personengruppen (zum Beispiel externe Wissenschaftler), die Neugebauer seit Jahren übergangen hatte. Vorschriftsmäßig ist auch nicht, dass Regierungsfraktionen auf Vorschlag des Fraunhofer-Präsidenten Kandidaten finden und für den Senat nominieren – erst recht nicht, ohne zuvor den Senatswahlausschuss der Fraunhofer-Gesellschaft (dem ich als Staatssekretär damals angehörte) inhaltlich einzubinden. Zudem: Wie sollen Haushälter im Parlament unbefangen einen Haushalt genehmigen oder ablehnen, den sie vorab schon bei Fraunhofer abgesegnet haben?
Einer von Neugebauers Wunschkandidaten hieß Otto Fricke. Ich habe Neugebauer dreimal warnen lassen, Fricke und andere Haushälter nicht zu nominieren. Als er dies trotz Warnung wenige Tage vor der Senatswahl doch tat und die offizielle Tagesordnung samt den Namen seiner Kandidaten übermittelte (das waren neben Fricke Helge Braun, der frühere Kanzleramtsminister und jetzige Vorsitzende des Haushaltsausschusses, und der SPD-Abgeordnete Sönke Rix), trat ich voll auf die Bremse. Nach meinem Veto kamen bei den Senatswahlen mithin nicht Neugebauers Auserwählte zum Zuge, sondern echte Wissenschaftler, die im Senat jahrelang gefehlt hatten.
Als Otto Fricke von meinem Widerspruch gegen ihn und andere Haushälter erfuhr, beschwerte er sich bei der Ministerin, die sich daraufhin sorgte. Ich rief ihn an und musste minutenlang seiner Wut zuhören. Wie ich mittlerweile weiß, erging es einst einem Landesminister ähnlich, als Fricke sich übergangen und ausgebremst fühlte. Spät nachts, als die Würfel für den Fraunhofer-Senat gefallen waren, schrieb Otto Fricke mir seine bislang letzte SMS: »Wir haben nichts zu besprechen.« Das war vier Tage vor dem 19. Mai 2022.
Ich kann auch nicht völlig ausschließen, dass Ministerin Bettina Stark-Watzinger sich nicht ausreichend für meine Themen eingesetzt hat, um stattdessen das Forschungsschiff Polarstern II zu retten. Dabei hätte sie dann wahrscheinlich aus ihrer gefühlten Not heraus gehandelt. Wir hatten vor diesem 19. Mai 2022 im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unser Budget immer wieder genau unter die Lupe genommen. Aufgrund der zahlreichen fest fixierten Bund-Länder-Vereinbarungen und Pakte für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen war der finanzielle Spielraum für neue Themen derart begrenzt, dass neue Projekte sich nur gegenseitig kannibalisieren konnten. Wir suchen verzweifelt nach Wegen, diese und andere Großprojekte zu finanzieren. Dazu kamen in der mittelfristigen Finanzplanung von der Vorgängerregierung nicht berücksichtigte Risiken – einerseits im Pakt für Forschung und Innovation, andererseits bei dem Milliardenprojekt Teilchenbeschleuniger FAIR in Darmstadt.
Und es kann sein, dass mein damaliger Kollege Jens Brandenburg (als Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF auch zuständig für den Kontakt zu den Haushältern und die Haushaltsverhandlungen) sich nicht für mich verkämpft hat. Er und SPD-Haushälterin Wiebke Esdar wussten sehr klar im Vorfeld, wo bei mir die rote Linie überschritten sein würde. Ich habe der Machtpolitikerin Esdar vielleicht sogar eine Anleitung gegeben, wie sie mich loswird. Frickes Wut kreuzte sich nicht nur mit Jens Brandenburgs Verhandlungsführung, die mir zu lasch war, sondern auch mit dem Willen der SPD-Haushälter, die mich kastrieren wollten. Vor allem Wiebke Esdar wollte mich bei DATI und SprinD zur lahmen Ente machen.
Das Knäuel an Interessenlagen ist letztlich unentwirrbar. Aber alles zahlte am Ende darauf ein, meine Projekte zu massakrieren und mich mürbe zu machen. Der Journalist Christian Füller hat in Table.Bildung geschrieben: »Wer Thomas Sattelberger kennt, der weiß, dass das nur als Demütigung von ihm aufgenommen werden konnte.«
Wiebke Esdar hatte sicher andere Beweggründe als der nach Vergeltung suchende Otto Fricke. Der taktisch wendige Jens Brandenburg war anders gepolt als Bettina Stark-Watzinger. Dass ich stehenden Fußes den Bettel hinschmeißen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet – außer Reimund Neugebauer. Eingeweihte berichteten mir, dass er sich in einer Fraunhofer-Vorstandssitzung nach meinem Rücktritt damit gerühmt habe, mich »höchstpersönlich entsorgt« zu haben. Als ich ihn damit konfrontierte, stritt er alles ab und behauptete, von Neidern und Böswilligen umgeben zu sein.
All dies illustriert trefflich, welche Möglichkeiten ein Politiksystem bietet, um anderen ein Bein zu stellen. Diese Möglichkeiten sind sehr viel vielfältiger als in der Wirtschaft. Die Politik ist ein System organisierten Misstrauens, in dem so viele bei Verdienst und Berufsweg abhängig sind vom parlamentarischen Futtertrog. In der Wirtschaft hingegen herrscht zumindest in weiten Teilen ein System dosierten und konditionierten Vertrauens, das zudem variantenreicher ist, wenn es darum geht, Geld zu verdienen und Karriere zu machen.
Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen, und es gibt gerade einmal einen abgemagerten Gesetzentwurf für SprinD, der sowohl dem Forschungsministerium als auch dem Finanzministerium nach wie vor ermöglicht, die Freiheitsräume der SprinD signifikant einzuschränken. Und es gibt immer noch kein neues Konzept für die DATI, sondern lediglich zwei Förderlinien nach alter Projektförderlogik. Den Geist einer freiheitlichen Agentur atmen sie nicht.
Deutschlands politisches System schickt nicht nur miteinander im Wettbewerb stehende Parteien und Fraktionen in den Konkurrenzkampf. Auch innerhalb einer Fraktion ringen inhaltlich gleich oder ähnlich Gesinnte ständig miteinander um Macht und Einfluss. Es ist beinahe gleichgültig, ob man gegeneinander opponiert, miteinander koaliert oder derselben Fraktion angehört: immer geht es am Ende darum, wer sich durchsetzt. Machtsicherung und Machterhalt sind die zentralen Motive. Ihnen ordnen sich alle anderen Überlegungen unter. Zwei Archetypen dabei: der opportunistische Politiker und der ideologisch verblendete Politiker.
Im Gegenüber immer Freund und Feind zugleich zu sehen, das führt gerade beim Archetypen des opportunistischen Politikers zu einem fluiden Rollenspiel, in dem niemand unverbrüchliche Treueversprechen geben, halten oder an sie glauben kann. Dies prägt den Charakter der Akteure bis ins Mark. Unbestritten gibt es auch Politiker, die transparent, werte- und prinzipiengeleitet ihren Weg gehen – aber sie befinden sich in der Minderheit. Die große Mehrheit des ersten Archetyps verflüssigt in ihrer Persönlichkeit, und zwar nicht nur wie ein Chamäleon an der Oberfläche, sondern tief in ihrem Wesen. Denn dieses ununterbrochene Rollenspiel zwingt Politiker jeden Tag zum Kampf um ihre innere Unabhängigkeit. Nur wenige muten sich diesen Kraftaufwand zu; sie ergeben sich situativ oder gleich generell. Und dies hat nicht nur Konsequenzen für die eigene Seele, sondern auch für die Qualität der eigenen Arbeitsergebnisse. Wer sich nirgends eine Blöße geben will, wer keine Verwundbarkeit oder Achillesferse offenbaren kann, muss schlüpfrig durchkommen, darf nicht anecken, muss an seine inhaltliche Substanz gehen. All dies endet im Mittelmaß – für den einzelnen Abgeordneten wie für das Parlament insgesamt.
Beim zweiten Archetypen, dem ideologisch verblendeten Politiker, steht die geistige Verengung im Vordergrund. Er ist nicht transparent und wertegeleitet und auch nicht unabhängig im Urteil, sondern im Urteil stets bereits fixiert. Dies führt zu einer taktischen Unberechenbarkeit, fast, als sei er eine Marionette fremder Mächte trotz seiner sehr berechenbaren Grundlinie. Dabei ist er unschlüpfrig, konsequent, in der Sache kompromisslos und ohne Mittelmaß – außer es ließe sich über einen Kompromiss das noch höhere Ziel erreichen: der Sieg für die große Sache.
Auch im größten Feuersturm den Rücken gerade zu machen wie einst Bundeskanzler Helmut Schmidt bei der damals hochumstrittenen Stationierung der Mittelstreckenraketen in Europa zu Beginn der 1980er Jahre oder wie Gerhard Schröder bei den einschneidenden Hartz-Reformen Anfang des neuen Jahrtausends: das heißt auch immer, die eigene politische Existenz aufs Spiel zu setzen, um das inhaltlich Richtige durchzusetzen. Genauso gehört dazu, zurückzutreten, wenn man eine inhaltliche Entscheidung nicht mittragen kann. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger legte 1995 ihr Amt als Bundesjustizministerin nieder, weil sich ihre FDP für den sogenannten Großen Lauschangriff entschieden hatte.
Horst Seehofer trat 2004 als CDU/CSU-Fraktionsvize im Bundestag zurück, weil er den Koalitionskompromiss bei Gesundheitsreform und Kopfpauschale für grundlegend falsch hielt. Nennen möchte ich auch den wackeren Wolfgang Bosbach, der als Bundestagsabgeordneter stets so meinungsstark auftrat, dass er trotz jahrzehntelang CDU-geführter Bundesregierungen nie ein Regierungsamt erhielt. Ich selbst bin nicht der großen Staats- oder Parteiräson wegen zurückgetreten. Mir ging es um professionelle Kernfragen, die meinen Rücktritt unumgänglich machten.
Starke berufliche und damit karrierekritische Standpunkte setzen indessen voraus, dass man sich tief eingearbeitet hat. Nur auf der Grundlage hoher Professionalität ergibt es Sinn, für seinen Standpunkt das eigene berufliche Fortkommen in die Waagschale zu werfen. Und nur auf der Grundlage innerlicher und äußerlicher Unabhängigkeit kann man sich solche existenziellen Standpunkte leisten. Wer außerhalb der Politik kaum beruflich vermittelbar ist, wird diese Karriere nicht riskieren (können).
Im Kapitel »Macht und Ohnmacht« beschreibe ich mich in einer Anekdote als jemanden, der im Spiel der Mächtigen nur noch eine Figur auf dem Schachbrett war. Das politische Berlin ist ein Schachbrett mit unzähligen Spielern, die sich dem Wahn hingeben, sie würden ihre Figuren ziehen oder seien selbst mächtige Figuren. In den Sekunden meiner Rücktrittsentscheidung fühlte ich mich an oder auf diesem Schachbrett ohnmächtig. Ich hatte nur noch die Wahl, mir ein neues Schachbrett zu suchen oder zu schnitzen, um meine Ehre zu wahren.
Eine Lebensaufgabe: die eigene, radikale Transformation
»Werde der, der du bist.« Dieser Satz des Lyrikers Pindar, der von 518 bis 442 vor Christus lebte, begegnete mir erstmals im Griechischunterricht am humanistischen Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Ein paar Jahre später las ich Hermann Hesses »Siddharta« zum ersten Mal. Dieser wandlungs- und transformationsbereite Siddharta auf seiner Suche nach Sinn und Zweck der eigenen Existenz hat mich in jungen Jahren zutiefst beeindruckt und bis heute nicht losgelassen. Denn mir wurde immer klarer: Erkenntnisse über die eigene Transformationsfähigkeit und -motivation sind die Voraussetzung dafür, andere der Transformation auszusetzen.
Ich übersetze Pindar so: Wir entdecken unsere Identität erst im Wandlungsprozess. Mensch zu sein heißt, sich selbst und die eigenen Potenziale in Erfahrung zu bringen, auch Sünde und Laster zu akzeptieren – die Schattenseiten des Selbst genau so als Element unseres Daseins zu verstehen wie die Sonnenseiten. Siddharta lehrt uns, dass solche Erkenntnisse nicht vom Himmel fallen, sondern sich oft erst nach Bewältigung verschiedenster Lebensphasen erschließen. Das eigene Leben ist eine stete Transformation. Einfluss haben wir auf Geschwindigkeit, Richtung und Intensität.
Sich zu verändern heißt: sein Selbst zu werden
»Man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das man zur Verfügung hat.« Dieser realpolitische Satz von Theodor Storm gefällt mir. Zumal man mit zunehmenden Jahren auf immer mehr Holz zurückgreifen kann – wie eine an Jahresringen zulegende Eiche. Von Lebensphase zu Lebensphase gleiten, schlittern oder stürzen viele von uns, oft in krisenhaften Übergängen, die unser Leben fast selbstverständlich spicken und dabei katalysatorisch wirken. Das reicht von der Midlife-Krise über die Angst vor dem Alter bis zu den upending experiences, unser Leben umstülpenden Ereignissen, wie sie der Psychologe Edgar Schein nannte: der Verlust geliebter Menschen oder die plötzliche Kündigung. Musterähnliche Transformationsereignisse prägen auch Gesellschaften und Volkswirtschaften.
Denn ökonomisch-gesellschaftliche Entwicklungen fußen auf dem Prozess kreativer Zerstörung. Interessant: Dieser Gedanke taucht ebenfalls bei Siddhartha auf; auch den Hinduismus prägt der Gedanke, dass ohne Zerstörung kein Neubeginn möglich ist.
Wie viel Joseph Schumpeter vom Hinduismus hielt, weiß ich nicht. Er war jedenfalls der erste Ökonom, der nicht nur den Begriff der schöpferischen Zerstörung geprägt hat, sondern auch den des innovativen Unternehmers, der Mittelmaß hasst, Leistung liebt und gegen die Widerstände des Establishments Innovation vorantreibt.
Weiterentwickelt hat diese Theorie der leider viel zu früh verstorbene Clayton Christensen in seinem Buch »Innovator’s Dilemma«. Christensen zufolge werden erfolgsverwöhnte Institutionen immer innovationsärmer, arbeiten überwiegend mit sustaining technologies, so dass sie schließlich von innovativen Organisationen mithilfe von disrupting technologies vom Thron gestürzt werden.
Wer dieses Absturzrisiko verringern will, muss sich ambidexter, also beidhändig aufstellen. Bei der Ambidextrie handelt es sich um eine empirisch belegte Organisationstheorie, die deutlich macht, dass nur resilient und zukunftsfähig ist, wer neben soliden Standbeinen auch mit experimentellen Spielbeinen arbeitet. Genau dieses Prinzip gilt auch für jede einzelne Person, die sich ins (Berufs-)Leben begibt oder darin steht.
Routinen sind wichtig, weil sie Halt, Orientierung und Gewissheit geben. Aber in ihnen blüht man nicht auf. Dafür müssen wir Neues entdecken, bislang unerklommene Berge überwinden. Manchmal brauchen wir große Herausforderungen, ohne die wir nie herausgefunden hätten, was in uns steckt. Ein ewiges Prinzip, das für Menschen, Organisationen, Nationen gleichermaßen gilt.
Ich hatte schon früh im Leben den unbändigen Willen, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu prägen und nie ein »Opfer der Umstände« zu werden. Ich wollte nie die Miniaturausgabe von Mutter oder Vater sein oder anderer etwaiger Vorbilder (die ich nie hatte). So etwas endet meist in einer Karikatur.
Das eigene Wertegerüst wächst erst im Wandel der Zeiten. Auch Siddharta hat ohne Werte angefangen. Gerechtigkeitsfanatiker, der ich bin, ging ich als Teenager den Maoisten auf den Leim und habe mich von ihrer trügerischen Ideologie verführen lassen. Das Erwachen in jungen Jahren war bitter.
Dies im Hinterkopf habe ich mich oft gefragt, ob aus mir wohl auch ein strammer Hitlerjunge geworden wäre, hätte nicht die Gnade meiner Geburt nach dem Krieg dies ohnehin verhindert. Ich fürchte: ja. Jedenfalls, solange mir kein schreiendes Unrecht begegnet wäre. Da hätte ich aller Erfahrung nach revoltiert. Und zur Gnade gehört wohl dazu, dass ich meine Maoisten ungeschorener verlassen konnte, als dies in der Hitlerjugend möglich gewesen wäre.
Sich zu fragen, wie das Aufwachsen in Unrechtsregimen oder autoritären Umständen einen selbst geprägt hätte, halte ich für wichtig, auch wenn es hypothetisch ist. Es schärft unser Sensorium, unseren inneren Kompass in transformativen Zeiten.
Walk the talk!
Dieses Buch beginnt auch deshalb mit einem Kapitel über die eigene Transformation, weil man anderen nichts vermitteln kann, was man nicht selbst lebt, nicht selbst längst kritisch hinterfragt hat. Walk the talk! Wer an seine eigenen Worte nicht glaubt und seine eigenen Appelle nicht selbst lebt, wird schnell entlarvt. Ich habe außerdem immer wieder erlebt, wie wichtig der Rückgriff auf das eigene Innenleben ist, auf die eigenen Gefühlswelten, die eigene Sensorik, wenn man die Realität erfassen will. Insofern ist der Bezug auf das Ich immer Dreh- und Angelpunkt, erst recht in der Krise. Und in der Krise stecken wir.
Unser Land ist voll auf der Rutsche nach unten. Und auf dieser Rutsche gibt es keinen Halt mehr. Deutschland ist der kranke Mann Europas. Punkt. Das ist nicht das Tragische. Entscheidend wird sein, ob es uns gelingt, Deutschland am Wendepunkt zu sanieren und zu erneuern. Aufstieg und Fall von Nationen sind genau so normal wie Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens. Den Schmerz der Krise zu ertragen ist oft wichtiges Arzneimittel für die Gesundung. Und hier schließt sich ein Kreis. Denn für diese Transformation braucht es Führende, die wissen, wie es ist, wenn man Transformation selbst durchschreitet. Schönwetterkapitäne des eigenen Lebens helfen uns nicht weiter, wenn wir gemeinsam mit anderen glaubwürdig einen neuen Anfang gestalten wollen.
Schmerz ist lehrreicher als Schönwetter
Dass wir überhaupt einen inneren Kompass entwickeln, ist meines Erachtens eine Frage der Erziehung – früher hätte man gesagt: des Elternhauses. Werte fallen uns nicht zu. Es bedarf der frühen und manchmal auch hartnäckigen Vermittlung durch Bezugspersonen, dass all dies wichtig ist: offen für Neues zu sein, sich nicht über andere Menschen zu erheben, ehrbar zu arbeiten.
Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Dieser Aphorismus aus dem Roman »Der Leopard« von Giuseppe Tomasi di Lampedusa bringt mich zu der Frage, wie weit Transformation gehen kann und soll. Wohnt uns ein nicht einschmelzbarer, völlig unflexibler Kern inne, dem auch die krassesten Umstände nichts anhaben können – der aber mit uns stirbt? Oder sind wir alle Chamäleons, die dadurch, dass wir mit den Umständen gehen, nicht untergehen?
Luchino Viscontis Verfilmung des »Leoparden« habe ich 1963 übrigens in Stuttgart im Kino gesehen. Meine Mutter gab mir das Geld für die Eintrittskarte. Das war nicht selbstverständlich in unserem sparsamen schwäbischen Haushalt. Ob sie in der Stuttgarter Zeitung eine Rezension gelesen hatte? Ob es ihr um meine Bildung ging? Oder sie mir einfach einen vergnüglichen Nachmittag gönnen wollte? Ich weiß es nicht.
Viele Eltern bauen heute Schutzräume auf. Meine hingegen haben mir immer neue Experimentierräume eröffnet: Abenteuertouren mit den Pfadfindern zum Beispiel oder mein (damals noch ungewöhnliches) Schuljahr in den USA. Sie blieben sogar recht tolerant, als ich als APO-Gymnasiast aus allem auszubrechen versuchte.
Mich haben neben meinen Eltern sicher einige Lehrer früh geprägt und ein aus meiner damaligen Sicht älterer Pfadfinderkamerad, der sich später übrigens entschied, Priester zu werden. Er hieß Jossip und trat für Schwächere ein. Wir waren in den Pyrenäen unterwegs, und die älteren Jungs überboten sich darin, immer noch schwierigere Routen für die nächsten Tage zu finden, um ihre juvenile männliche Härte zu demonstrieren. Ich war 13 Jahre alt, einer der Jüngsten, und wir stöhnten gewaltig unter den Strapazen. Jossip plädierte ein ums andere Mal für leichtere Routen und mehr Pausen, um uns Knirpse zu schonen. Das gipfelte schließlich darin, dass der Anführer unseres Pfadfinderstamms ihn abends am Lagerfeuer niedermachte und ihm roh sein Pfadfindertuch vom Hals nahm. Ich habe diese entwürdigende Szene nie vergessen.
An Jossip habe ich auch gedacht, als ich 1984 in Bethel, einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Maine, die Mission meines Lebens formulierte, ich komme gleich darauf zurück. Jossip war einer, der aufgrund seines charakterstarken Einsatzes für Schwächere entehrt wurde. Dass ich dagegen in den Pyrenäen als kleiner Pimpf nichts tun konnte, beschämte mich.
Haben Sie schon einmal von Viktor Frankl gehört? Eine internationale Koryphäe der Neurologie. Seine Schriften habe ich in jungen Jahren verschlungen – allem voran sein 1946 erschienenes Buch »… trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager«. Frankl hat vier Vernichtungslager überlebt, darunter Auschwitz. Und er hat eindrucksvoll beschrieben, wie man unter erbarmungslosesten Umständen bei sich bleiben oder sogar zu sich finden kann. Er verfasste 32 Bücher, die in 49 Sprachen erschienen, gilt als Begründer der Logotherapie und hatte am Ende seines Lebens 29 Ehrendoktorate erhalten.
Warum erwähne ich das? Weil ich eine Lanze brechen will für all jene, die ihr Schicksal nicht unguten Umständen in den Schoß legen, sondern ihr Leben und mithin ihr Potenzial in die Hand nehmen und entfalten. Und diese Potenzialentfaltung hat immer damit zu tun, wie viel Angst ich vor Unbekanntem habe. Und wie man Angst bewältigt: Indem man durch sie hindurchgeht. »If you’re going through hell, keep going«, hat Winston Churchill gesagt.
Gehaltvoller hat es der legendäre Verhaltenspsychologe David McClelland formuliert. Zu ihm bin ich Anfang der 1990er Jahre nach Boston gepilgert; ich wollte mehr darüber erfahren, wie Leistungsexzellenz entsteht. McClelland zufolge spielen bei der Selbstmotivation vier zentrale Motive eine Rolle: Macht (power), Leistung (achievement), sozialer Anschluss (affiliation) und Angst vor dem Versagen (need for avoidance). Eines davon ist laut McClelland bei jedem Menschen das Hauptmotiv. Meines ist unschwer zu erkennen: aus einer Nichtakademikerfamilie ist mir der Aufstieg (hart gesagt: der Ausstieg) gelungen. Meinen Antrieb, Spitzenleistung zu zeigen, habe ich bis heute nicht verloren. Tag um Tag wächst mein Widerwille gegen all diejenigen, die mit persönlichem Mittelmaß oder Schlimmerem das Leistungsprinzip untergraben und damit nicht nur sich selbst in den Abstieg führen, sondern auch andere in unserem Land.
Ich bin selbst alles andere als furchtlos. Ich ängstige mich um meine Nächsten, wenn sie krank sind. Ich fürchte mich vor Schlangen und vor dem Tod. Aber ich bin oft bereiter als andere gewesen, neue Territorien zu betreten und mir dort meine Meriten zu erwerben.
Im Alter von Ende 20 kam ich auf die Idee, meine Gedanken über persönliche und berufliche Lebensgestaltung aufzuschreiben. Es reichte mir nicht, nur mein berufliches Umfeld auf subtile Weise zu beeinflussen. Ich wollte prägen! Mit einem gedruckten Buch und Luther’scher Unerschütterlichkeit im Dogma.
Über zwei Jahre lang schrieb ich mit zwei Co-Autoren an dem 1981 erschienenen Werk »Life-Styling. Dem Leben einen Sinn geben«. Ich habe darin entwicklungspsychologische Kapitel verfasst über Fragen, wie man zum Produkt seiner Umwelt wird und wie man umgekehrt seine Umwelt prägen kann. Wir forderten unsere Leser auf, die eigene Begräbnisrede zu schreiben und sie mit anderen zu besprechen, um sich Lebensziele vor Augen zu führen und dazu Feedback zu erhalten. Ein Projekt, für das man sich im hektischen eigenen Alltag durchaus Zeit nehmen muss, wenn man Kurs halten will.
Finde dein Lebensthema!
Im Jahr 1984 bin ich auf ein Selbstfindungsseminar in das eben schon erwähnte Bethel im US-Bundesstaat Maine gefahren. Am National Training Laboratories Institute for Applied Behavioral Science (1947 gegründet und Wiege der Gruppendynamik und Organisationsentwicklung) legten wir uns auf den Boden auf eine große Pappe; jemand anderes hat dann unseren Umriss eingezeichnet wie bei einem Mordopfer. Und in diesen Umriss mussten wir schreiben, wozu wir auf der Erde waren. Ich schrieb:
I myself stand for honesty, clarity and justice especially for the needy ones, the weak and the poor. I want to enrich and contribute in humanizing the culture of my organization. I do this by creating an environment for people to link, share ideas and create creative solutions. In this process I am infusing people with my enthusiasm, heartblood and energy. By accepting the help of my friends I ensure my health and my ability to love.
Ich muss schon schmunzeln, wenn ich das lese. Ganz so schwülstig würde ich das heute nicht mehr formulieren. Und ich habe seitdem etliche Sünden, Fehler und Irrungen begangen. Im Alter von 35 Jahren und als einfachem Abteilungsleiter war mir noch nicht klar, dass man auf dem Weg zum Topmanager fast zwangsläufig einiges an Unschuld verliert.
Denn im Management begegnen einem ja nicht nur Wachstum, Potenzialentfaltung und steigende Börsenkurse. Ein Gutteil der Arbeit besteht aus Restrukturierung, Effizienzsteigerungen, Rationalisierung, Kostensenkung. Das erleben heute auch die US-amerikanischen Digitalgiganten, die sich über die Jahre von Innovationslaboren in Effizienzmaschinen gewandelt haben. Transformation ist nicht nur gut und edel, sondern mindestens genauso oft schmerzlich und derb.
Ich habe Werke in Deutschland schließen müssen, Tausende Jobs ins Ausland verlagert und immer wieder harte Arbeitskämpfe mit den Gewerkschaften ausgetragen. Mit Ausnahme eines Conti-Werks in Hannover stand ich aber in der Sache immer dahinter. Wir haben Restrukturierung nie betrieben, nur um die Gewinne für die eigene Tasche zu steigern – so oder ähnlich lautet ja oft der böse Vorwurf. Sondern wir haben unser Unternehmen im internationalen Wettbewerb klug und wetterfest aufstellen wollen. Manchmal muss man einen Arm oder ein Bein amputieren, damit der Mensch überlebt. Dieses Prinzip aus der Notfallmedizin gilt auch in der Krisenökonomie von Unternehmen.
Mit all diesen Abstrichen glaube ich aber: Im Kern habe ich in meinem Berufsleben das Muster leben können, das ich mir in Bethel vorgenommen hatte. Auf Basis meiner Gedanken über die eigene Transformation und meiner Erfahrungen in Bethel entwarf ich jeweils bei meinen Arbeitgebern MTU, Daimler-Benz Aerospace und Lufthansa ein neues Geschäftsfeld der Personalentwicklung: die lebensphasenorientierte Personalentwicklung.1 Dazu gehörten Seminare wie »Krise in der Lebensmitte« oder »Vorbereitung auf den Ruhestand« oder Hilfe für junge Menschen in der Quarterlife-Krise, in der sie darüber nachsinnen, ob es für sie überhaupt einen richtigen Job geben kann.
Potenzialentfaltung sowie Aufbau und Nutzung von Humankapital in Transformationsphasen wurden meine Lebensthemen. Letztlich ist Humankapital nichts anderes als der kollektivierende betriebs- und volkswirtschaftliche Blick auf individuelle Potenzialentfaltung. Dass dieser Begriff im Jahr 2004 zum Unwort des Jahres erklärt wurde, empfinde ich bis heute als Skandal. Natürlich sind Menschen kein Kapital! Gleichwohl sind Wissens- und Erfahrungskapital in einem ökonomischen Kontext legitime Begriffe.
Meine eigenen Reflexions- und Auszeiten bestanden immer darin, zu lesen, zu sinnieren und zu schreiben, also kräftig armchair theorizing zu betreiben, mich in einem bequemen Fauteuil oder am Hotelpool auf den intellektuellen und seelischen Hosenboden zu setzen, dabei Gedanken zu entwickeln und sie am Ende zu prägen in gedruckte Texte. Voraussetzung ist natürlich, dass man in der Vielfalt der Ereignisse, die man erlebt oder mitgestaltet, Muster erkennt, über die nachzudenken sich lohnt.
Die eigenen Erfahrungen aufzuschreiben und daraus rückblickend allgemeine Schlüsse für andere zu ziehen, darin war ich immer gut und auflagenstark. Auf meine zukunftsschauenden Bücher indessen bin ich allerdings bis heute sehr viel stolzer und stoße immer noch auf moderne Anregungen darin. Aber diese Werke fanden deutlich weniger Leser.
Wenn man ein Sachbuch schreibt, legt man im Grunde nichts anderes an als eine Landkarte für bislang unzulänglich erforschtes Territorium: einen Dschungel, in den es Schneisen zu schlagen gilt. »The map is not the territory«, hat der polnisch-amerikanische Semantiker Alfred Korzybski gesagt. Damit meinte er, dass die Landkarte immer nur eine Reduktion, ein bestimmter Blick auf den Dschungel sein kann, aber nie die Realität selbst. Gleichwohl hat mir persönlich das Zeichnen der Schneisen, Trampelpfade, Wege und Begrenzungen immer sehr geholfen. Denn so habe ich mich dem Territorium praktisch annähern können. Oder ich habe, nach intensiver Begehung, Muster ableiten und damit die Landkarte erstellen können. Ein Territorium ohne Karte ist so sinnlos wie eine Karte ohne Territorium. Außer, man möchte Berater werden …
Work-Life-Balance: oft Fluchtweg der Müden und Trägen
Meine Themen entstehen in Auseinandersetzung mit mir selbst. Ich bin mein eigener Sparringspartner. Und es war mir zeitlebens wichtig, meine Profession mitzuprägen und mehr zu hinterlassen als Fußstapfen im Schnee.
Und so beginnt auch meine Antwort auf die Frage, warum ich mich nach einem langen und erfolgreichen Berufsleben nicht darauf einlassen wollte, die oft beschworenen Früchte meiner Arbeit zu genießen. Ich hatte das Ende meiner eigenen Transformation noch nicht beschlossen! Beruflichen Erfolg habe ich nie als Mittel begriffen, um mir ein angenehmes Leben zu bereiten. Wie ein Hund leide ich, wenn Potenzial brachliegt. Am allermeisten, wenn es um mein eigenes Potenzial geht.
Ich kann nicht im Liegestuhl liegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ich will selbst ein guter Mann sein. Und der ruht nicht, sondern erschafft etwas Sinnvolles. Das Arbeitsethos der Calvinisten hat mir immer imponiert. Was Buße angeht, da bin ich eher Katholik.
Etliche meiner ehemaligen Topmanager-Kollegen haben sich nach der Pensionierung eine Finca unter südspanischer Sonne zugelegt und ergehen sich jetzt in der Gartengestaltung oder dem Golfspiel. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann ja auch mit dem Begriff Ruhestand nichts anfangen, sondern habe ihn für mich immer als aktiven Unruhestand definiert. Es enden doch die Talente und Begabungen nicht fristgerecht mit dem 65. Geburtstag!
In meinem Lifestyling-Buch von 1981 habe ich zum ersten Mal Gedanken aufgeschrieben über die Balance von Arbeit, Freizeit und Ruhe. Ruhe liegt mir überhaupt nicht. Ich erkenne an, dass andere Menschen ganz offenbar das Bedürfnis danach haben. Nicht ganz ausreden lasse ich mir allerdings, dass das Ruhebedürfnis bei vielen gesunden Menschen geringer wäre, hätte sie oder er sinnstiftendere Aufgaben.
Mein mangelnder Ruhebedarf fußt, wenn Sie mich fragen, vor allem darauf, dass ich Arbeit nicht als lästige Pflicht definiere, sondern als Chance, etwas zu erschaffen. Genau so breit ist mein Begriff von Arbeit im gesellschaftlichen Rahmen. Arbeit, das ist nicht nur die tarifgebundene Festanstellung. Sondern genau so die in einer Familie für Jung und Alt anfallende Care-Arbeit, Engagement im Ehrenamt oder Unternehmertum und Gründung. Man ist gefordert, ständig neue Herausforderungen zu lösen. Und diese gestalterische Tätigkeit im Überwinden von Hürden ist eine konstitutive Bedingung dafür, Mensch zu sein. Da gibt es auch keine starren Grenzen zwischen Lebenssphären. Fortschrittliche Organisationen, Unternehmen, Verwaltungen wissen das.
Anfang März 2022 ließ ich mich als Parlamentarischer Staatssekretär im Magazin Human Resources Manager mit dem Satz zitieren: »Work-Life-Balance ist ein Konzept für Menschen, die ihre Arbeit als nicht sinnvoll empfinden.« Der Personalrat des Bundesforschungsministeriums forderte mich daraufhin auf, um Entschuldigung zu bitten, mein Zitat widerspreche den Grundsätzen des Hauses.
Ich entgegnete, kein Interview über den öffentlichen Dienst gegeben zu haben, sondern über Personalarbeit in Wirtschaft und Verwaltung. Ein allein seligmachender Weg der Lebensführung sei mir fremd. Und im Übrigen seien mir im Ministerium etliche Menschen bekannt, die zwischen Arbeit und Leben gar nicht böse trennten, sondern richtig litten unter dem Work-Life-Dogma, das schließlich nur so sprühe vor Mittelmaß. Der Personalrat beschwerte sich sodann über mich bei meiner Ministerin. Die entschied, ich hätte nicht für das Ministerium gesprochen, sondern mich persönlich geäußert.
Gefragt habe ich mich damals schon, wie tief sich die Work-Life-Ideologie schon in die Gehirne gefressen haben muss, dass Arbeitnehmervertreter selbst dann auf die Barrikaden gehen, wenn die Realitäten ganz andere sind. Selbst die Analysen und Studien des roten Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) arbeiten immer wieder heraus, dass eine Hälfte der arbeitenden Bevölkerung nicht primär der Work-Life-Balance anhängt, sondern sich das Leistungsprinzip zu eigen macht. Die Antwort findet sich wohl in der selektiven Wahrnehmung eines Gremiums, das überwiegend mit Problemen konfrontiert ist und Chancen kaum noch sieht.
Klar, ich liebe plakative, provozierende Sätze. Und natürlich weiß ich, dass es zahllose Jobs gibt, in denen Menschen unterbezahlt sind, leiden und manchmal sogar daran zugrunde gehen. Deshalb liegt mir so sehr daran, Wege aus solchen Jobs heraus zu suchen. Das ist eine viel bessere Methode als das vermeintlich fürsorgliche Vorgehen linker Politiker, die prekäre Jobs vor allem mit Geld einzuhegen trachten. Wer wirklich helfen will, muss an die Wurzel. Der muss Bedingungen schaffen für sinnvollere Arbeit, in der Menschen gestalten und sich weiterentwickeln können. Dazu später mehr.
Ich würde gerne mehr Aufraffen spüren. Stattdessen ergießt sich die zähe Work-Life-Soße über unser Land. Arbeit brandmarken immer mehr Zeitgenossen als etwas, das unserer Gesundheit abträglich ist, von dem sie sich möglichst fernhalten wollen. Selbst hochbegabte, leistungsfähige und -willige Menschen lassen sich von dieser Ideologie mittlerweile domestizieren. Weder die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin würden mit Work-Life-Ideologie ihre Ziele erreichen noch die Lufthansa-Krisenteams oder die Tesla-Mitarbeiterschaft in Brandenburg. Sich aufzuraffen, anzupacken, nachhaltig Leistung zu bringen: Das müssen wir bereits in sanfteren Zeiten trainieren – nicht erst dann, wenn es nicht mehr anders geht.
Aus dem Niedergang der antiken Zivilisationen Roms und Athens lässt sich bis heute einiges lernen. Der Tipping Point, an dem eine Nation zerbricht, ist dann gekommen, wenn ihre innere Leistungskultur und -moral so verludert sind, dass auch ihre institutionelle Hülle, ihr rechtlicher und militärischer Rahmen keinen Widerstand mehr leisten können gegen Feinde von innen oder außen.
Sinnvolle Arbeit schafft Lebenssinn. Bekämpfen müssen wir sinnlose Arbeit!
Im Magazin brand eins erschien 2014 das Porträt »Der getaktete Mensch« über mich. Autor Harald Willenbrock beschreibt mich als rastlosen, getriebenen Zeitgenossen, der von der Arbeit nicht lassen kann. Dass mir Müßiggang sinnlos vorkommt und ich nicht nach schierem Zeitvertreib giere, sondern nach sinnvollen Aufgaben strebe – das hat er für meinen Geschmack nicht ganz so gut herausgearbeitet. Vielleicht hat er aber auch schlicht die Depression hinter all meinen Aktivitäten erkannt?
Mein durch nichts zu bremsender Schaffensdrang mag auf andere zwanghaft wirken, für mich ist er Lebenselixier. Ich verstehe mich nicht in erster Linie als Arbeitstier, sondern als einen Menschen mit Talent, etwas zu bewirken – hoffentlich genügend Gutes! Und ein solches Talent gebe ich nicht freiwillig an der Garderobe ab. Hinzu kommt bei mir: grenzenlose Neugier, vor allem auf bislang nicht entdeckte eigene Fähigkeiten. Die offenbaren sich nur, wenn man aus seinen Routinen ausbricht, unbekanntes Terrain betritt und schaut, was mit einem passiert.
Vakuum in meiner Transformation hat mich depressiv gemacht
Nach meinem Ausscheiden bei der Telekom habe ich mich nicht sofort in die Politik gestürzt. Ich habe mir eher leichte Beschäftigungen gesucht und mir einen Rucksack voller Aufsichtsratsmandate, Beiratsfunktionen und zivilgesellschaftlicher Projekte zugelegt. Mein Engagement für die Nationale Initiative MINT Zukunft und für den NewWork-Award zum Beispiel, bei der Hochschulallianz für den Mittelstand, im Beirat für Innere Führung der Bundeswehr, beim Deutschlandstipendium. Mit TUM-Professorin Isabell Welpe habe ich in München Change-Kongresse organisiert über die Zukunft Deutschlands, über MINT und Diversity und das Demokratische Unternehmen mit jeweils mehr als 1000 Teilnehmern.
Beim Automobilzulieferer Faurecia saß ich dem Aufsichtsrat vor. Nach meinem Gastbeitrag »Wir hier oben« in der Zeit im Juni 2016 über Macht und Selbstherrlichkeit der Volkswagen-Chefetage hat man mich auf Betreiben ebenjener Etage freundlich aus dem Aufsichtsrat hinauskomplimentiert. Dies hielt mich nicht davon ab, über meine »Führungszeugnis«-Kolumne im manager magazin und in etlichen Gastbeiträgen in großen deutschen Zeitungen Wirtschaft und Gesellschaft intensiv und ohne Furcht vor Königsthronen zu kommentieren oder hart aufzuspießen – aber eben nur von der Seitenlinie.
All dies waren Schiffchen auf dem See, die ich vom Ufer aus dirigieren konnte, so dass sie mir einen sinnerfüllten, aber nicht ganz so strapaziösen Unruhestand ermöglichen würden. Leider hat mich dieses Leben schnell tödlich gelangweilt. Mir fehlten eine verbindende Idee und der Spirit, an einem wirklich fordernden Projekt zu arbeiten. Meine Energie war nicht fokussiert, sondern löste sich in die Einzelteile meiner Schiffchen auf. Es fühlte sich sinnlos an.
Die Wucht, die so ein Vakuum auslöst, hatte ich völlig unterschätzt. Ich ritt keine großen Apparate mehr, war nach Jahrzehnten selbstgewählter härtester Arbeit ein industrial organization man außer Dienst. Die Realitäten am großen Rad gestalteten nun andere. Stück für Stück ergriff eine Depression von mir Besitz.
In diesen Jahren zwischen 2012 und 2014 begann ich plötzlich, Friedhöfe rund um München und Starnberg zu besichtigen, um mir ein Grab auszusuchen, weil ich dachte, bald sterben zu müssen. Mit 72 Jahren war mein Vater gestorben, mit 72 würde ich es ihm gleichtun, redete ich mir ein. Dabei war meine Mutter damals schon 88, Anfang 2023 ist sie 98 Jahre alt. Und ich zähle seit dem Sommer 2023 schon 74 Lenze und habe Anfang dieses Jahres beschlossen, mir noch mindestens zehn Jahre zu gönnen.
So hängt die Innen- und die Außenwelt eines Menschen zusammen inklusive ihrer Stimuli oder Destimuli von außen oder innen. Es ist ja keine große Neuigkeit mehr, dass viele derer später psychisch litten, die die sozialdemokratische Wohltat der Rente mit 63 zunächst dankbar ergriffen hatten.
Ich begann, mich selber am Schopf zu packen und Stück für Stück aus dem Trübsalssumpf zu ziehen. Am Anfang standen umfassende Gesundheitschecks bei Allgemein- und Fachärzten, die mir allesamt bescheinigten, in Saft und Kraft zu stehen.
Das passte zur allgemeinen Aufbruchstimmung der damaligen Zeit. Im vergangenen Jahrzehnt sprossen die Zukunftsvisionen der Start-up-Szene nur so aus dem Boden. Christian Lindner brillierte auf sogenannten Fuck-up Nights, in denen Gründer von ihren Erlebnissen des Scheiterns erzählten und bejubelt wurden. Die Gründerszene brodelte, etablierte Unternehmen bauten begeistert Innovation Labs. Und etliche deutsche Manager und Chefredakteure pilgerten ins Silicon Valley. »Warum hat Deutschland so viele Automobilhersteller und nur eine SAP?«, rief ich 2013 bei einem Vortrag an der Universität Paderborn. Auf diese Frage gibt es übrigens bis heute viele deprimierende Antworten. Ein stabiles Software-Spielbein hat die deutsche Volkswirtschaft noch immer nicht.
Wer Aufbruch wagt, muss die Tragfähigkeit seiner Zukunftsoptionen prüfen
Innovationshungrig begann ich, mein neues Lebensphasen-Projekt Politik ernsthaft voranzutreiben. Klären musste ich zuerst, in welche Partei ich eigentlich eintreten wollte. Das habe ich nicht nach Bauchgefühl entschieden, sondern mich ernsthaft mit Parteigranden und -programmatik auseinandergesetzt und wie ein guter Manager systematisch meine Optionen geprüft.
Peter Tauber, damals CDU-Generalsekretär, und ich haben uns intensiv über das Thema Personalentwicklung ausgetauscht. Im Raum stand die Frage, ob ich hierzu für die Konrad-Adenauer-Stiftung ein Projekt aufsetze. Leider wurde mir im Laufe der Gespräche immer klarer, dass die CDU im Kern eine macht- und keine talentorientierte Organisation ist. Wer in einer politischen Partei systematisch um der Macht willen Talent blockiert, transformiert nicht die Zukunft des Landes. Nichts für mich.
Mit Frank-Walter Steinmeier, damals Außenminister, habe ich über ein mögliches Engagement in der Karl-Schiller-Stiftung gesprochen und mich mit dem rot-grünen Thinktank Progressives Zentrum auseinandergesetzt. Steinmeier hatte zwar einen guten Vorschlag gemacht, wie sich Politik und Wirtschaft besser vernetzen können. Aber er meldete sich nie mehr. Ich war darüber froh, zumal die Jungsozialisten den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück zwangen, im Zuge seiner Honorarskandale politisch immer weiter nach links zu rücken. Beim Progressiven Zentrum erkannte ich in punkto Zukunft der Arbeit gute innovative Ansätze. Aber alles brach wie ein Kartenhaus zusammen und fiel zurück in ideologischen Kadavergehorsam, als Arbeitsministerin Andrea Nahles sich in diesem Gremium blicken ließ. Wer so schnell unter dem Ukas einknickt, taugt nicht für den transformatorischen Aufbruch.
Die CSU kam für mich ohnehin nicht in Frage, obwohl ich seit mehr als 30 Jahren in München lebe. Diese Partei hielt und halte ich für charakterlich verdorben. Ich hatte wenige persönliche Begegnungen mit CSU-Gremien, die deutlich empfindlicher als alle anderen reagieren, wenn man sie hinterfragt. Mein Eintreten für mehr Diversität sei unpatriotisch, schallte mir noch vor wenigen Jahren mimosenhaft auf einer CSU-Präsidiumssitzung entgegen. Kurz darauf beschloss die CSU ihr folgenloses Frauenquorum. Diese Partei ist eine geschlossene, skandalgeschwächte Kaste, die immer noch von Strauß’schen und Stoiber’schen Innovationsnarrativen lebt.
Die von ihrer Ideologie oft so beseelten Grünen habe ich nie wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Während mich die Friedrich-Ebert-Stiftung etliche Male einlud zum intensiven Austausch, war ich bei der Heinrich-Böll-Stiftung nur einmal zu Gast und ohne jeglichen Nachhall. Das Interesse war wohl beidseits gering – bis heute. Ich habe meine ideologischen Verirrungen in jungen Jahren nicht vergessen; gegen die Verführungen einer grün gefärbten, vermeintlich besseren Welt bin ich immun.
Bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gestaltete es sich von Beginn an erfreulicher. Mit Hauptgeschäftsführer Steffen Säbisch, heute Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, tauschte ich mich damals intensiv aus über Zukunft der Arbeit, Bildung und Talententwicklung. Ich arbeitete bei Podcasts und an Policy-Papieren mit. Eine bereichernde Zeit, eine intelligente für Transformation offene Kultur, die mich ansprach. Klar war mir von Beginn an, dass keine Partei die alleinige Erlösung bietet. Am wenigsten Kompromisse, das kristallisierte sich aber immer weiter heraus, würde mir die Programmatik der FDP abringen. Außerdem roch es hier nach Aufbruch. Wenn ich Jungen Liberalen heute erzähle, dass ich mich dereinst für das kleinste Übel entschieden habe, rollen sie oft die Augen. Sie verstehen noch zu wenig von Karl Popper’scher Skepsis.
Wann es war, weiß ich nicht mehr genau. Aber in jedem Fall war es noch vor den Bürgerschaftswahlen in Hamburg und Bremen Anfang 2015, bei denen die FDP zum ersten Mal seit ihrem Sturz ins Bodenlose anno 2013 wieder Wahlerfolge erzielte. Ich schrieb Christian Lindner, damals in der Opposition im Düsseldorfer Landtag, und bot ihm an, die liberale Sache zu unterstützen. Ob die FDP wirklich wieder würde aufstehen können, das war damals noch eine reine Hoffnung. Und deshalb ist mir der Zeitpunkt wichtig. Ich habe mich zur FDP bekannt, als sie noch ein Sanierungsfall war.
Lindner antwortete flugs und schlug ein Treffen vor. Irgendwann im Jahr 2015 wurde ich FDP-Mitglied und engagierte mich weiter kräftig in der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und meine Bundestagskandidatur? Es passierte: nichts. Längst hatte ich gemerkt, dass ich mir ein weiteres Mal in meinem Leben alles selbst erkämpfen musste.
Wer Zukunft machen will, braucht die Jungen
Mein Transformations- und Gestaltungsdrang war immer davon gespeist, dass ich große Freude am Experimentieren hatte. Und dies mit Menschen, die frischen Geistes und meist jung waren. Und manchmal hat man Glück im Leben. Zu meiner Website thomas-sattelberger.de kam ich fast wie die Jungfrau zum Kind. Tobias Stüber, damals Ende 20 und aus Trier, hatte meine Autobiografie gelesen und fragte, ob er und sein Chef sich einmal mit mir austauschen könnten. Ich lud die beiden im Juli 2015 auf unser Seegrundstück ein. Der junge Mann riet mir immer vehementer zu einer eigenen Website, und ich lehnte immer energischer ab – bis ich ihn drei Tage später anrief. Wenige Wochen später standen er und seine zwei Freunde Michael Krump und Jan Weber erneut auf der Matte und präsentierten mir meine Website. Ich war begeistert.
Mit diesen drei jungen Leuten, die erste Generation meiner Social-Media-Crew, baute ich nicht nur meine Website immer mehr aus, sondern wagte ab August 2016 auch erste Schritte als Jungpolitiker auf Facebook. Bislang war ich nur auf Twitter präsent gewesen.