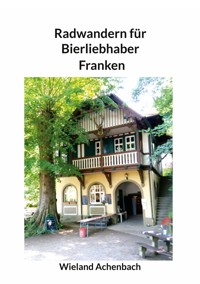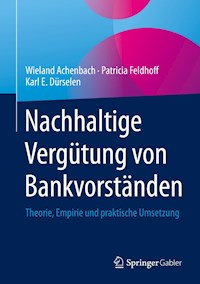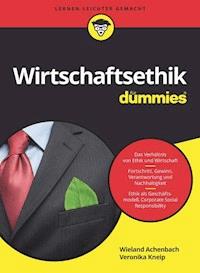Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bierathlon at its best. Die Autoren beschreiben 29 Radwandertouren zu Kleinbrauereien, mit 138 Bildern von den Touren und Adressen der Brauereien und ihrer Gasthöfe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank an alle Brauer/-innen Deutschlands
Die Autoren geben persönliche Eindrücke und Einschätzungen wieder, die sich von denen anderer Personen unterscheiden können. Insofern geht es zuweilen auch um geschmackliche Unterschiede, um subjektive bzw. intersubjektive, nicht um objektive Wahrheit. Eine Herabsetzung Einzelner – auch durch Erhöhung anderer - ist nicht beabsichtigt. Fehler in der Darstellung (z.B. über Wege oder Inhaltliches zu den Brauereien) und Veränderungen im Zeitablauf (das Beschriebene erstreckt sich über einen Zeitraum von 4 Jahren) sind nicht komplett auszuschließen und liegen in der Verantwortung der Autoren. Bitte teilen Sie uns Fehler oder aktuelle Veränderungen mit; wir korrigieren dies - so es eine neue Auflage geben wird – gerne.
Inhaltsverzeichnis
Radwandern in Bier-Deutschland
Bier-Deutschland ist eine Kulturlandschaft
Radwanderführer für Bierliebhaber II - Bayern und Deutschland
Persönliches über Geschmack
Goldene Regeln
Bierathlon
Öffnungszeiten
Übernachtungen
Suchen, Finden und Wege
Ausrüstung und Kondition
Karten und Brauereiführer
Die Radwandertouren
Tagestouren
Ausfahrten mit Übernachtung(en)
Zum Schluß
185 Hausbrauereien to ride before you (they) die….
Adressen der Brauereien und Gasthöfe
Links
Literatur
Karten
A. Radwandern in Bier-Deutschland
I. Bier-Deutschland ist eine Kulturlandschaft
Deutschland ist schön, wie es in der Werbung einer großen Weißbierbrauerei heißt und so schön ist auch die Vielfalt seiner Brauereilandschaft und der angebotenen Biere, über 6000 verschiedene.
Ostfriesenbräu in Bagband im Fehnland
Diese Vielfalt ist allerdings vielerorts und insbesondere in den Großstädten kaum mehr sichtbar und geniessbar. Dabei ist Bier - abgesehen vom Massenkonsum über das Allerweltspils und helle Export, seine starke Bewerbung, seine überall, teilweise weltweit bekannten Marken und deren Dominanz in der Wahrnehmung hinaus - etwas Regionales, Ländliches. Bier braucht Heimat.
Kurz was zur Struktur
Denn in Deutschland gibt es nicht nur etwa 25 überaus bekannte, sondern rund 1350 Brauereien, ca. die Hälfte davon in Bayern, alleine in Franken, d.h. Ober-, Mittel- und Unterfranken fast 300 (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_aktiver_Brauereien_in_Deutschland ; Liste der aktiven Brauereien). Alle brauen nach dem deutschen Reinheitsgebot (Wasser, Gerste, Hopfen,...Hefe, + kleine Helfer), dem ältesten Lebensmittelgesetz der Welt, das 2016 – ein guter Grund, um es mit diesem Buch gebührend zu ehren - 500 Jahre alt wird. Die Globalisierung macht eindeutig vor Bier-Deutschand halt. Ausländisches Bier hat kaum Akzeptanz und Marktanteile, ihre Marken sind oft Exoten. Wenn ausländische Großbrauereien – wie etwa Inbev - Fuß fassen, dann indem sie deutsche Häuser kaufen und ihren weltweit agierenden Konzernen einverleiben. Viele mittelgroße (wir definieren sie mal zwischen 20.000 und 500.000 Hektoliter) kämpfen mit Überkapazitäten, jemand, wir haben vergessen wer, hat mal ausgerechnet, dass alle deutschen Braukapazitäten zusammengefasst, wenn sie produktiv ausgenützt würden, in der Lage wären, ganz England noch mit Bier zu versorgen. Und die Engländer sind trinkfreudig. So leben wirtschaftlich gesund – industrieller Mengeneffekt von economies of scale – die wenigen ganz Großen; einige der mittelgroßen darben dagegen oder werden von den Großen übernommen, ihre Marken fortgeführt. So ist es heute; von der Öffentlichkeit eher unbemerkt, gab es aber bis vor Kurzem ein Brauereisterben auch der Kleinen, insbesondere in Franken. Noch nach dem Krieg waren es Tausende von Brauereien mehr, in Franken hatte nahezu jeder Ort eine, viele mehrere (Von einem Einheimischen in Neuburg an der Donau - ca.30Tsd Einwohner- haben wir z.B. erfahren, früher gab es dort 43, heute noch eine, Julius Bräu). In den 70er Jahren haben Großbrauereien, bspw. Kulmbacher um Bayreuth herum, den Gasthof-Kleinbrauereien das Braurecht abgekauft, und die Gasthöfe – dann nur noch als Zapfenwirte - mit ihrem Bier versorgt. In späteren Jahrzehnten haben viele Brauer und Brauerinnen aus Altersgründen aufgegeben, weil sie keine Nachfolger/in fanden, oder schlicht, weil sie mit dem Brauen kein Auskommen mehr hatten und es neben Gasthof und manchmal Landwirtschaft zu aufwändig war. Heute scheint es so zu sein, dass sich Aufgaben und Neugründungen nahezu die Waage halten.
Wenigen sehr absatzstarken Großbrauereien stehen regional durchaus bedeutsame mittelgroße und insbesondere aber wohl weit über Tausend Kleinbrauereien gegenüber. Von den Kleinen sind einige so klein, dass sie ihr Bier nur im angeschlossenen eigenen Gasthof ausschenken, viele haben keine eigene Flaschenabfüllung, faßen für den Eigenverbrauch, sind reine Handwerksbetriebe wie Bäckereien und Metzgereien, auf den Ort und um den eigenen Schornstein beschränkt. Überregional heißt hier oft im Umkreis von nur wenigen Kilometern. Während industrielle Großbrauereien mit Pils, Export und Weizen um Millionen Hektoliter Ausstoß wetteifern, deutschlandweit bekannt und in Gaststätten, Hotels und jedem Getränkemarkt erhältlich, teilweise exportorientiert sind, produzieren die Kleinen nur wenige Tausend Hektoliter, manche deutlich darunter. Viele von den Kleinen sind traditionelle, teilweise jahrhunderte alte Handwerksbetriebe, über Generationen hinweg von den Eltern auf Sohn oder Tochter übergeben. Eigenständigkeit und Stolz aufs Handwerk bestimmen das ganzheitliche Wirtschaften, oft verbunden mit Landwirtschaft, Gasthof und Pensionsbetrieb - es sind Familienbetriebe. Gerade die Kleinen ohne Expansionsgelüste sind deshalb jedoch oft besser dran. Regionale Verbundenheit, keine oder nur eine kleine Anzahl von Zapfenwirten, hohe Qualität und geschmackliche Unverwechselbarkeit können auch stark machen. Manchmal ist es gut, nicht nur die Kirche im Dorf zu lassen…
Etwas mehr zu Veränderungen
Der Bierkonsum ist seit Jahrzehnten rückläufig. Galten die Deutschen, neben den Tschechen und Österreichern mit teilweise über 145 Litern/pro Jahr und Bürger lange und weit vor anderen Ländern als die Bierkonsumenten Nr.1 in Europa, so liegt der Verbrauch heutzutage - auch wenn dies vergleichsweise immer noch eine beträchtliche Menge darstellt - um 105 Liter/Person.
Ausschank des Brauhauses Spandau
Die Gründe für den Rückgang sind Legion, insbesondere Änderungen in den Konsum- und Lebensgewohnheiten sind zu nennen. Mineralwasser und Kaffee haben Bier vom Platz des Lieblingsgetränks verdrängt, Frauen mögen den mitunter herben Geschmack des dominanten „Pils“ weniger. Jüngere Generationen sind dem Bier und anderen Alkoholika abgewandt, mitunter abstinent und greifen als Durstlöscher lieber zu Mineralwasser und isotonischen Getränken.
Bier ist heute weniger Lebensmittel denn Alkohol und paßt nur schlecht zum Lifestyle of Health and Sustainability. Bevorzugt werden häufig auch alkoholfreie Biere, Biermischgetränke, Alcopops oder koffeinhaltige Brausen, vorzugsweise eines österreichischen Herstellers. Bier ist alles andere als ein „In-Getränk“, wirkt dumpf, macht träge und dick, ist uncool von gestern und wird vornehmlich von Älteren und Männern getrunken. Die Biergartenkultur hat sich zum Glück erhalten bzw. sogar bundesweit ausgedehnt, die Glasgrößen dagegen sind geschrumpft. Gab es noch vor ca. 15 Jahren auf einigen Kellern und Biergärten manchmal nur die Maß, so ist heute der halbe Liter, das Seidla und das 0,4l Glas Normalfall, 0,3 und 0,25l Glasgrößen sind auf dem Vormarsch.
Erwähnenswert ist auch das Gasthofsterben. Hatte früher jeder noch so kleine Ort eine Gastwirtschaft mit Mittags- und Abendtisch, so ist dies aus der Mode gekommen, die stramme und flächendeckende Versorgung mit Fastfood tut ihr Übriges. Viele geschlossene Gaststätten auf dem Land zeugen zum einen von Landflucht, aber eben auch von den geänderten Einstellungen: wer geht schon noch - Ausnahme Franken und Bayern – regelmäßig tagsüber und insbes. am Samstag abend oder am Sonntagmittag in die Gastwirtschaft, ißt und trinkt dazu die obligatorischen zwei oder drei Halbe.
Zum anderen ist zu beobachten, dass auch das sog. Vereinsleben zurückgeht, viele der Wirte klagen deshalb über Umsatzrückgänge und Nachfolgeprobleme; vieles hat sich in den rein privaten Raum des eigenen Hauses zurückgezogen. Die Zahl der Volksfeste bzw. Besucherzahlen, hat sich ebenfalls veringert, zumindest im Norden. Bitte sprechen wir nicht vom punktuellen Münchner Oktoberfest, das hat mittlerweile - wie Venedig oder Neuschwanstein - eher Disneyland- oder RockyHorrorPictureShow-Charakter. Mitunter wird behauptet, dass die über die Jahre verschärfte Alkoholobergrenze für Autofahrer den Bierkonsum habe absinken lassen. Das in fast allen Bundesländern geltende Rauchverbot in Gaststätten wird ebenfalls gerne als Grund angeführt. In manchen Jahren muss selbst ein mehr oder minder ausgebliebener Sommer oder sogar ein frühes Ausscheiden der deutschen Fussballnationalmannschaft für den Rückgang herhalten. Vieles richtig argumentiert, wir neigen dazu, noch etwas anderes in die Waagschale zu werfen: Eintönigkeit.
Denn was trinken wir Deutschen vornehmlich für ein Bier? Gefühlt zu 90% Pils (und Export), industriell hergestellt, ein verwechselbares dem angeblichen Durchschnittsgeschmack angepaßtes „plain vanilla“-Produkt von im internationalen Vergleich annehmbarer, guter Qualität (Die armen Amerikaner und Australier mit ihrem Allerweltsgebräu – Kein Wunder, dass die Craft-Beer-Revolution dort ihren Anfang nahm...), jedoch ohne Ecken und Kanten, ein Standard. Und es wird von uns gerne getrunken, so ist es nicht. Selbst in Franken haben viele Brauereien ein Pils im Angebot. So oft sie aber den Blindverkostungs-Test mit 10 bekannten, marktführenden Pilsmarken wiederholen mögen, kaum jemand – vielleicht mit Ausnahme der Braumeister selbst und der Marken Becks und Jever - wird ein bestimmtes Pils rausschmecken können. Wir können es auch nicht. Und weil der Geschmack, die Farbe und die Anmutung so homogen und in gewissem Grad deshalb austauschbar sind, müssen die Großbrauereien entweder immense Marketingbudgets aufwenden- Bitburger und Krombacher jeweils bis zu ca. 50 Mio€/Jahr -, um die imagestarke Marke dauerhaft im Bewußtsein und den Verbrauch hoch zu halten (nennen wir als Beispiele mal die Marktführer Krombacher, Bitburger, Radeberger, Warsteiner, Kulmbacher u.a.m.); oder, für nahezu homogene Produkte ebenfalls typisch, über einen niedrigeren Preis konkurrieren (z.B. Oettinger und Discounterbiere).
Und gerne wird in der Werbung für das Allerweltsbier ein exklusives, besonderes Lebensgefühl suggeriert, was uns der Konsum verspricht, häufig was mit individueller Freiheit, Natur, Kameradschaft, Geselligkeit, Lagerfeuer und überschwenglicher Freude. Gäbe es das nicht, so behaupten wir, stünden wir vorm Regal und schauten nur auf den Preis oder eine Besonderheit versprechende Verpackung. Sie fahren ja auch nicht zu einer Aral-Tankstelle, weil das Benzin dort besser ist als bei Shell oder Esso, sondern weil sie gut erreichbar und ggf. billiger ist als die Konkurrenz. Und so bleibt beim Bier das Besondere, nämlich das individuelle Geschmacks- und Trinkerlebnis und die regionale Verbundenheit, oft eben aus. Die großen Brauereien, die sehr lange nur Wachstum kannten, sind sich durchaus des Rückgangs bewußt. In der jüngeren Vergangenheit haben sie bereits reagiert. Weizen, ursprünglich eine Domäne süddeutscher Brauereien, gehört mittlerweile bei den meisten Großbrauereien wie selbstverständlich zum Produktportfolio. Ebenso im Trend liegen alkoholfreie Biere und Biermischgetränke. Und der neueste Vorstoß ist nun seit ca.2 Jahren eine Art Rückbesinnung auf „Dunkles“, „Rotes“, „Kupfer“, „Helles Schankbier“ und
Angebot des Marienbräu in Jever
„Kellerbier“, lange wegen der Dominanz des Pils und Export vernachlässigte, und sagen wir wie es ist (und hoffentlich bald Geschichte), auch verschmähte Sorten. Und dann wird von den Großen versucht, Regionalität und Ursprünglichkeit wieder herzustellen, sei es ein Dunkles oder jüngst ein „Kellerbier“ von Krombacher (Im Siegerland gibt es gar keine Bierkeller...) oder der Flensburger Brauerei, das „Grevensteiner“, dem Herkunftsort von Veltins im Sauerland oder ein „Kellerbier“ von Köstritzer. Alle diese Biere schmecken, so ist es nicht; ob sich das flächendeckend durchsetzen wird, d.h. ob die pilskondionierte Kundschaft dies annimmt, bleibt abzuwarten.
Und diese schleichende Teilabkehr vom nur Mainstream Pils/Lager/Export ist ein Phänomen einiger Länder. In Australien, den USA selbst in Frankreich sind Neugründungen sog. Craft-Beer-Brauereien zu beobachten, regionale Klein-und Hausbrauereien. Die Welle schwappt gerade (seit ca. 5 Jahren) in deutsche Großstädte wie Berlin (ca. 15 neue Craft-Beer-Brauer) und Hamburg über, und erreicht nun ebenfalls das klassische Kleinbrauereienland Bayern. Warum jedoch eine Hausbrauerei, ein neu gegründeter Handwerksbetrieb, der Bier braut, nun quasi automatisch “brewery“ und „Craft-Beer“ heißt, bleibt das Geheimnis der Gründer bzw. ist schiere Notwendigkeit, um sich abzuheben. Werbewirksam wird sogar von der „Craft-Beer-Revolution“ gesprochen (z.B. Ratsherren-Bräu, Hamburg), Seiten wie „Hopfenhelden“ und ein neueres Berufsbild, das des „Biersommeliers“ feiern die Gründer – oft Männer zwischen 25 und 40 - wie die Retter der weltweiten Braukultur. Wie auch immer, das Ergebns zählt, diese Neugründungen leben das alte Prinzip von individuellem Geschmack, in der Regel allerdings mit für deutsche Zungen ungewohnten Sorten wie India Pale Ale, Porter oder Stout; gerne kombiniert mit Showroom und Events wie etwa das Konzept „Bierinsel“, eine Art organisierte Bierprobe in Hamburg. Zunehmend auch als Biobier und gerne mit experimentalem und missionarischem Eifer (z.B. Bier-Wein-Hybride oder die Hopfenweisse), fast immer jedoch stark gehopft und mit Betonung der Bittere. Mit der Menge und Verschiedenartigkeit der Hopfensorten wird geradezu frenetisch und fetischartig experimentiert. Der Event steht im Vordergrund, nicht wenige der Craft-Beer-Brauer verweisen darauf, dass ein Sud etwas Einmaliges sei, und der nächste schon wieder komplett anders. Die Brauanlagen stehen dabei gerne sichtbar im Raum, man und frau (muf) kann beim Brauen zuschauen, die Erlebnisbrauerei lädt auch schon mal gerne zum Mitmachen ein. Es besteht Hoffnung auf die Vertiefung des Trends und eine Renaissance der Hausbrauerei und somit wieder zu mehr Vielfalt, was ohne Wenn und Aber sehr begrüßenswert ist.
Im Brauhaus Spandau
II. Radwanderführer für Bierliebhaber II – Bayern und Deutschland
Der „Radwanderführer für Bierliebhaber II - Bayern und Deutschland“ möchte deshalb den Weg suchen zu den alten und neuen Kleinbrauereien und dies verbinden mit Radtouren, sozusagen aktiver Biertourismus vom Rad aus. Wie wir finden, eine angenehme, entschleunigte und ursprüngliche Art des Reisens.
In 16 Bundesländern wären Radwanderungen möglich, die hier vorgestellten Touren sparen einige ohne böse Absicht aus. So finden sich hier Radwanderungen in Schleswig-Holstein, eine im Nachbarland Dänemark, Berlin und Brandenburg (mit Ausritt nach Sachsen-Anhalt und Sachsen), Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg versammelt. Insbesondere Bayern ist wegen der Brauereidichte, der guten Radwege und der Vorlieben der Autoren prominenter vertreten. Franken alleine füllte ein ganzes Buch, vgl. Radwanderführer für Bierliebhaber – Franken, 2.Aufl., 2015. Und ja, nicht nur die Auswahl der Bundesländer ist subjektiv und naturgemäß ungerecht, es konnten von den 1350 Brauereien und ihren Gasthöfen auf den Touren auch nur rund 130 aktiv besucht werden. Eine kleine Auswahl weiterer Kleinbrauereien, die jeden Abstecher wert sind, jedoch abseits der gewählten Radtouren liegen, finden Sie im Anhang.
Unter einer Kastanie im Biergarten sitzen…was ist schöner? Kemnitz bei Werder an der Havel
Die fränkischen und bayrischen Kleinbrauereien sind oft die „alten“, in Norddeutschland – lets say nördlich der Weißwurstgrenze Main - sind es häufiger Neugründungen der letzten 25 Jahre; ebenso in Ostdeutschland, wobei hier zusätzlich der besondere Umstand zum Tragen kommt, dass es oft auch Wiedergründungen älterer Braubetriebe nach der deutschen Vereinigung sind. In jedem Fall sind es in der Regel kleine, nur regional verwurzelte Hausbrauereien.
B. Persönliches über Geschmack
Klar, jeder von uns hat sein Lieblingsbier. Und über Geschmack läßt sich bekanntlich nicht streiten. Jedes Bier – selbst das Industriebier - hat seinen eigenen Geschmack und seine eigene Note. In jüngerer Zeit wird versucht, dies über „Biersommeliere“ auch der Öffentlichkeit zu vermitteln. (Klappt nur noch nicht so recht, anders als bei Wein. Erklärte Weinliebhaber akklamieren in einer ureigenen Überheblichkeit dieses Vorrecht zur Unterscheidung für sich und auf Mitbürger, die lieber Bier trinken, wird gerne mal abschätzig herabgeschaut. Diese Haltung muss noch aus einer Zeit herrühren, als Wein zu trinken entweder verbreiteter oder edel und ein Privileg des Adels und reicherer Bürger war; Bier dagegen das Getränk und Lebensmittel des gemeinen Volkes, des Mannes, seiner Frau und Kinder. Und für die „armen“ Klosterbrüder und -schwestern ein Fastengetränk. Ja, selbst Kinder tranken im Mittelalter mit Willen der Eltern vornehmlich Bier, weil keimfreier als Wasser.) Wenn wir also über Biere berichten, die uns oder unseren Mitfahrern/-innen besonders gut schmecken, so ist dies unsere Einschätzung, die sich von denen anderer unterscheiden kann.
Penning-Zeißler – Ein klassisches Vollbier der Fränkischen Schweiz
Eines ist jedoch gewiß: Die Brauereien und ihre Biere, die hier vorgestellt werden, sind individuell.
Das liegt auch am Willen, die plain vanilla Biere weitgehend zu vermeiden, und so oft es nur eben geht, in einer Hausbrauerei zu übernachten. Insofern nehmen Sie unsere Ausführungen zum Geschmack als eine persönliche Einschätzung hin - bitte pro-Bieren Sie es selbst.
C. Goldene Regeln
I. Bierathlon
Die Sportart heißt Bierathlon, das bedeutet „drink and drive“. Die Verbindung von Radfahren und Biertrinken ist im Grunde heikel. Selbstdisziplinarische Beschränkung ist erforderlich. Die Verkehrsregeln der Straße gelten mit Blick auf den Alkoholkonsum uneingeschränkt auch für Radfahrer und das ist gut so, möchte man doch weder sich noch andere gefährden.
Gutes tun: Biertrinken ist wichtig
Und ob die - gleichwohl aus dem Zusammenhang gerissene - Regel des ehemaligen Ministerpräsidenten Bayerns, Günter Beckstein, man könne nach zwei Maß Bier noch Auto fahren, gilt…wie wir ahnen: wohl eher nicht. Angetütert Rad zu fahren, ist zudem körperlich anstrengend. Wenn muf dann noch etliche Kilometer bis zum Ziel des Tages vor sich hat, kann die Reise lang werden.
II. Öffnungszeiten
Auf die Öffnungszeiten und die angegebenen Ruhetage ist grundsätzlich Verlass. Da es aber überwiegend Familienbetriebe sind, die die Gaststätten betreiben, so ist die Zahl derer, die erst am nachmittag öffnen, nicht gering. Das gilt insbesondere unter der Woche. Samstags und Sonntags – und das ist für die Tagestouren und für die Touren mit einer Übernachtung durchaus ein Standardfall - sind die Öffnungszeiten in der Regel großzügig bemessen, oft ab 10.00 oder 11.00. Zudem dürfen wir aus eigener Erfahrung berichten, dass viele der Gasthöfe den Schulferien folgend insbes. August oder gerne auch von Spätherbst bis ca. März wochenweise Betriebsferien einstreuen. Mitunter ist der Platz an den Tischen knapp, viele bestellen am Wochenende Tische vor. Und deshalb empfiehlt es sich vor einer jeden Tour zum Telefon zu greifen (Tel.nr. im Anhang unter Liste der Brauereigasthöfe/Gasthäuser), und auf Nr. Sicher zu gehen.
III. Übernachtungen- Von rustikal bis de luxe
Das zuvor Geschriebene gilt für die Übernachtungen umso mehr. Die meisten Gasthöfe haben kein oder ein überschaubares Angebot an Schlafmöglichkeiten, insbesondere Einzelzimmer sind vielfach nur wenige zu bekommen. Fahren Sie nicht auf Verdacht, buchen Sie vor. Folgende Klassizierung für die Qualität der Zimmer sei eingeführt: Da ist alles dabei von sehr schlicht, d.h. mitunter mit wenig ansprechendem Interieur, ohne TV bzw. altertümlichem und ggf. Bad auf dem Flur, nun „Rustikal“ genannt, über die große solide Mehrheit: „Standard“, und wenigen „de luxe“ Übernachtungen, etwa mit neu renovierten Zimmern oder W-Lan. In Franken und in Teilen von Bayern liegt der Durchschnittspreis für eine Übernachtung mit Frühstück zwischen ca. 30,- und 55,-€ für ein EZ, seltener darüber. Im Rest der Republik, so möchten wir nach unseren bisherigen Erfahrungen mutmaßen, gehen Sie bitte eher von 40,- bis 75,-€ aus. Die Preise sind dem Angebot und der Ausstattung entsprechend fair und akzeptabel. Die mehrtägigen Radtouren sehen alle Übernachtungen an den Zielorten von Etappen vor. Es sind dies in der Regel Brauereigasthöfe, die eben neben Essen und Trinken auch Übernachtungen anbieten. Ausnahmen von der Regel finden vornehmlich dann statt, wenn die Brauereidichte nicht so hoch ist (Bspw. Tour 21, Berlin/Brandenburg). Als Radwanderer sind wir für jede Übernachtungsmöglichkeit dankbar, dies sei betont.
IV. Suchen, Finden und Wege
Apropos Suchen und Finden, einfacher ist diese goldene Regel: Der Brauereigasthof ist fast immer in der Nähe der Kirche und damit in der Nähe der Dorfmitte oder des Marktes von Städten. Dies gilt für Süddeutschland fast uneingeschränkt, für Nord- und Ostdeutschland ist das allerdings deutlich seltener der Fall, da stehen sie häufiger frei in der Stadt oder sogar am Ortsrand, z.B. sind es umfunktionierte Mühlen. Die ausgewiesenen und gepflegten Radwege sind in den letzten Jahren nicht nur deutlich mehr geworden, sie sind auch oft neu und besser. Das gilt jedoch beileibe nicht überall. Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen sind in unseren Augen vorbildhaft, ebenso ist es in Norddeutschland überwiegend gut. Nur ein wenig fällt der Osten ab, wo häufiger noch alte Betonplatten vorkommen, bzw. mehr als anderswo Nebenstrassen und gepflasterte Ortsdurchfahrten gleichbedeutend mit Radwegen sind.
V. Ausrüstung und Kondition
Gute Tourenräder sind hilfreich. Klassisch oder so wie einige von uns als Pedelec. Letzteres wegen doch einiger Steigungen mitunter hilfreich, wenn muf Kniee hat oder nicht so trainiert ist. Es geht aber auch gut ohne; nahezu alle Touren sind, weil es meistens nicht übermäßig viele Kilometer/Tag sind, mit wenig Kondition fahrbar. Wenn mal eine längere Strecke auftaucht, dann schlagen wir Ihnen vor, diese bei Bedarf zu teilen. Der eine oder die andere wird kürzere oder längere Routen bevorzugen, manchmal werden Varianten vorgeschlagen, es gilt jedoch: finden Sie Ihr eigenes Tempo.