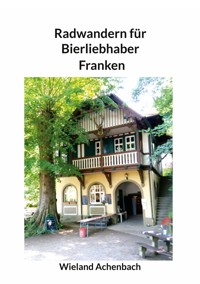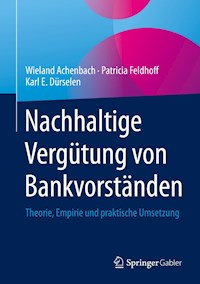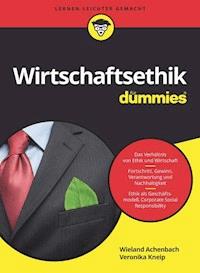
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Das Buch gibt einen kompakten Überblick über die Wirtschafts- und Unternehmensethik und bereitet Studierende der BWL/VWL auf Prüfungen im Bachelor vor. Die Autoren beschreiben die Regeln unseres wirtschaftlichen Zusammenlebens sowie die effiziente und gerechte Nutzung knapper Ressourcen theoretisch und realitätsnah anhand von Beispielen. Sie thematisieren und analysieren ethische Diskussionen und Konflikte im Widerstreit von Egoismus, Fortschritt, Altruismus, Gesellschaft sowie Rechtssystem und stellen Strategien für Lösungen vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wirtschaftsethik für Dummies
Schummelseite
ORGANISATION DES ZUSAMMENLEBENS
Im Folgenden finden Sie Definitionen der zentralen Begriffe in unserem Buch Wirtschaftsethik für Dummies:
Menschenrechte: Zentrale Menschenrechte sind das Recht auf ein Leben in Würde, Freiheit, Gleichheit und die Chance auf Entfaltung der Persönlichkeit, auf ein Streben nach Glück und Wohlstand. Die Wirtschaftsethik fragt, ob Menschen in der Wirtschaft fair behandelt werden, ob sie ein glückliches Leben führen können oder nicht.Fairer Tausch: Wirtschaftsethik beschäftigt sich mit fairen Regeln beim Tausch. Ein Tausch gilt als fair und gerecht, wenn er beiden Seiten einen Vorteil bringt. Konflikte entstehen in der Wirtschaft als Ort des Tausches, wenn ein Tauschpartner den anderen übervorteilen kann und das auch tut. Die Möglichkeit, jemanden zu übervorteilen, kann mit Macht verknüpft sein.Werte, Moral und Regeln: Werte beschreiben von Menschen geteilte Vorstellungen. So ist etwa die Achtung vor dem Leben und der Gesundheit anderer ein allgemeiner Wert. Gleichberechtigung, Fairness, ein Recht auf ein glückliches Leben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Solidarität und Teilhabe am von allen geschaffenen Wohlstand sind Werte, die in der Wirtschaftsgesellschaft wichtige Entscheidungsmaßstäbe sind. Die Moral stellt die an Werten orientierte, durchsetzbare und notfalls erzwingbare Einhaltung von Regeln dar. Werte, Moral und Regeln, deren Sinnhaftigkeit durch Religion, Kultur und Erziehung vermittelt werden, können sich ändern, wenn sich die Einstellungen der Menschen ändern.GERECHTIGKEIT FÜR JEDERMANN
Im Folgenden haben wir aufgelistet, welche Möglichkeiten es gibt, Gerechtigkeit für jedermann zu erreichen:
Anspruch auf Gerechtigkeit: Jeder Mensch hat ein Anrecht, gerecht behandelt zu werden. Absolute Gerechtigkeit im Sinne einer Gleichverteilung etwa von Einkommen und Vermögen ist aber nicht das Ziel. Demokratische Gesellschaften, die auf dem Verfahren Tausch auf Märkten beruhen, versuchen relative Gerechtigkeit herzustellen, indem sie geeignete Regeln finden, die Schwächere gegenüber Stärkeren nicht benachteiligen.Wege und Möglichkeiten: Geeignete und akzeptierte Regeln, um Recht und Gerechtigkeit allgemein und in der Wirtschaft herzustellen, können auf dreierlei Art gefunden werden: Zum einen gibt es die deontologische Betrachtung. Danach ist prinzipiell zu fragen, ob ein Verhalten grundsätzlich gut oder schlecht ist. Nur das zweifelsfrei Gute ist als das einzig Vernünftige als Handlungsanleitung zu wählen. Wenn Zweifel bestehen bleiben, kann im nächsten Schritt einer Prüfung auf Recht und Gerechtigkeit über die Folgen einer Entscheidung für die Menschen beraten werden. Das beschreibt die teleologische Herangehensweise, die die Entscheidung favorisiert, die den größten Nutzen oder den geringsten Schaden verspricht. Wenn auch nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, was zum Ziel des größten Nutzens führt, bleibt schließlich noch als drittes Verfahren die konsensuale Entscheidungsfindung. Gesucht wird Einverständnis, hergestellt wird das über demokratische Mehrheiten als Folge von Wahlen. Einverständnis führt zu Umsetzung von Entscheidungen. Das ist der Regelfall.Bürgerliche Freiheiten: Insbesondere Gewerbefreiheit, Freizügigkeit und das Recht auf Eigentum schufen im 19. Jahrhundert ein Klima des Fortschritts und führten zur Gründung zahlreicher Unternehmen. Die industrielle Revolution veränderte die Gesellschaften von Europa.Die Wirtschaftssysteme des Kapitalismus und des Sozialismus: Durch die industrielle Revolution entstanden nicht nur immense Wachstumsschübe für die Volkswirtschaften. Sie trennte auch wenige Kapitalisten als Reiche von den vielen Arbeitern, den Armen. Diese wurden und werden von den Kapitalisten ausgebeutet. Eine Umverteilung des geschaffenen Wohlstands nach oben und große Ungleichheit waren die Folge. Die Arbeiter haben nicht teil an dem Wohlstand, den sie mitgeschaffen haben. Das bleibt nicht unwidersprochen, weil es als sehr ungerecht empfunden wird. Reichtum soll gerechter verteilt werden, er soll sozialisiert, das heißt vergemeinschaftet (gemeinsamer Besitz, Volksvermögen) werden.Globalisierung: Der Anstieg der Transaktionen in der Wirtschaft schafft weltweit Wohlstand. Wirtschaftliche Macht wird von internationalen Konzernen dazu eingesetzt, übernormale Gewinne zu realisieren, indem insbesondere Arbeitnehmer in ärmeren Ländern unter schlechten Arbeitsbedingungen bei schlechter Bezahlung ausgebeutet werden. Eine negative Begleiterscheinung der Globalisierung ist die Umweltverschmutzung.SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT ALS KOMPROMISS
Im Folgenden haben wir die wesentlichen Eigenschaften einer sozialen Marktwirtschaft zusammengefasst.
Wohlstand für alle: Die deutsche Idee der sozialen Marktwirtschaft als »drittem Weg« zwischen purem Kapitalismus und purem Sozialismus verbindet die Vorteile des Tauschens über Märkte mit dem Anspruch einer gerechteren Verteilung des Wohlstands. »So viel Markt wie möglich und so wenig Staat wie nötig« lautet die Formel für den Erfolg dieses Gesellschaftsentwurfs. Fehlt Chancengleichheit und ist die Verteilung des Wohlstands im Nachhinein ungewünscht ungerecht, kann der solidarische, ausgleichende Staat als Gemeinschaft aller Bürger Benachteiligte unterstützen.Prinzipien der Wirtschaftsverfassung: Wesentliche Rechte in einer Demokratie, die grundsätzlich marktwirtschaftlich verfasst sein soll, sind Vertrags- und Koalitionsfreiheit und Eigentum. Das Recht auf Eigentum kann im Sinne einer Sozialbindung eingeschränkt werden. Die Wirtschaftsverfassung wird zur Wahrung der Rechte aller Bürger auf Würde und Teilhabe ergänzt durch die Garantien eines ausgleichenden Sozialstaats.Prinzipien der Wirtschaftspolitik: Damit die Wirtschaft rund läuft und Wohlstand für alle produzieren kann, greift der Staat steuernd ein, wenn Fehlentwicklungen drohen. Staatliche Einrichtungen versuchen insbesondere über regulierende Eingriffe und/oder eigene investive Tätigkeit, das Preisniveau stabil zu halten, Arbeitslosigkeit in größerem Umfang zu vermeiden und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht von Exporten und Importen herzustellen, um ein angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum zu ermöglichen.Öffentliche und private Güter: Die meisten Güter und Dienstleistungen werden in einer Marktwirtschaft von privaten Anbietern bereitgestellt. Der Staat springt mit einem Angebot an öffentlichen Gütern ein, wenn Nachfrager zwar durch einen Kauf einer Ware oder Dienstleistung ein Bedürfnis befriedigen wollen, aber es aufgrund einer mangelnden Finanzausstattung nicht können.Meritorische Güter: Der Staat bietet einen Teil seiner öffentlichen Güter als meritorische, das heißt verdienstvolle an. Das sind Güter wie die Finanzierung eines Gesundheitssystems, das alle Bürger nutzen sollen, können oder müssen. Er schränkt durch Ge- und Verbote oder hohe Besteuerung umgekehrt die Nutzung von demeritorischen Gütern wie etwa Rauchen und Alkohol ein.Über die Wahrnehmung des Erfolgs der Wirtschaftspolitik und den gewünschten Umfang an Eingriffen in Freiheiten entscheiden in einer sozialen Marktwirtschaft die Bürger in demokratischen Wahlen.
WIRTSCHAFTS- UND UNTERNEHMENSETHIK UND STAATLICHES HANDELN
Im Folgenden haben wir Definitionen wichtiger Termini der Wirtschafts- und Unternehmensethik zusammengefasst.
Allokationseffizienz: Der Preis eines Gutes oder einer Dienstleistung spiegelt als Übereinkunft einen fairen Tausch wider. Die Preisfindung wird geleitet von einem guten Kostenmanagement der Unternehmen im Verhältnis zur Leistung, die ein Kunde bereit ist zu bezahlen. Die Verknüpfung von knappen Ressourcen wie Arbeit, Kapitaleinsatz und Boden gilt als allokationseffizient, wenn die Kosten der Produktion gleich dem Nutzen der Kunden sind.Marktversagen: Konflikte zwischen Gesellschaft, Kunden und Unternehmen bestehen, wenn der Koordinationsmechanismus für einen gerechten Tausch nur unvollkommen oder gar nicht funktioniert. Der Preis als Knappheitssignal kann außer Kraft gesetzt werden, wenn Unternehmen ihre finanzielle oder wettbewerbliche Macht einsetzen, um ihre Preisvorstellungen durchzusetzen (zum Beispiel Monopol). Der Preis kann als Signal eines als fair empfundenen Tausches auch unwirksam werden, wenn Unternehmen einen Informationsvorsprung haben und diesen betrügerisch oder zumindest manipulativ zu ihren Gunsten einsetzen. Kunden sind oder fühlen sich dann übervorteilt.Staatsversagen: In seinem Bemühen, Marktversagen und Ungerechtigkeit zu verhindern oder zu mildern, kann der Staat selbst versagen. Er kann aus politischer Überzeugung ohne Notwendigkeit zu Unrecht in Märkte eingreifen. Er kann über das Ziel hinausschießen und die Entwicklung bestimmter Märkte übermäßig abwürgen, Freiheiten einschränken oder umgekehrt übermäßig fördern. Zentrale Planung und Durchführung funktioniert nicht so gut wie dezentrale.Verteilungsgerechtigkeit: Besonders schweres Staatsversagen wird angenommen, wenn es einem Land nicht gelingt, eine gerechte Verteilung von Einkommen, Vermögen und Chancen herzustellen. Die Kluft zwischen Arm und Reich soll der Auffassung der überwiegenden Mehrheit der Bürger nach nicht zu groß werden. Mehr Gerechtigkeit für alle versucht der Staat sowohl durch progressive Besteuerung als auch durch zahlreiche Maßnahmen und Verfahren der Umverteilung zu realisieren. Wesentlich ist auch die Garantie von Chancengleichheit durch freien Zugang zu Bildung. Umstritten sind Form und Höhe der Besteuerung großer Vermögen.Wirtschaftsethik für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2018
© 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © Minerva Studio - Thinkstock
Print ISBN: 978-3-527-71360-8
ePub ISBN: 978-3-527-80857-1
mobi ISBN: 978-3-527-80856-4
Über die Autoren
Wieland Achenbach hat Volkswirtschaftslehre, Slawistik und Sinologie an der Philipps-Universität in Marburg studiert. Dort hat der Diplom-Volkswirt während seiner Tätigkeit als Programmdirektor und später als Strategieleiter im Management der Frankfurt School of Finance and Management 2003 auch seine Promotion abgeschlossen. 2007 nahm er eine Professur für Personal, Organisation und Strategielehre an der International School of Management in Dortmund an, für die er akademischer Leiter des Standorts Frankfurt war. Seit 2012 lehrt er Personalwirtschaft und Unternehmensführung an der Hochschule Aschaffenburg. Er ist zudem seit rund 15 Jahren Dozent für Strategielehre, Personalmanagement und für Unternehmens- und Bankenethik für Nachwuchskräfte der deutschen Banken und Sparkassen an der Frankfurt School. Zu den Sachgebieten des Autors gehören Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikfragen ebenso wie Strategielehre, Wirtschaftsethik und Bildungsmanagement. Neben fachlichen Kompetenzen kann er praktische Führungserfahrung im Management von Hochschulen aufweisen. Er hat zudem für seine Arbeitgeber zahlreiche Studiengänge zur Akkreditierung geführt und wirkt bis heute als Gutachter für eine Kommission bei Akkreditierungen mit. Daneben ist er Aufsichtsrat einer Raiffeisenbank im Rhein-Main-Gebiet.
Veronika Kneip hat Medien-Planung, -Entwicklung und -Beratung an der Universität Siegen studiert und schloss dort als Diplom-Medienwirtin ab. Anschließend promovierte sie im Fach Politikwissenschaft im DFG-Sonderforschungsbereich Medienumbrüche an der Universität Siegen. Seit 2009 ist sie als Programmdirektorin und Lecturer an der Frankfurt School of Finance & Management tätig. Dort unterrichtet sie im Bereich Wirtschaftsethik und publiziert zu Themen wie Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Als Programmdirektorin ist sie für die Konzeption und Weiterentwicklung akademischer Programme zuständig.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Über die Autoren
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Mensch, Gesellschaft und das Verhältnis von Ethik und Wirtschaft
Kapitel 1: Worum es bei Wirtschaftsethik geht
Interessen und Werte, die unser Leben bestimmen
Tauschen und Gerechtigkeit
Wer sich mit wirtschaftsethischen Fragen beschäftigt
Kapitel 2: Ethik als Lehre vom tugendhaften Leben
Die Natur des Menschen und der Gemeinschaft – Egoismus und Altruismus
Ein guter und glücklicher Mensch sein – Individualethik
Kapitel 3: Menschenrechte, Moral, Recht und Gerechtigkeit
Universelle Menschenrechte
Moral – von den inneren zu den äußeren Regeln
Von der individuellen Ebene auf die Ebene der staatlichen Gemeinschaft
Das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit
Kapitel 4: Die Quellen von Fortschritt und Wohlstand
Kapitalismus ist gut
Kapitalismus ist böse
Versöhnliches am Ende
Kapitel 5: Wirtschaftsethik und Globalisierung
Vorteile der Globalisierung
Theorien des internationalen Handels
Die Nachteile der Globalisierung
Die Macht von Konzernen und entwickelten Staaten
Ein besonderes Problem: Konsumentenversagen
Unzureichende institutionelle Regelungen in vornehmlich nicht demokratischen Ländern
Teil II: Wohlstand für alle – Individuelle Freiheit und Sozialbindung
Kapitel 6: Der dritte Weg: Die soziale Marktwirtschaft und ihre Institutionen
Die Rolle der europäischen Union
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Grundideen: Vorrang des Marktes und sozialer Frieden
Selbstverantwortung und Gemeinsinn
Die zum sozialen Frieden passende Wirtschaftsordnung: ordoliberale Prinzipien
Das Recht auf Eigentum und die Sozialbindung
Kapitel 7: Der Staat als Sachwalter der Interessen seiner Bürger
Der Staat als Anbieter öffentlicher Güter
Freiwillige Berichterstattung und Berichtspflichten
Weitere Akteure und Institutionen der sozialen Marktwirtschaft
Teil III: Anspruch und Wirklichkeit der sozialen Marktwirtschaft
Kapitel 8: Wirtschaftsethische Konflikte durch Marktversagen
Anspruch und Wirklichkeit
Weitere Formen von Marktversagen
Märkte, gesellschaftlicher Fortschritt und Rechtsentwicklung
Kapitel 9: Wenn der Staat versagt
Auch der Staat kann versagen
Lobbyismus: Wenn die Wirtschaft die Regeln selbst schreibt
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung
Recht kann nicht alles regeln
Die Regeln des Staates wirken manchmal willkürlich
Kapitel 10: Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich
Einkommen, Vermögen und Chancengleichheit
Die Steuergerechtigkeit
Chancengleichheit durch Bildungsgerechtigkeit
Teil IV: Unternehmensverantwortung als freiwillige Selbstverpflichtung
Kapitel 11: Unternehmen als verantwortungsbewusster Teil der Gesellschaft
Corporate Social Responsibility
Corporate Citizenship
Nachhaltigkeit in Unternehmen – Corporate Sustainability
Unternehmen – Getriebene und Treiber gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme
Kapitel 12: Organisatorische Umsetzung ethischer Grundsätze im Unternehmen
Ethikkodizes, Ethikabteilung, Ethikbeauftragte
Zertifizierte Ethikstandards
Kapitel 13: Ethik als Geschäftsmodell
Ethik als strategisches Unterscheidungsmerkmal
Märkte für ethische Investments
Fairtrade, Bio, Grün – Ethiklabels
Ethische Konsumenten als Kunden des ethischen Unternehmens
Kapitel 14: Ethik als neues Pflichtprogramm – der Einfluss der Stakeholder
Interessenvertreter der Kunden: Kundenbeirat und Verbraucherschutz
Politische Konsumenten
Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 15: Zehn wichtige Erkenntnisse für mehr Ethik in der Wirtschaft
Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu
Gerechtigkeit für jedermann
Auf die Kräfte des Marktes bauen
Mehr Kooperation statt weniger hilft
Es lebe die Transparenz
Konflikte müssen ausgeräumt und nicht verschoben werden
Nicht mit dem Finger auf andere zeigen
Am Anfang das Ende bedenken
Tue Gutes und rede darüber
Ehrlich währt am längsten
Kapitel 16: Zehn Fälle der realen Wirtschafts- und Unternehmensethik
Milchpulver von Nestlé
Brent-Spar – Boykott von Shell
Bekleidung aus Bangladesch
Fentanyl – eine neue »Killerdroge«
Selbstmord für das iPhone – Foxconn und Apple
Palmöl – umstrittener Alleskönner
Discountpolitik – Wirtschaftsethik bei »Billigheimern«
Gemeine Gemeinden: Wenn Anlieger ein Anliegen haben
Paradiesische Zustände
Nachhaltige Vergütung von (Bank-)Managern
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Spieltheoretischer Vorteil einer kooperativen »Win-win-Strategie«
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Güterarten nach Ausschließbarkeit und Rivalität
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Das Nash-Gleichgewicht
Abbildung 8.2: Das Spannungsverhältnis von Recht und Ethik
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Die Laffer-Kurve; E: Einnahmen aus einer Steuer, S: Steuersatz
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Dimensionen gesellschaftlicher Verantwortung nach Archie Carroll
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Ausdrucksformen politischen Konsums
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Begin Reading
Pages
C1
1
2
3
4
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
E1
Einführung
Sie studieren BWL, VWL oder ein verwandtes Fach wie Soziologie, Rechtswissenschaften, Politik oder Geschichte. Dann sind Sie mit der Lektüre dieses Buches über Wirtschafts- und Unternehmensethik gut bedient. Wir, die Autoren, meinen das überhaupt nicht ironisch. Denn der hier vermittelte Stoff ist nicht nur durchaus geeignet, die Wahrscheinlichkeit zu verbessern, dass Sie Ihre nächste Prüfung bestehen. Das Buch zeigt auch an vielen Beispielen und Geschichten Zusammenhänge in unserem täglichen Erleben von Wirtschaft und Wirtschaftsverfassung auf. Beim Überlegen und beim Niederschreiben haben wir selbst gemerkt, wie alltäglich das meiste ist, was hier jetzt zu lesen ist. Darüber, wie unser »wirtschaftliches Dasein« organisiert und geregelt ist, denken wir meist nicht bewusst nach.
Das Leben als Wirtschaftssubjekt läuft irgendwie automatisch und schnell. Konsumenten haben keine Zeit oder Lust, jede Entscheidung zu hinterfragen. Sie wissen auch manchmal gar nicht, welchen Maßstab sie für eine Entscheidung anlegen sollen – etwa bei der Frage, ob eine Autobahn öffentliches Eigentum sein sollte oder ob sie privatisiert werden könnte oder sollte und ob die Nutzung etwas kosten darf oder nicht. Einige Regeln des alltäglichen Tausches von Gütern und Dienstleistung verstehen wir eventuell gar nicht gut, über andere haben wir noch nie nachgedacht. Einige Regeln sind historisch nachvollziehbar, aber nicht logisch. Zum Beispiel gibt es zwar eine Hundesteuer, aber keine Katzensteuer. Hundebesitzer finden das womöglich ungerecht.
Über dieses Buch
Themen, mit denen sich die Wirtschaftsethik beschäftigt, tauchen in vielen volks- und betriebswirtschaftlichen Fächern auf, etwa bei den Fragen, nach welchen Bedingungen getauscht wird, welche Handlungs- und Verfügungsrechte über Ressourcen bestehen oder was eine gerechte Besteuerung ist. In besonderem Maße sind ethische Betrachtungen immer in der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik dabei, sowohl in der Mikro- als auch der Makroökonomie.
Weil Wirtschafts- und Unternehmensethik kein eigenes Fach in jedem wirtschaftswissenschaftlichen Studium ist, klingt dies zunächst irgendwie fremd und ganz weit weg. Für Studenten, die in diesem Fach geprüft werden, ist es mitunter schwierig, schnell einen Bezug zur eigenen Studienspezialisierung herzustellen. Aber das Wissen um Rahmenbedingungen, Inhalte, Konzepte und praktisches Vorgehen in der Gemengelage aus Möglichkeiten und Grenzen, Kooperation und Konkurrenz sowie dem Staat, der den fairen Tausch auf Märkten kontrolliert und regelt, hilft – auch den Entscheidern in der Wirtschaft. Die Unternehmensleitung kann in Kenntnis der Leitplanken und Haltungen, die die Wirtschafts- und Unternehmensethik vermittelt, besser einschätzen, wie ihre beabsichtigten Handlungen auf andere wirken, welche Ressourcen wie genutzt werden können und wie Märkte bedient werden könnten und sollten.
Kenntnisse der Wirtschaftsethik sind für Betriebswirte wichtig, um geschäftsschädigendes Fehlverhalten zu vermeiden, eine selbstverpflichtende Haltung zu entwickeln und um Chancen der Zukunft nutzen zu können, etwa durch Entwicklung neuer Märkte, Produkte und Verfahren. Die oftmals wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen richtig wahrzunehmen und die in Regeln gefasste Wirtschaftsordnung zu kennen, ist Teil des notwendigen Kompetenzprofils jeder Unternehmensleitung.
Topmanager als Entscheider stehen als Galionsfiguren ihres Unternehmens prominent in der Öffentlichkeit. Alle schauen auf sie und Mitarbeiter erwarten, dass ihre Vorgesetzten gute Vorbilder sind. Unfaires, unerwünschtes Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit, den Arbeitnehmern, den Kunden oder Konkurrenten schadet nicht nur kurzfristig. Es gefährdet das gute Ansehen des Unternehmens und damit langfristig auch die Rentabilität und sogar den Bestand eines Unternehmens. Kenntnisse der Wirtschafts- und Unternehmensethik sind deshalb elementarer Bestandteil des wirtschaftlichen Wissens und von strategischer Bedeutung. Ein Geschäftsmodell, das auf unredlichem Verhalten aufbaut, wird früher oder (etwas) später unattraktiv und ist in der heutigen Zeit großer Transparenz und Macht der Kunden und Arbeitnehmer zum Scheitern verurteilt.
Kenntnisse der Wirtschaftsethik und Wirtschaftsverfassung waren früher für Studenten der Volkswirtschaftslehre und verwandter Fächer wie Soziologie oder Politik Bestandteil ihres Studiums. Das ist mit der Hinwendung der Volkswirtschaftslehre zu einem mehr zahlengläubigen »naturwissenschaftlich-mathematischem Verständnis« ein wenig aus der Mode gekommen. Alle aber, die politisch und praktisch in Staat und Gesellschaft tätig sein wollen, können vertiefte Kenntnisse über die Wirkung von wirtschaftsethischen und -politischen Maßnahmen und Regeln gut gebrauchen. Kurzum, wir hoffen deshalb, dass wir den Inhalt und die Bedeutung von Wirtschaftsethik realitätsnah, spannend und nicht belehrend oder moralisierend vermitteln.
Damit das »ohne zu moralisieren« gelingt und weil es gar nicht so leicht ist, völlig neutral und wertfrei über Wirtschafts- und Unternehmensethik zu schreiben, seien hier ein paar Vorbemerkungen erlaubt, die als Vorschläge für Vereinbarungen mit Ihnen als Leser wirken könnten:
Übereinkunft zur Wahrheit …
Übereinkunft zu Wissenschaft, Präzision und Vollständigkeit …
Übereinkunft darüber, dass 90 Prozent von allem, was auf der Welt passiert, in Ordnung ist …
Übereinkunft über die »alte« und die »neue« Welt …
Bitte erwarten Sie nicht, dass wir die Wahrheit präsentieren. Wir kennen die Wahrheit auch nicht. Wir präsentieren Konzepte und unterschiedliche Sichtweisen. Manchmal haben wir eine Meinung. In den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es wenig Wahrheit und viel Meinung. Egal wie gut begründet eine Meinung ist und wie viele Follower sie womöglich in einem Blog findet, sie bleibt trotzdem subjektiv oder intersubjektiv. Das heißt, einer oder eine Gruppe von Menschen hält etwas für wahr und vertritt diese Meinung mehr oder minder vehement. Es kann sein, dass das, wovon Menschen überzeugt sind, wahr ist, es kann aber auch nicht sein. Die einen sagen es so, die anderen so und es ist auch nicht immer gleich alles ungerecht, nur weil einer behauptet, es sei ungerecht. Denn vieles, was passiert oder wovon wir denken, dass es zukünftig so sein müsse, ist zeitabhängig zu bewerten. Zwischen Menschen können keine naturwissenschaftlichen Wahrheiten wie das Gesetz der Schwerkraft oder des Magnetismus als gegebene sichere Erkenntnis oder als Beweis einer unumstößlichen Realität herhalten. Vieles bleibt im mehr oder minder gut begründbaren Meinen, Fühlen und auch Glauben stecken. Wir referieren deshalb in der Regel bloß Pro und Contra von Argumentationen.
Aber um es zuzugeben, Sie werden es ohnehin gleich lesen: Manchmal vertreten die Autoren eine eigene Meinung. Die müssen Sie jedoch nicht teilen. Vielleicht denken Sie wegen anderen von uns nicht präsentierten oder in ihrer Bedeutung geringer geschätzten Argumenten ganz anders über ein Thema. Das ist für uns völlig in Ordnung und hoffentlich auch für Sie. Bitte bilden Sie sich zu den Themen in diesem Buch eine eigene Meinung!
Weil etwas wie die Wirtschaftsethik nicht gut als eine unangreifbare verallgemeinerbare Wahrheit gelten kann, sollte man sich bescheiden auf das Referieren konzentrieren. Alle, die sich mit dem Thema Wirtschaftsethik befassen, sollten aber nicht in Versuchung geraten, die Beschäftigung damit deshalb als komplett unwissenschaftlich oder unbedeutend für die Praxis zu abzustempeln. Gerade Wirtschaftswissenschaftler sind manchmal geneigt, alles weit von sich zu weisen, was man nicht präzise zählen, messen und wiegen kann. Sie verspotten mitunter das Verfolgen etwa von sozialen Zielen als unwichtig, als vermeidbare Kosten oder »Sozialklimbim« und fordern gern »nicht emotional zu sein«. Was sich nicht in einem Konzept umsetzen lässt, gilt als schwierig bis irrelevant. Bevorzugt werden Algorithmen, Checklisten und technische Lösungen. Für nicht wenige Entscheidungen gibt es jedoch in der Realität keine Rezeptbücher, in denen man nachschlagen könnte, wenn man sich unsicher ist, was man tun sollte.
Unserer Ansicht nach ist das Thema Wirtschafts- und Unternehmensethik von großer Bedeutung für die Praxis. Die meisten Krisen der letzten Jahrzehnte sind nicht entstanden, weil irgendein Zusammenhang falsch berechnet wurde, sondern weil sich Akteure bewusst oder unbewusst falsch oder unehrlich verhalten haben. Über Zahlen, Pläne, Dinge und Vorgänge, die man zweifelsfrei und eindeutig messen kann, können Politiker oder die Leiter von Unternehmen in der Regel auch einfacher entscheiden als darüber, welche Haltung maßgeblich ist oder auf der Basis welcher Werte entschieden werden soll.
Um ein Beispiel zu nennen, empfahl eine deutsche Großbank kurz nach der Finanzkrise in ihrer Mitarbeiterzeitung ihren Mitarbeitern, die manchmal eben auch moralisch schwierige Entscheidung treffen müssen, zukünftig auf eine bestimmte Art vorzugehen. Das las sich wie eine Verhaltensanleitung, um drohende Schäden aus moralisch zweifelhaften Entscheidungen zu vermeiden. Denn, so schrieb die Bank vorweg, kein Geschäft sei es wert, für einen kurzfristigen Vorteil langfristig den guten Ruf zu riskieren. Erst einmal sei zu prüfen, ob etwas erlaubt ist. Wenn es zwar erlaubt, aber immer noch unklar sei, ob man die Entscheidung befürwortet oder besser ablehnt, soll der Mitarbeiter im Anschluss für sich einen »Bauchtest« (Wenn Dein Bauch nein sagt, lass es), danach einen »Mamatest« (Was würde Mama sagen?) und wenn das alles nichts hilft, noch einen »Öffentlichkeitstest« (Stell Dir vor, es wird im Fernsehen bekannt, wie Du entscheidest, willst Du das?) sozusagen als Spiegeltest zu machen. Nur wenn der Mitarbeiter bei keinem dieser Tests ein Störgefühl habe, solle er eine Entscheidung befürworten. Bauch, Mama und was andere denken könnten, sind erwiesenermaßen ganz gut geeignete Entscheidungshilfen, das Richtige zu tun, aber mit Wissenschaft, präzisem Messen oder Entscheiden nach Zahlenlage hat es wenig zu tun. Erfahrung, Einstellung und Haltung des Entscheiders bestimmen wohl eher, wohin die Reise geht.
Wir erheben nicht den Anspruch, das Thema komplett abzudecken. Erwarten Sie nicht, dass in diesem Buch alles zu jedem Sachgebiet oder Vorfall umfassend dargestellt wird, um es wie in der Wissenschaft üblich danach vollständig bis in die letzte Ecke auszuleuchten. Das wäre einfach zu viel und so viel wollen Sie bestimmt gar nicht lesen. Wir versuchen für die Wirtschaftsethik typische Sichtweisen, Diskussionen und Entwicklungen anhand von dazu passenden Beispielen nachzuzeichnen, sodass es Ihnen nach der Lektüre hoffentlich leichter fällt, andere Vorfälle oder Entwicklungen einzuschätzen und sich eine Meinung zu bilden.
Eine weitere Gefahr lauert für uns in dem möglichen Vorwurf, dass wir Sie mit dem Inhalt des Buches frustrieren, weil wir so oft über Probleme und über Zustände schreiben, die nicht in Ordnung sind. Die Beschreibung von Armut, Umweltverschmutzung, Macht, Betrug, Unglück, Unfähigkeit und Ungerechtigkeit nehmen breiten Raum ein. So kann man bei der Lektüre und den Beispielen schnell den Eindruck gewinnen, fast alles sei schlecht und das Ende der Welt nahe. Eine pessimistische, vorsichtige und zunächst ablehnende Haltung einzunehmen, ist einfacher als eine optimistische. Pessimismus stiftet eher die von uns geschätzte Sicherheit als – und Sie merken es gleich an der Wortwahl – »übertriebener« Optimismus. Optimisten gelten eher als naiv, Pessimisten als ernstzunehmende Mahner. Vorsicht hilft zu überleben. Die Medien haben zu allen Zeiten diese uns ureigene Haltung unterstützt, lieber erst mal vorsichtig zu sein.
Schauen Sie im Fernsehen eine Nachrichtensendung an. Messen Sie, wie lange über Positives berichtet wird im Verhältnis zu den Negativschlagzeilen. Die Medien sind voll von Katastrophen, Gemeinheiten, Verbrechen und Absonderlichkeiten, über die wir uns zu Recht empören. Aber wie die Historikerin Barbara Tuchmann in ihrem Buch Der ferne Spiegel über das wirklich finstere 14. Jahrhundert schrieb: »Das Normale macht keine Schlagzeilen«. Auffällig und schaurig muss es sein und es wird medial überhöht. Die Realität ist aber in einigen Fällen zumindest nicht so schlimm beziehungsweise nicht ausnahmslos so hoffnungslos, wie sie dargestellt wird.
Auch wir suchen uns zur Illustration die auffälligen Ereignisse und Probleme heraus. Deshalb ist aber nicht alles schlecht. Sie wüssten uns glücklich und auch für Sie wäre die Lektüre leichter, wenn Sie mit uns davon ausgehen könnten, dass 90 Prozent von allem, was in der Wirtschaft auf dieser Welt passiert, grundsätzlich in Ordnung ist. Wenn man sich nicht darauf einlässt, hat man es schwer und ist komplett umzingelt vom eigenen schlechten Gewissen und Zorn auf die Mächtigen. Die Dinge, die nicht in Ordnung sind, kann man benennen und in der Folge einer notwendigen gesellschaftlichen Diskussion – das ist Wirtschaftsethik! – ändern.
Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass es zwar vieles gibt, was diskussionswürdig ist, und auch Einiges, was nicht gut läuft und völlig zu Recht in Frage gestellt wird. Als Optimisten neigen wir aber dazu, zu behaupten, dass wir gerade in spannenden Zeiten leben, in denen sich ankündigt, dass sich mehr Zustände schneller als früher ändern können. In der heute noch dominierenden »alten« Welt der Betrachtung von Wirtschaftsethik ist häufig zu hören, dass moralisch gutes Verhalten nur den Gewinn schmälere. Wenn man ein Geschäft nicht mache, mache es ein anderer. Und wenn man als Manager den Auftrag habe, den Gewinn eines Unternehmens möglichst groß zu halten, könne die Einhaltung ethischer Standards schnell in Konflikt mit dem unternehmerischen Ziel geraten. Insbesondere dann, wenn man aus dem Gefühl einer Selbstverpflichtung heraus mehr Verantwortung für sein Handeln nehmen soll, als man – gesetzlich betrachtet – muss. Also ist es durchaus rational, meistens im Rahmen der Gesetze, manchmal außerhalb zu tricksen und Löcher in der Gesetzgebung zu nutzen. Regeln und Vertrauen können im Namen des möglichen Gewinns und der Überzeugung, dass alles, was nicht verboten ist, erlaubt ist, taktisch gebrochen werden. Das ist ein allgemein akzeptiertes Katz-und-Maus-Spiel. So entsteht eine Wirtschaft, in der ein Wettlauf zwischen den unternehmerischen günstigen Gelegenheiten und geeigneteren staatlichen Regeln zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten und Schäden stattfindet.
Die »neue« Welt, von der wir hoffen, dass sie sich mehr und mehr auch durchsetzen möge, sieht dagegen ethisches Verhalten in der Wirtschaft als einen Vorteil im Wettbewerb. Tue Gutes und rede darüber. Mache es so zum Teil des Unternehmensimages und der Marke. Mit nachhaltigeren, faireren Wirtschaftsweisen, Produkten und Dienstleistungen kann man sich positiv von Wettbewerbern abheben und die Bedürfnisse einer neuen Generation von Kunden, die es vermehrt grüner und nachhaltiger wünschen, besser bedienen. Die Zukunft verspricht den Unternehmen, die in der neuen Welt ankommen: Nachhaltigkeit sichert das Überleben und bringt gutes Geld.
Konventionen in diesem Buch
Die Kapitel in diesem Buch sind so geschrieben, dass Sie sie unabhängig voneinander lesen können. Das gilt auch und gerade für die fünf Teile des Buches. Trotzdem lässt sich, nicht nur wegen der Verweise auf andere Kapitel, die gesamte »Story« im Verlauf der fünf Teile zu erkennen. Wir starten mit Ausführungen zur Individualethik, beschreiben danach mit der Wirtschaftsverfassung und -ethik das Zusammenleben in Staaten und nehmen dabei die Unternehmen und Konsumenten in Betrachtungen zur Unternehmensethik dazu. Schließlich werden am Ende Kapitel platziert, wie das Zusammenspiel von Individuum, Unternehmen und Gesellschaft organisiert werden sollte.
Symbole, wie bei … für Dummies-Büchern üblich, helfen Ihnen, sich schnell zurechtzufinden, etwa wenn Sie sich beim Start in ein Kapitel erst mal einen Überblick verschaffen wollen. Zum Auffinden wichtiger Begriffe und Inhalte dient zudem das Stichwortverzeichnis. Zur besseren Orientierung ist der Text oftmals mit Häkchen gegliedert, etwa wenn Aufzählungen folgen oder verschiedene Argumente einander in der Diskussion gegenübergestellt werden. Die Schlagwörter, die der Häkchentext zeigt, werden dann im folgenden Text in der Regel kursiv hervorgehoben, damit Sie sie schnell wiederfinden.
Da Wirtschaftsethik als Querschnitt durch die Sozial- und Geisteswissenschaften fachübergreifend ist und der Inhalt die Frage eines guten Zusammenlebens in einem Land und weltweit thematisiert, sind die Bezüge zur Praxis zahlreich. Wir verwenden deshalb viele Beispiele, die mit dem Symbol »Beispiel« oder mit einem grau hinterlegten Kasten kenntlich gemacht sind. Das hilft Ihnen, den Stoff leichter zu verstehen.
Was Sie nicht lesen müssen
Sie könnten jedoch, um schneller durch das Buch zu kommen, auch auf die Lektüre der Inhalte und Beispiele in den grau hinterlegten Kästen verzichten. Beispiele und Kästen präsentieren zusätzliche Inhalte und Bezüge zur Praxis. Ebenso können Sie jeden Teil und jedes Kapitel dieses Buch für sich lesen. Wenn Sie kurz vor der Prüfung stehen, sagen wir mal am Vorabend der Prüfung, können Sie den Prozess noch weiter verkürzen, indem Sie ganz am Anfang nur die Schummelseiten lesen und am Ende noch schnell im Kapitel 15 zehn wichtige Tipps und Erkenntnisse zur Wirtschaftsethik überfliegen.
Törichte Annahmen über den Leser
Möglicherweise reichen die Schummelseiten und das Kapitel 15 aus dem Top-Ten-Teil allein nicht aus, um eine Klausur zu bestehen, die Lektüre ist mit Sicherheit jedoch ein ganz guter Einstieg in das Thema Wirtschaftsethik. Für eine bessere Note in der Prüfung empfehlen wir eine eingehende und intensivere Lektüre von Wirtschaftsethik für Dummies.
Einige weitere Argumente für die Lektüre sind:
Es ist einfach schlau, eine geraffte Zusammenfassung wichtiger Konzepte, Aspekte und Inhalte zur Wirtschaftsethik in einem – fachübergreifenden – Buch zu lesen. Da spart man viel Zeit und, wie wir alle wissen: Zeit ist Geld. Sie beweisen damit auch, dass Sie ökonomisch denken und handeln, denn Sie gehen strategisch nach dem ökonomischen Minimalprinzip, Bestehen der Prüfung mit dem Ziel einer passablen Note, vor.
Die Lektüre hilft Ihnen als Geistes- und Sozialwissenschaftler auch, Zusammenhänge zwischen den Disziplinen zu erkennen und zu verstehen. Das ist hilfreich, insbesondere dann, wenn Sie etwa als Politikwissenschaftler Volkswirtschaft im Nebenfach studieren. Oder Sie studieren Betriebswirtschaftslehre und erfahren so einiges über Unternehmensethik oder Corporate Social Responsibility, was im normalen Fachangebot eines betriebswirtschaftlichen Bachelors oder Masters nicht auftaucht.
Schließlich glauben wir, dass die Lektüre von
Wirtschaftsethik für Dummies
nicht nur hilfreich ist, um eine Prüfung zu bestehen, sondern auch geeignet ist, eine eigene Einstellung und Haltung zu den Herausforderungen und Konflikten und zu der Art und Weise, wie wir wirtschaften, zu entwickeln. Kenntnisse aus diesem Buch könnten Ihnen später nützen, wenn Sie in der Wirtschaft oder Politik eine verantwortungsvolle Position bekleiden, um sich für die Interessenlagen Ihrer Geschäftspartner oder Bürger zu sensibilisieren oder um Ideen für die gewinnbringende und langfristig ausgerichtete Gestaltung der Beziehungen zu ihnen zu bekommen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Wirtschaftsethik für Dummies ist in fünf Teile eingeteilt. Hier ein kurzer Überblick über das, was Sie in den einzelnen Kapiteln finden.
Teil I: Mensch, Gesellschaft und das Verhältnis von Ethik und Wirtschaft
Im ersten Teil des Buches zeigen wir auf, wer sich alles mit Wirtschaftsethik auseinandersetzt und warum. Dazu beginnen wir mit der Natur des Menschen und mit der Individualethik als Lehre vom tugendhaften Leben. Der nächste Abschnitt widmet sich der Organisation des Zusammenlebens von Menschen. Wirtschaftsethik ist im Grunde genommen die Frage, wie Tausch fair organisiert werden kann. Gerecht soll es in einer Gemeinschaft von Menschen zugehen. Welche Rechte haben Menschen und welche Regeln werden als gerecht empfunden? Alle Menschen, so die Annahme und Übereinkunft, haben ein Recht auf ein glückliches und selbstbestimmtes Leben in Wohlstand und Freiheit. Wir stellen deshalb als Nächstes die Quellen von Wohlstand und Wohlergehen dar. Märkte stiften als Tauschverfahren großen Wohlstand, verursachen aber nicht selten eine als ungerecht empfundene Ungleichverteilung der Gewinne. Als Wege zu mehr Gerechtigkeit diskutieren wir deshalb die unterschiedlichen Gesellschaftskonzeptionen des Kapitalismus und des Sozialismus. Das abschließende Kapitel dieses Teil weitet die Perspektive von einer Gesellschaft auf alle Länder dieser Welt. Wir beschreiben mit Blick auf Fragen des gerechten Tausches Licht und Schatten der Globalisierung.
Teil II: Wohlstand für alle – individuelle Freiheit und Sozialbindung
Der zweite Teil von Wirtschaftsethik für Dummies beschäftigt sich mit der Frage, ob man nicht beides gleichzeitig haben kann – großen Fortschritt und Wohlstand aus einer marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft und ein Regelsystem, das den Wohlstand gerechter verteilt und soziale Sicherheit als Menschenrecht verwirklicht. Wir beschreiben mit der deutschen Idee der sozialen Marktwirtschaft den mittlerweile oft kopierten Versuch der Versöhnung von Markt und sozialer Gerechtigkeit. Dazu stellen wir die Prinzipien, Rechte, Regeln, Wirtschaftspolitik und Institutionen vor, die in einer sozialen Marktwirtschaft gelten und wirken sollen, um dem Anspruch von Wohlstand für alle gerecht werden zu können. Danach beschreiben wir, wie der Staat als Sachwalter der Interessen seiner Bürger Wohlstand und soziale Sicherheit erhalten und fördern möchte. Der Staat betreibt Wirtschaftspolitik, um den fairen Wettbewerb zu erhalten und zu fördern und um soziale Sicherheit seiner Bürger zu garantieren. Besondere Aufmerksamkeit wird auch auf Eigentumsrechte und Sozialbindung gelegt. Um Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben und allen eine Teilhabe am Wohlstand zu ermöglichen, tritt der Staat zudem als Anbieter von Gütern und Dienstleistungen auf und tut Gutes für seine Bürger.
Teil III: Anspruch und Wirklichkeit der (sozialen) Marktwirtschaft
Der dritte Teil prüft, ob der Anspruch, den die Idee der sozialen Marktwirtschaft erhebt –Wohlstand für alle herzustellen – erfüllt wird. Zunächst beschreiben wir die Notwendigkeit von wirtschaftsethischen Diskussionen und Prüfungen der Eignung von Regeln, wenn Märkte in ihrer Funktionsfähigkeit versagen, Fortschritt und Wohlstand durch fairen Tausch zu produzieren. Wir beschäftigen uns mit den Ursachen von solchem Marktversagen. Der Staat ist aufgefordert zu handeln und tut das mit regulierenden Gesetzen und Eingriffen in Märkte. Wir zeigen, dass aber auch der Staat nicht allwissend ist und versagen kann, wenn es ihm nicht gelingt, geeignetere Regeln zu finden und anzuwenden. Schließlich richtet sich der Blick auf die nach Ansicht vieler größte Fehlentwicklung in der sozialen Marktwirtschaft: der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Vorgestellt werden Maßnahmen und Diskussionen, wie eine bessere Verteilungsgerechtigkeit hergestellt werden kann. In diesem Teil hat Steuergerechtigkeit durch Gestaltung von Steuern große instrumentelle Bedeutung und nimmt viel Raum ein. Besteuerung und Steuergerechtigkeit sind Dauerthemen eifriger Diskussionen und nehmen in der Frage eines fairen Umgangs miteinander eine zentrale Stellung in allen Gesellschaften ein. Ein weiterer Fokus wird am Ende auf die Frage der Chancengleichheit durch Bildungsgerechtigkeit geworfen.
Teil IV: Unternehmensverantwortung als freiwillige Selbstverpflichtung
In diesem Teil geht es um die »neue Welt« der Wirtschaftsethik. Wir beschäftigen uns zunächst mit den Konzepten, die für diese »neue Welt« prägend sind: Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship und Corporate Sustainability. Anschließend untersuchen wir, wie Wirtschaftsethik als freiwillige Selbstverpflichtung organisatorisch in Unternehmen verankert werden kann. Wir schauen auf die Etablierung von Ethikkodizes und Ethikabteilungen innerhalb von Unternehmen sowie auf übergreifende Standards – etwa von Seiten der Vereinten Nationen oder der OECD –, die Unternehmen als Richtschnur dienen können. Nicht zuletzt geht es um die Reichweite und die damit verbundenen Grenzen einer unternehmerischen Verantwortung. In einem weiteren Kapitel dieses Teiles thematisieren wir Ethik als »Geschäftsmodell«. Hier geht es darum, wie Unternehmen die Umsetzung wirtschaftsethischer Standards als strategische Ressource nutzen können, indem sie beispielsweise ihre Prozesse umweltverträglicher gestalten, neue Produkte entwickeln oder Reputationsvorteile aufbauen. Abschließend beschäftigen wir uns mit verschiedenen Anspruchsgruppen von Unternehmen: ethischen sowie politischen Konsumenten, Kundenvertretern, Aktionären und Nichtregierungsorganisationen. All diese Anspruchsgruppen tragen auf unterschiedliche Weise dazu bei, dass Unternehmen wirtschaftsethische Standards in ihren Strukturen verankern.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kein … für Dummies-Buch ohne Top-Ten-Teil: Wir raffen zentrale Themen des Buches als zehn wichtige Ratschläge zusammen. Das ist das, was Sie unserer Meinung nach in Ihrer Praxis zum Thema Wirtschaftsethik vor Augen haben sollten, sowohl als Student vor einer Prüfung als auch als spätere Führungskraft in Wirtschaft und Politik. Die Brücke zur Praxis schlagen wir dann noch einmal mit zehn Fallstudien. Die Fälle sollen als weitere reale Beispiele das Gelesene illustrieren und zeigen, wie die Erkenntnisse angewendet werden können.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Die … für Dummies-Bücher unterscheiden sich von anderen Büchern dadurch, dass sie Symbole benutzen, die etwas hervorheben. Folgende Symbole verwenden wir:
Im akademischen Bereich ist es üblich und erforderlich, festzulegen, was man verstanden wissen möchte. Definitionen dienen dazu, einen Sachverhalt zu erklären und ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Die in diesem Buch getroffenen Definitionen achten darauf, dass Begriffe und Inhalte einfach und verständlich sind und nicht akademisch verkopft bloß einen unbekannten Begriff durch einen anderen austauschen.
Wir geben zahlreiche Beispiele aus der Praxis, um die Erklärungen mit Leben zu füllen. Wir wissen, dass man sich Inhalte leichter merken kann, wenn man sie mit einem praktischen Beispiel verbindet. Längere Beispiele, die auch eine kleine Geschichte erzählen, oder mehrere Beispiele zu einem Sachverhalt finden sich in grau hinterlegten Kästen.
Dieses Symbol verwenden wir, um auf gravierende Unterschiede in den Meinungen oder einen Theoriestreit hinzuweisen. Hingewiesen werden soll so auch darauf, dass man das Geschriebene unterschiedlich auslegen kann. Die Verwendung dieses Symbols soll also insbesondere helfen, Missverständnissen vorzubeugen.
Hier geben wir Ihnen entweder Tipps, wie Sie das vermittelte Wissen in der Praxis anwenden könnten. Oder wir möchten Sie motivieren und einladen, über einen Sachverhalt intensiver nachzudenken.
Mit diesem Symbol möchten wir die Bedeutung des zuvor Geschriebenen noch einmal ausdrücklich betonen.
Wie es weitergeht
Je nachdem, welchen fachlichen Schwerpunkt Sie für eine etwaige Prüfung in Ihrem Studium zunächst abdecken und gebrauchen könnten, wählen Sie vielleicht eine bestimmte Reihenfolge der Lektüre der einzelnen Teile. Jeder Teil von Wirtschaftsethik für Dummies kann für sich betrachtet und gelesen werden. Sie können aber auch das Buch von vorne nach hinten lesen.
Egal wie Sie es angehen wollen, wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre, mannigfache Erkenntnis und viel Erfolg bei der Anwendung des Erlernten.
Teil I
Mensch, Gesellschaft und das Verhältnis von Ethik und Wirtschaft
IN DIESEM TEIL …
… werden wir Ihnen vermitteln, was alles zum Thema Wirtschaftsethik gehört und wer sich damit beschäftigt. Wir betrachten zunächst individualethisch die Natur des Menschen, seinen positiven wie negativen Egoismus, seinen Gemeinsinn und seine Empathie, um mögliche Erklärungen für sein Verhalten zu gewinnen. Die Natur des Menschen begründet Fortschritt und Wohlstand, aber auch Regelbrüche und Konflikte. Dann beschreiben und diskutieren wir die Quellen des Wohlstands. Für die meisten Gesellschaften typisch und vorteilhaft ist eine marktwirtschaftliche, kapitalistische Form der Wirtschaft, die auf Privateigentum und freier, dezentraler Planung fußt. Nachteilig sind jedoch eine manchmal ungerechte Verteilung von Macht und Gewinnen. Die unterschiedliche Wahrnehmung von Gerechtigkeit und die damit verbundenen Ansichten zu Vor- und Nachteilen unserer Art zu wirtschaften führt zu heftigen Diskussionen. Am Ende dieses Teils weitet sich die Perspektive auf die ganze Welt, wenn Licht und Schatten der Globalisierung dargestellt werden.
Kapitel 1
Worum es bei Wirtschaftsethik geht
IN DIESEM KAPITEL
Das Thema Wirtschaftsethik
Fairer Tausch und Gerechtigkeit
Akzeptanz von Regeln
Wer sich alles mit Wirtschaftsethik beschäftigt
Alle Menschen streben nach einem glücklichen Leben in Gesundheit und Wohlstand. Das Leben mit anderen ist geprägt von Zusammenarbeit und Konkurrenz. Jeder versucht für sich und die Seinen das Beste zu erreichen. Manchmal ist das auch gut für andere Menschen, manchmal nicht. Verbindliche Regeln, Sitten und Gebräuche des Zusammenlebens und Wirtschaftens haben sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte entwickelt.
Alle Menschen tauschen jeden Tag Waren und Dienstleistungen. Bei jedem Tausch wird gefragt, ist das fair und gerecht? Wie können Menschen und Gesellschaften nicht nur ein friedliches und glückliches Leben führen, sondern auch wirtschaftlichen Wohlstand und Fortschritt entwickeln und garantieren? Wird jemand bevorteilt, ein anderer benachteiligt? Wer profitiert oder soll nach dem Willen aller profitieren? Wie soll ein Tausch ablaufen? Was stiftet überhaupt Wohlstand? Wie sollen und können Gewinne aus einem Tausch und entstandener Wohlstand mit Blick auf die Zukunft verteilt werden? Welche Rechte und Freiheiten haben Menschen und Unternehmen? Wem sind Unternehmen und Entscheider verpflichtet? Wie entstehen Konflikte, wie können sie gelöst werden? Welche Regeln sind geeignet? Was könnte oder sollte geändert werden? Was soll zukünftig gelten?
Das alles sind Fragen, die im Rahmen wirtschaftsethischer Diskussionen typischerweise gestellt werden und zu denen Sie in diesem Buch einige Antworten finden. Lassen Sie uns zunächst gemeinsam anschauen, was Wirtschaftsethik umfasst und was das konkret bedeutet.
Ethik, von altgriechisch »ethos«, ist im übertragenen Sinne ein Dorfplatz, an dem sich die Gemeinschaft eines Dorfes oder eine Sippe trifft, um über gemeinschaftliche Aufgaben wie Nahrungsherstellung und -verteilung, Absprachen über Arbeit oder Hochzeiten zu beraten. Daraus entwickeln sich Bräuche, Gewohnheiten und Regeln, die an die nächste Generation weitergegeben werden, aber auch immer im Zeitablauf Veränderungen erfahren können. Ethik dient dazu, die Regeln des »guten« Zusammenlebens zu bestimmen und zu beschreiben, wie mit Störungen durch Egoismen, Fehlverhalten und unerwünschte Begierden einzelner Mitglieder der Gemeinschaft umgegangen werden soll.
Ethik bedeutet die permanente Diskussion über als gerecht oder ungerecht empfundene Regeln. Das Ergebnis dieser Diskussion führt zu geeigneten und akzeptierten Regeln des Zusammenlebens von Menschen in Gesellschaften.
In der Wirtschaftsethik wird das Zusammenleben von Menschen und Unternehmen in Gemeinschaften wie Staaten untersucht und diskutiert. Gesucht werden als gerecht empfundene und von möglichst vielen Menschen akzeptierte Regeln des fairen Tausches. Wirtschaftsethik kann auch als Versuch verstanden werden, mit Blick auf die Zukunft Verfahren für eine bessere Verteilung von Wohlstand und Chancengleichheit zu finden. Die Diskussion über Wirtschaftsethik ist fortlaufend.
Interessen und Werte, die unser Leben bestimmen
Was als gerecht empfunden wird, hat mit dem Wertesystem der Menschen zu tun. Was ist einzelnen Menschen wichtig? Wie möchten sie als Mensch wahrgenommen und behandelt werden? Wie sollte man mit anderen umgehen? Welche Rolle hat jemand in einer Gesellschaft?
Das Verhalten des Menschen wird bestimmt von Genen und dem Umfeld, in dem jemand aufwächst und mit anderen zusammenlebt. Ethik beschreibt die Sitten und Gebräuche – die Regeln – des Zusammenlebens. Konkurrenz und Zusammenarbeit sind Alltag. Menschen suchen Sicherheit. Sie wirtschaften und versuchen Wohlstand zu erlangen. Sicherheit herzustellen, hat vordergründig etwas mit der Verteidigung eines Menschen und seiner Familie gegen Feinde zu tun. Erst die Möglichkeit, lebensnotwendige Ressourcen wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, Werkzeuge und Waffen zu bekommen und nutzen zu können, erlaubt ein Überleben und den Fortbestand von Familien. Bestimmen zu können, Macht zu haben und auszuüben zu können, ist ein weiteres Motiv im menschlichen Zusammenleben. Neugier und Spieltrieb sind weitere Grundbedürfnisse des Menschen. Mit Neugier eng verbunden sind technologischer Fortschritt, Wachstum und insbesondere Freiheit in den Handlungsmöglichkeiten. Schließlich ist ein Ergebnis des Wirtschaftens auch die Entwicklung einer Kultur. Kultur beweist ein Maß an wirtschaftlicher Freiheit und ist Ausdruck der Überwindung von Armut und einem Leben von der Hand in den Mund.
Zu Beginn der Menschheitsgeschichte war das Zusammenleben in Gemeinschaften aber noch ein schierer »Überlebenskampf« der Art. In den entwickelten Volkswirtschaften der Welt ist es heutzutage eher ein Verteilungskampf. Zur Bewirtschaftung von Ressourcen bestehen Verfahren der Konkurrenz und Kooperation zwischen Menschen, Unternehmen, Gruppen und Staaten. Zwar sind die meisten Menschen in entwickelten Gesellschaften heutzutage nicht täglich vom Tod bedroht, sodass der Überlebenskampf nur mittelbar ist. Er findet jedoch als Konkurrenz um knappe Ressourcen und um die Verteilung von Überschüssen statt. Für viele Menschen besteht der Überlebenskampf praktisch in der Bereitschaft und Notwendigkeit zu arbeiten, um sich Wege zur Bedürfnisbefriedigung leisten zu können. Denn kaum jemand lebt im Schlaraffen- oder Auenland und bekommt alles ohne Gegenleistung. Wenn man etwas haben möchte, muss man typischerweise etwas anbieten. Viele Menschen bieten ihre Arbeitskraft an, denn sie haben nichts anderes anzubieten, weshalb gerade die Belohnung für geleistete Arbeit zentral ist in der Betrachtung eines gerechten Miteinanders.
Werfen Sie von heutigen Verhältnissen den Blick zurück auf den Beginn der Menschheit. Wir waren zwar nicht dabei, aber einiges wissen wir nun doch: In der Steinzeit herrschte aus unserer Sicht Mangel an fast allem. Das ist auch heute noch für gefühlt die Hälfte der Welt so, wenngleich die technologische Entwicklung weit fortgeschritten und die Wege des Tausches unheimlich komplex, vielfältig und kaum durchschaubar, weil global sind. Die Grundbedürfnisse von heute ungefähr acht Milliarden Menschen – Überleben in Frieden, Freiheit, Wohlstand – sind zwar die gleichen. Zahl und Qualität der Bedürfnisse übersteigen zu allen Zeiten aber regelmäßig die Mittel zur Befriedigung derselben.
Tauschen und Gerechtigkeit
Damit die Interessen und Wünsche weitestgehend erfüllt werden können und möglichst viele wohlstandsstiftende Tauschvorgänge stattfinden, braucht es Vertrauen zwischen Menschen. Vertrauen kann sich bilden, wenn Werte gefunden werden können, die von allen respektiert werden. Wenn gemeinsame Werte allgemein akzeptiert werden, begründen sie allgemeine Rechte, die mit Regeln überwacht werden. Für alle geltenden Werte, die menschliches Leben und Zusammenleben begründen, sind zum einen Gesundheit und die Erwartung eines langen Lebens. Zum anderen das Streben nach Glück in freier Selbstentfaltung, ausgeprägt durch den Willen, seine Lage selbst durch eigene Anstrengung zu verbessern. Wirtschaft als Tauschen mit dem Interesse, Vorteile zu erlangen, dient dem Zweck der Bedürfnisbefriedigung durch Beseitigung eines Mangels und dem Überleben in Frieden und Wohlstand.
Werte sind die in einer Gemeinschaft anerkannten Maßstäbe für Entscheidungen von Personen und Gruppen. Sie beschreiben, was uns im Zusammenleben mit anderen wichtig ist und was unser Verhalten gegenüber anderen bestimmt. Von allen oder zumindest der Mehrheit akzeptierte Werte wie der Respekt vor dem Recht auf Leben anderer bestimmen unsere Regeln. Sie begründen Moral. Moral kann verstanden werden als die Summe der geltenden Regeln. Diese Regeln können auf der Basis von akzeptierten Gesetzen durchgesetzt werden.
Neben dem zentralen Wunsch nach Sicherheit streben Menschen nach Macht oder zumindest einer besonderen Stellung im Vergleich zu ihren Mitmenschen. Ähnliche Bedeutung erlangen daraus abgeleitete Bedürfnisse wie Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, Prestige zu erwerben, einen Besitzstatus für die Familie zu erreichen und zu erhalten, Ressourcen zu beschaffen und zu nutzen, Eigentum als Reserve über den Tag hinaus bilden zu können und sich, allgemein gesprochen, materiell wie immateriell zu verbessern. Das hat viel zu tun mit den Möglichkeiten, Armut zu überwinden und Vermögen zu bilden und zu erhalten sowie durch Vererben weitergeben zu können.
Schließlich suchen Menschen nach der Freiheit, ihren Bedürfnissen und Interessen nachgehen zu können, zu planen, zu produzieren, zu konsumieren, zwischen Alternativen zu entscheiden und in jeder Phase zum eigenen Vorteil tauschen zu können. Wirtschaftsethik ist im Grunde der Versuch, Tauschvorgänge von Gütern und Dienstleistungen gerecht zu organisieren und für alle Beteiligten Tausch als Verfahren akzeptabel zu halten.
Ein Tausch schafft gegenseitige Vorteile. Im besten Fall geschieht ein Tausch frei, das heißt, ohne dass einer der Tauschpartner Macht hat, den Tausch auch gegen den Willen des anderen Tauschpartners zu erzwingen. Das würde einen der Tauschpartner einseitig benachteiligen.
Ein Tausch gilt auch dann noch als vorteilhaft für die Beteiligten, wenn einer der Tauschpartner stärker vom Tausch profitiert als der andere. Ob ein Tausch zustande kommt und ob er als fair erachtet wird, liegt am materiellen oder immateriellen Wert, den ein Tauschpartner der Ware oder Dienstleistung beimisst.
Hier ein klassisches Tauschmodell, das wie eine Auktion funktioniert: Fußgänger A hat ein altes Auto geerbt. Es ist, ohne dass er es genau weiß, seiner Einschätzung nach noch 10 000 Euro wert. Unterhalb dieses Betrags würde er das Auto nicht verkaufen wollen, das heißt gegen Geld tauschen. B ist ein Autoliebhaber, sucht genau diesen Typ Auto und weiß, dass solche Autos, von denen es nur noch wenige fahrbereite und gut erhaltene gibt, mit Beträgen bis zu 15 000 Euro gehandelt werden. Das wäre er auch bereit maximal zu bezahlen. Da B nicht weiß, was das Auto dem A wert ist, bietet er dem A mit 12 000 Euro einen Betrag an, der zwar unter den 15 000 Euro liegt, jedoch von A, weil er über 10 000 Euro liegt, bereitwillig akzeptiert wird. Beide Tauschpartner haben einen Vorteil, der A einen in Höhe von 2000 Euro über seiner Erwartung, der B sogar in Höhe von 3000 Euro, die er gespart hat beziehungsweise nicht hat zahlen müssen, um das Auto zu bekommen. Der Tausch gilt als gerecht und konfliktfrei, weil die Erwartungen und Bedürfnisse beider Partner erfüllt beziehungsweise übertroffen wurden.
Getauscht werden Waren und Dienstleistungen gegen Waren und Dienstleistungen. Ein Zwischenschritt ist jedoch die Regel: Waren werden getauscht gegen Geld und Geld kann wiederum gegen Waren getauscht werden.
Geld ist das zentrale Schmiermittel im Tauschprozess. Geld ist, »was gilt«, das heißt, was beim Tauschen von Waren als Gegenwert im Sinne eines Zahlungsversprechens akzeptiert wird – heutzutage in der Form von Banknoten und Münzen für alle beziehungsweise als Buch- und Giralgeld bei Finanztransaktionen. Geld erfüllt wichtige, Tausch ermöglichende und verbessernde Funktionen. Es ist:
eine allgemein akzeptierte Recheneinheit
ein unverderbliches, zeitbeständiges Wertaufbewahrungsmittel
ein einfaches Tausch- und Zahlungsmittel
Geld hat insbesondere auch die Funktion, als Beschleuniger von Transaktionen zu wirken.
Wenn Geld als Symbol der Summe von frei verfügbaren Möglichkeiten betrachtet wird, macht Geld zu haben nicht nur frei, sondern auch mächtig. Kaufen und verkaufen bedeutet Geld gegen Waren zu tauschen. Fair soll es dabei zugehen. Nach fairem Tausch, der allen beteiligten Tauschpartnern Vorteile bringt, streben alle – allein, in Gruppen, in Kooperation und Konkurrenz gleichzeitig. Die Organisation von fairem Tausch ist der Bewertungsmaßstab für ethisches Verhalten in der Wirtschaft schlechthin. Wenn ein Tausch als fair bewertet wird, entsteht kein Konflikt.
Werte wie Würde, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Ausgleich sind im Gruppenzusammenhang sozial anerkannte Koordinationsmaßstäbe für das Entscheiden darüber, welche Regeln beim Tauschen gelten sollen. Sie sind universelle Menschenrechte und finden in der Wirtschaft ihre Entsprechung. Damit es nach allgemeiner Auffassung gerecht zugeht, darf niemand diskriminiert werden, dürfen freie Wirtschaftssubjekte wie Unternehmen und Konsumenten freie Entscheidungen treffen, bedarf es der Teilhabe und Mitbestimmung über die Nutzung der Ressourcen und die Verteilung von Überschüssen des Wirtschaftens, bedarf es fairer Tauschverfahren für Güter und Dienstleistungen. Es geht immer um Verständigung und Ausgleich zwischen individuellen Interessen.
Fairness, von Englisch »fair«, drückt eine gewünschte Vorstellung von Gerechtigkeit aus. Fairness bedeutet unter der Annahme gemeinsamer und für alle geltender Vereinbarungen, sich an die Regeln zu halten und sich anständig, ehrlich und gerecht gegenüber seinen Mitmenschen zu verhalten. Übrigens bedeutet »fair« als Substantiv in der Übersetzung aus dem Englischen Markt, Messe, also ein Platz, an dem nach Regeln ehrlich getauscht wird.
Wie fair drückt auch das deutsche Wort Gerechtigkeit den Versuch aus, den möglichst besten Zustand eines sozialen Miteinanders zu vereinbaren. Das soziale Miteinander als Geben und Nehmen funktioniert als ein von allen akzeptierter Ausgleich von Interessen und Chancen, Belohnungen und Bestrafungen. Gerechtigkeit für jedermann herzustellen, ist ein wesentlicher Anspruch entwickelter, demokratisch legitimierter Volkswirtschaften. Das Streben nach mehr Gerechtigkeit ist im politischen System von Marktwirtschaften häufig das prominenteste Wahlkampthema konkurrierender Parteien.
Die Einhaltung von Regeln, Sitten, Gebräuchen und Geboten soll helfen, unerwünschtes Fehlverhalten einzudämmen und ein friedliches soziales Miteinander für Fortschritt und Wohlstand zu ermöglichen. Die Diskussion darüber, welche Regeln im Wirtschaftsleben gelten sollen, welche Sitten und Gebräuche akzeptabel, fair und wünschenswert erscheinen, wird als Wirtschaftsethik bezeichnet.
Wer sich mit wirtschaftsethischen Fragen beschäftigt
Im Prinzip beschäftigen wir uns ständig mit wirtschaftsethischen Fragen, weil wir jeden Tag mit Tauschen beschäftigt sind und alles, was wir erleben, durch die Filter unseres eigenen Verständnisses von Wert und Fairness läuft. Es gibt kaum jemanden, dem seine Chancen gleichgültig sind oder dem es egal ist, ob ihm Gerechtigkeit widerfährt. Die Bibliotheken dieser Welt sind gut gefüllt mit Büchern über die Organisation des menschlichen Zusammenlebens. Unzählige Kataloge von Regeln sowie Ansichten und Kommentare zu diesen Regeln bestimmen unser Leben. Die Medien befragen uns ständig nach der Akzeptanz und Bewertung der Realität. Wie finden Sie das? Was finden Sie gerecht? Wie bewerten Sie das Verhalten von Herrn oder Frau sowieso? Hätten die nicht eine Strafe verdient?
»Medien« als ein Wort für die Berichterstattung und Kommunikation in Zeitungen, Funk, Fernsehen und Internet sowie allgemein Veröffentlichungen haben in demokratischen Gesellschaften eine zentrale Bedeutung als Ausdruck der Meinungsfreiheit und -vielfalt. Menschen werden von den Medien informiert und können sich eine Meinung bilden. Medien kontrollieren zudem, indem sie auf Missstände hinweisen.
Wissenschaftlich betrachtet, ist Ethik oder spezieller Wirtschaftsethik ein fachübergreifendes Thema. Anders als zum Beispiel die Disziplin »Buchführung« in der Betriebswirtschaftslehre, die ein geschlossenes und wertfreies Instrument für die Wirtschaft darstellt, ist Wirtschaftsethik in vielen wissenschaftlichen Bereichen prominent als Dauerthema vornehmlich in den Geistes- und Sozialwissenschaften vertreten. Sie sind sehr eng miteinander verwandt und verwoben. Wenn Sie schwerpunktmäßig ein Studium einer dieser Wissenschaften aufnehmen, studieren Sie auch immer ein bisschen die anderen Geistes- und Sozialwissenschaften mit. Bei allen geht es um nicht weniger als die Organisation des Zusammenlebens, also um das große Ganze. Das macht es auch so vielschichtig und wenig überschaubar und fassbar für uns. Spötter sagen deshalb manchmal, wenn jemand über den Tellerrand schaut, da wäre wieder einer auf der Suche nach der »Weltformel« unterwegs.
Die Anfänge der Wissenschaft liegen im Bereich der Religion und der Philosophie. Hier wird seit Jahrtausenden mit Blick auf ein verständigungsgeleitetes Zusammenleben danach geforscht, was es bedeutet, ein gutes und glückliches Leben zu führen, welche Rolle der Mensch in seiner Glaubensgemeinschaft oder wie im alten Griechenland in einem Stadtstaat haben soll. Wie soll der Mensch sich verhalten, um ein glückliches Leben zu führen? Die wesentliche Botschaft: Er soll freiwillig und gern anderen zugewandt sein, helfen, teilen, Gerechtigkeit üben, kurzum den Nächsten lieben und friedlich bleiben. Heute würden wir sagen, Steuern zahlen, nicht tricksen, nicht rumnölen und keinem mit aggressivem und selbstsüchtigem Verhalten auf die Nerven fallen. Egoismus wie Raffgier – eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt – Hochmut und Maßlosigkeit sind insbesondere unerwünscht. Aber in der Bibel als dem Hauptwerk der Christenheit steht auch geschrieben, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll. Ehrgeiz und Konkurrenz beleben das Geschäft.
Den Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft wirft die Soziologie. Diese Disziplin untersucht die Bedingungen, Prozesse und Folgen menschlichen Zusammenlebens in Gemeinschaften. Wenn man nach dem Zweck dieser Forschung fragt, wird man schnell zur Erkenntnis gelangen, dass auch hier das soziale Miteinander im Vordergrund steht. Untersucht werden Verhalten in Gruppen und dazu passende Einrichtungen, etwa die Funktion von technologischem Fortschritt, die Ausgestaltung von Kommunikation, Medien und Migrationsbewegungen. Die Soziologie sucht nach Erkenntnissen, denen bessere Regeln des Zusammenlebens folgen. Die Soziologie möchte gestalten.
Auch die Psychologie und die Evolutionsbiologie, eigentlich Naturwissenschaften, fragen nach den Gründen für individuelles menschliches Verhalten. Sie vermögen Hilfestellung bei der Erkenntnissuche zu geben, wie der Mensch tickt, wie sich seine Sozialisation entwickelt hat, was Menschen antreibt, welche Bedürfnisse sie haben und wie sie sich verhalten werden, um diese Bedürfnisse zu erfüllen warum sie tauschen oder auch nicht. Die Psychologie und die Evolutionsbiologe möchten erklären.
Die Geschichtswissenschaften zeichnen vergangene Zeiten und Erfahrungen nach. Es werden Erkenntnisse gesucht, aus denen man für die Gegenwart und Zukunft lernen kann. Die Rechtswissenschaften beschäftigen sich, wie der Name schon sagt, mit der Begründung, Formulierung, Auslegung und Anwendung der Regeln, die gelten und durchgesetzt werden sollen. Der Bezug zur Wirtschaft ist außergewöhnlich groß, da Freiheitsrechte, Fairness und Gleichheit vor dem Gesetz Verfassungsrang haben. In einer Verfassung werden die Möglichkeiten und Grenzen des Wirtschaftens für alle festgelegt. Da Tauschvorgänge immer etwas mit Handlungsrechten, Besitz und Eigentum, Haftung für Schäden und Regelungen zur Gewinnteilung zu tun haben, sind auch fast alle Teildisziplinen des Rechts eingebunden. Strafrechtliche Bezüge sind bei Betrugsfällen zu sehen, der überwiegende Teil der Betrachtung und Rechtsprechung nach den gesellschaftlichen Vereinbarungen darüber, was für alle gelten soll, findet im Bereich des Zivilrechts, des öffentlichen wie privaten Rechts, statt.
Die Wirtschaftswissenschaften