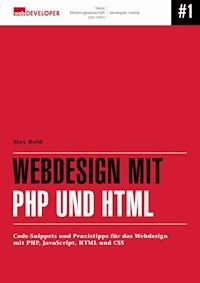8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Angst, Proteste, das Gefühl einer Welt am Abgrund – für viele war die Pershing-Rakete mehr als nur ein Stück Militärtechnik. Sie war das greifbare Symbol einer globalen Bedrohung. Mitten im Herzen Deutschlands standen sie: Hochgerüstete Träger atomarer Sprengköpfe, bereit zur Abschreckung – und potenziell zur Auslöschung. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Pershing-Raketen nicht nur als technisches Kapitel des Kalten Krieges, sondern als Teil einer kollektiven Erinnerung. Es beginnt mit der »Operation Paperclip« nach dem Zweiten Weltkrieg, als deutsche Raketenforscher in die USA geholt wurden. Von dort spannt sich der Bogen über die Entwicklung der Pershing-Systeme bis zur umstrittenen Stationierung auf deutschem Boden in den 1980er-Jahren – einer Zeit, in der hunderttausende Menschen auf die Straße gingen, um gegen die atomare Bedrohung zu protestieren. Die Pershing war mehr als eine Rakete – sie wurde zum Auslöser gesellschaftlicher Spannungen, Symbol politischer Ohnmacht und zugleich Katalysator für Veränderung. Der INF-Vertrag, der ihre Vernichtung besiegelte, markierte ein seltenes Kapitel echter Abrüstung und Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Max Bold
Raketen für den Frieden?
Die Geschichte der Pershing-Raketen in der Bundesrepublik Deutschland 1960 – 1991
Inhaltsverzeichnis
Autor
Einleitung
Von Nordhausen nach Fort Bliss
Raketen für die US-Army und die NATO
Redstone - der Vorläufer der Pershing
Von der Redstone zur Pershing I
Die Entwicklung von Raketen in den 1950er-Jahren
Die NATO-Strategie der massiven Vergeltung
Die NATO-Ratstagung im Februar 1952
Lauris Norstad als neuer SACEUR
Auf dem Weg zu einer neuen Strategie
Matadore für die Bundeswehr
Die Pershing-Raketen kommen nach Deutschland
Flexible Reaktion als neue Strategie der NATO
Die Pershing-Raketen in der QRA-Rolle
Die Pershing Operational Test Unit (POTU)
Von der Pershing I zur Pershing Ia
Die Konsolidierung der Pershing-Einheiten
Pershing wird Thema bei den MBFR-Verhandlungen
Von der Pershing Ia zur Pershing II
Die Debatte um die Nachrüstung beginnt
Das Treffen in Guadeloupe
Der NATO-Doppelbeschluss von 1979
Die sowjetische SS-20
Friedensbewegung der 1980er-Jahre
Erste Verhandlungen in Genf
Unfälle mit Pershing-Raketen
Die ersten Pershing II-Raketen in Mutlangen
Die sowjetische Nach-Nach-Rüstung
Die Nachrüstung nimmt Fahrt auf
Der Pershing-Unfall von Heilbronn 1985
Der Pershing II-Verband wird einsatzbereit
Erfolgreiche Verhandlungen in Genf
Die Details des INF-Vertrags
Der Abzug der Pershing II-Raketen
Das Ende der Pershing bei der Bundeswehr
Relikte der Pershing-Ära
Die Rückkehr der Raketen
Impressum
Timeline
Verzeichnis der Abkürzungen
Literatur zum Thema
Landmarks
Inhaltsverzeichnis
Cover
Autor
Max Bold, Jahrgang 1949, hat in München Politikwissenschaft studiert. Das Thema der Diplom-Arbeit lautete: »Die Mitwirkung der Bundesrepublik an der Militärstrategie der NATO«. Während seiner beruflichen Laufbahn hat er als Journalist bei diversen Verlagen und in diversen Positionen das journalistische Handwerk in all seinen Facetten kennen und schätzen gelernt.
Ich widme dieses Buch meiner Frau Barbara, meiner Tochter Angelika und meinem Enkel Sebastian
Einleitung
Kein anderes atomares Waffensystem hat die Deutschen im vorigen Jahrhundert mehr in Unruhe versetzt als die Pershing-Rakete, allerdings erst rund zwanzig Jahre nach ihrem erstmaligen Auftauchen in der Bundesrepublik.
Soldaten, die mit ihr zu tun hatten, und Politiker, die für ihre Einführung sorgten, bemühten gerne ihre Rolle als eine Art Friedenshüter. Dies war jedoch allenfalls Ausfluss der paradoxen Logik des Kalten Krieges, in der der Frieden durch die Androhung gegenseitiger Vernichtung gesichert werden sollte. In der Realität waren sie Massenvernichtungswaffen wie viele andere auch – mit unvorstellbarem Vernichtungspotenzial und kurzer Reaktionszeit.
Dessen wurden sich auch immer mehr Menschen bewusst, und im Zuge der Nachrüstung zu Beginn der 1980er-Jahre bewegte dieses Waffensystem die Menschen in der Bundesrepublik in einem Ausmaß vergleichbar mit der Anti-Atomwaffen-Bewegung der späten 1950er-Jahre (Kampf dem Atomtod).
Damals protestierten die Menschen in der Bundesrepublik gegen die Ausrüstung der neuen Bundeswehr mit atomaren Trägerwaffen. Dies geschah damals im Rahmen der von der NATO propagierten Strategie der massiven Vergeltung. Jede kriegerische Auseinandersetzung wäre damit mehr oder weniger automatisch zu einem Atomkrieg eskaliert.
Der geplante Atomkrieg
Die Rechnung der Strategen war – ausgehend von den USA – einfach: Statt immer größere Summen in die Aufrüstung konventioneller Armeen zu stecken, ließe sich ein adäquates Zerstörungspotential mit Nuklearwaffen zu einem wesentlich geringeren Preis realisieren. »Bigger Bang for the Buck« lautete die griffige These, die Charles Erwin Wilson, Verteidigungsminister unter Präsident Dwight D. Eisenhower, 1954 in die Welt setzte und die die unter den Verteidigungslasten ächzenden Regierungen Westeuropas gerne aufgriffen.
Bevor jedoch die finanzielle Entlastung zum Tragen kommen konnte, war zunächst einmal eine neue, kostspielige Rüstungsrunde fällig. Der atomare Gegenschlag sollte mit Waffen aller Art durchgeführt werden, insbesondere mit Düsenjets, aber auch mit Raketen unterschiedlicher Reichweite, Artilleriesystemen mit diversen Kalibern und sogar mit einer Art atomarem Mörser (Davy Crockett), der wegen seiner kurzen Reichweite der eigenen wie auch gegnerischen Truppe gleichermaßen geschadet hätte.
Die USA gingen mit gutem Beispiel voran und rüsteten ab 1954 ihre Truppen mit diversen bemannten (Düsenjets der F-Serie) und unbemannten Flugzeugen (Matador/Mace) aus und konvertierten ihre konventionellen Divisionen in mit Atomwaffen ausgerüstete Pentomic-Divisionen.
Atomwaffen für die NATO
Ab 1957 sollten auch die europäischen Verbündeten in den Genuss atomarer Feuerkraft für ihre Truppen kommen. Entsprechende NATO-Beschlüsse (MC 70) legten die Details fest. Das benötigte Material boten die USA zum Kauf an und lagerten die passenden Atomsprengkörper in speziellen Lagern in Europa ein.
Deren Schlüssel gaben sie natürlich nicht aus der Hand und aus Angst, dass diese Waffen in die falschen Hände geraten könnten, rüsteten sie diese ab den 1960er-Jahren sogar noch mit elektronischen Sicherungen (PAL) aus. Das Arsenal an atomaren Sprengkörpern erreichte in diesen Jahren schwindelerregende Ausmaße: Rund 7000 nukleare Sprengköpfe befanden sich Mitte der 1960er-Jahre in Europa.
Auch die neu geschaffene Bundeswehr konvertierte auf diese Weise zu einer Atomstreitmacht, allerdings mit eingeschränkten Befugnissen: Atomare Waffenträger - ja, atomare Sprengköpfe – nein. Die Luftwaffe schaffte sich den F-104 Starfighter als Atombomber an, nukleare Flugabwehrraketen (Nike Hercules) kamen dazu und schließlich ging es noch um einen weitreichenden unbemannten Flugkörper. Einen solchen hatten die Amerikaner schon seit 1954 in der Bundesrepublik im Einsatz.
Matadore für die Bundeswehr
Beim Marschflugkörper Matador handelte es sich um eine Weiterentwicklung der von der Wehrmacht entwickelten V1. Das 38th Tactical Missile Wing der USA hielt an drei Standorten in Rheinland-Pfalz (Hahn, Bitburg und Sembach) bis 1962 rund 72 Matador-Flugkörper einsatzbereit. Ab diesem Zeitpunkt wurden sie durch 96 Systeme der Weiterentwicklung Mace mit größerer Reichweite ersetzt.
Auf die Matadore hatte auch der damalige Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß, ein glühender Anhänger der »Massive Retaliation«-Strategie, ein Auge geworfen. Über den Kauf dieser Systeme wurde innenpolitisch heftig debattiert, bis schließlich in einer ersten Tranche 24 Systeme bestellt wurden und in Kaufbeuren im Allgäu eine erste Flugkörpergruppe für dieses Waffensystem etabliert wurde.
So richtig in Gang kam der Aufbau dieser Truppe jedoch nicht, zum einen, weil das Waffensystem zu diesem Zeitpunkt schon ein Auslaufmodell war, und zum anderen, weil die Bundeswehr damals wegen des überhasteten Aufbautempos mit massiven finanziellen, organisatorischen und personellen Problemen zu kämpfen hatte.
Trotzdem wurde der Plan einer weitreichenden Abstandswaffe für die Bundeswehr weiter verfolgt. Ins Blickfeld der deutschen Rüstungsplaner geriet dabei kurzzeitig das Nachfolgemodell Mace, doch da legten die Amerikaner eine merkliche Zurückhaltung an den Tag. Ein atomares Waffensystem mit einer Reichweite über Moskau hinaus in der Hand der Bundeswehr war für die Amerikaner wohl keine Option.
Als Alternative boten die USA den Deutschen ihre neueste Entwicklung im Bereich der Raketen und Flugkörper an – die Pershing-Rakete. Diese wurde ab Mitte der 1960er-Jahre bei der US-Army in der Bundesrepublik eingeführt und sollte auch das atomare Arsenal der Bundeswehr nach oben hin abrunden. Doch kaum war die Rakete im Land, taten sich neue Probleme auf.
Strategie der flexiblen Reaktion
Seit John F. Kennedy am 20. Januar 1961 sein Amt als 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angetreten hatte, tat er alles, die NATO von ihrem rigorosen Atomkurs abzubringen. Er hielt die Strategie der massiven Vergeltung angesichts der wachsenden sowjetischen Atomrüstung für einen verhängnisvollen Irrweg, insbesondere für die USA selbst. Sein Verteidigungsminister Robert McNamara versuchte in den folgenden Jahren mit viel Engagement, die europäischen Verbündeten von der neuen Strategie einer flexiblen Reaktion mit dem Schwerpunkt auf konventioneller Rüstung zu überzeugen. Nicht alle waren davon angetan.
Die Deutschen leisteten hinhaltenden Widerstand mit dem Verweis auf die sündhaft teuren Anschaffungen für die Durchführung der Strategie der massiven Vergeltung. Der französische Partner sagte der NATO gleich ganz Adieu, zumindest was die Militärallianz betraf. 1966 entzog De Gaulle der NATO seine Truppen, jagte alle NATO-Institutionen aus dem Land und zog seine Offiziere und Soldaten aus den integrierten Stäben ab.
Für die NATO war dies ein harter Schlag, jedoch war jetzt der Weg frei für die neue NATO-Strategie »Flexible Response« niedergelegt in den Dokumenten MC 14/3 und MC 48/3. Doch die Frage blieb: Was tun mit der im Zeitalter der massiven Vergeltung aufgeblähten atomaren Infrastruktur?
Nicht nur rund 7000 Atomsprengköpfe in Europa mussten sicher gelagert und gewartet werden, auch ein Großteil der NATO-Luftflotten waren für nichts anderes vorgesehen und ausgebildet worden, in den Minuten nach einem Angriff des Warschauer Paktes zum atomaren Gegenschlag aufzusteigen. Quick Reaction Alert(QRA) oder Victor Alert nannte sich das System. Auch für die neu angeschafften und von den Amerikanern schon eingeführten Pershing-Raketen musste ein neues Aufgabenfeld gefunden werden.
Pershing als nukleares Abschreckungsinstrument
Für McNamara war die Sache klar: Alle Flugzeuge mit nuklearem Auftrag sollten eine konventionelle Rolle übernehmen und ihren nuklearen Auftrag an die Pershing-Raketen abtreten. Heraus kam schließlich ein Kompromiss: Alle Flugzeuge, ihre Piloten und die gesamte Infrastruktur sollten künftig eine nukleare wie auch konventionelle Rolle übernehmen können. Manche Geschwader wurden komplett nuklear abgerüstet und die dadurch aufgerissene Lücke in der atomaren Abschreckung der NATO sollten die Pershing-Raketen schließen.
Die notwendige Infrastruktur für die QRA-Aufgabe musste natürlich erst geschaffen werden und die Armada der überwiegend auf Kettenfahrzeugen etablierten Pershing-Raketen der ersten Generation erwies sich für diese Aufgabe als nicht besonders prädestiniert. Es wurden Studien in Auftrag gegeben und aufwändige Feldversuche durchgeführt. Das Ergebnis war eine komplette Umrüstung und Umstrukturierung der deutschen und amerikanischen Pershing-Verbände. Statt Kettenfahrzeuge kamen Radfahrzeuge zum Einsatz und die Gesamtzahl der Raketen in den Einsatzverbänden stieg auf 180 (108 bei der US-Army und 72 bei der Bundeswehr).
Der Schritt war jedoch logisch. Als großer Vorteil der Pershing gegenüber Flugzeugen wie dem F-104 Starfighter als Atomwaffenträger war deren Mobilität. Die Jagdbomber der NATO waren auf Airbases mit kilometerlangen Startbahnen angewiesen, die sich für gegnerische Luftattacken geradezu auf dem Silbertablett präsentierten. Demgegenüber konnten sich die Pershing-Kolonnen dank ihrer Beweglichkeit schnell von einer getarnten Stellung in eine andere bewegen. Lautes Kettengerassel wäre bei diesem Versteckspiel eher kontraproduktiv gewesen.
Allerdings dauerte es bis in die 1970er-Jahre, bis die Phase der Umstrukturierungen und des Experimentierens abgeschlossen war. Insbesondere die Planung und der Aufbau der für den avisierten QRA-Dienst vorgesehenen Bereitschaftsstellungen zogen sich hin.
Das Bundesarchiv ist voll von Planungsunterlagen für Pershing-Stellungen von Nordrhein-Westfalen bis nach Südbayern. Letztlich wurden ganze vier neu erstellt. Bis dahin behalf man sich mit aufgelassenen Nike-Hercules-Stellungen oder sogar mit primitiven Feldstellungen in weitläufigen Militärarealen. Hauptsache, die vom NATO-Oberbefehlshaber geforderte Zahl jederzeit abschussbereiter Pershing-Raketen war gewährleistet.
Von der Pershing I zur Pershing II
Kaum war die Pershing-Streitmacht in der Bundesrepublik einigermaßen konsolidiert, stand schon die nächste große Umstrukturierung ins Haus. Argwöhnisch beobachtete die NATO ab Mitte der 1970er-Jahre das stetig wachsende Mittelstreckenpotenzial der Sowjetunion. Das bestand zwar schon in der Vergangenheit, wurde jedoch bei keiner der periodischen Rüstungsrunden besonders thematisiert. Erst das Auftauchen der mobilen und mit einem Dreifachsprengkopf ausgerüsteten SS-20 veranlasste die NATO zu Gegenmaßnahmen.
Nach einer längeren Diskussion innerhalb des Bündnisses kam es im Dezember 1979 schließlich zum sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Sein Inhalt: Die NATO sollte ab 1983 insgesamt 572 Mittelstreckensysteme (108 Pershing II und 464 Cruise-Missiles) als Gegengewicht zu den sowjetischen Mittelstreckensystemen in Europa stationieren.
Gleichzeitig – und dies war der zweite Teil des Doppelbeschlusses – sollten mit der Sowjetunion Abrüstungsgespräche geführt werden, mit dem Ziel, eine Abschaffung oder zumindest eine wesentliche Dezimierung auf gleichem Niveau bei den Mittelstreckenwaffen zu erreichen.
Die Gespräche scheiterten an unterschiedlichen Zielvorstellungen der Verhandlungspartner, jedoch letztlich daran, dass beide Seiten an einem konstruktiven Ergebnis kein Interesse hatten. Obwohl es durchaus noch Situationen in der Verhandlungsphase gab, bei denen der mühsam austarierte NATO-Beschluss noch zu scheitern drohte, startete Ende 1983 die NATO mit der Installation ihrer neuen Mittelstreckensysteme. Daran konnte weder die immer stärker werdende Friedensbewegung, auf die die Sowjets große Stücke gesetzt hatten, noch der aufkommende Wankelmut mancher NATO-Partner etwas ändern.
Ein Zug Pershing II-Raketen nach dem anderen erlangte in den deutschen Standorten seine Einsatzbereitschaft und auch die Cruise-Missile-Geschwader in Deutschland und den anderen europäischen Stationierungsländern wuchsen stetig. Deutschland hatte sich bei dem Nachrüstungsdeal nämlich ausbedungen, dass der deutsche Frontstaat nicht der einzige Stationierungsort sein durfte.
So waren Italien, Belgien, die Niederlande und Großbritannien zumindest in Sachen Cruise-Missiles mit von der Partie. Die 108 Pershing II kamen jedoch ausschließlich nach Deutschland, und zwar in die Standorte Neu-Ulm, Schwäbisch Gmünd und Heilbronn/Neckarsulm. Die hatten schon eine lange Tradition als Gastgeber der Vorgängermodelle Pershing I und Pershing Ia. Zum Jahresende 1985 war die Umrüstung der drei Pershing-Bataillone von Pershing Ia auf Pershing II abgeschlossen und das »Business as usual« konnte anlaufen.
Ganz unkompliziert lief die Sache jedoch nicht. Im Januar 1985 explodierte auf dem Stützpunkt Camp Redleg auf der Heilbronner Waldheide eine Pershing II-Rakete beim Zusammenbau, tötete drei GIs und verletzte 16 weitere schwer. Den Stützpunkt Mutlangen, die Missile Storage Area (MSA) der Garnison Schwäbisch Gmünd, konnte kaum ein Militärkonvoi verlassen oder dort wieder einrücken, ohne von einer Schar Friedensdemonstranten blockiert worden zu sein.
Ob im Schwäbischen Wald, im Nordschwarzwald, im Hunsrück oder in Mittelfranken, wo immer Pershing-Einheiten ins Manöver ausrückten, waren die Demonstranten schon da und nervten die übende Truppe mit allerhand ausgefeilten Störaktionen.
Proteste gegen die Stationierung
Prominentenblockade, Richterblockade, Muttertagsblockade, Schriftstellerblockade - die Zahl der Demonstrationen und Events vor den Toren der MSA wollte kein Ende nehmen. Mutlangen, der kleine Ort oberhalb von Schwäbisch Gmünd, mutierte ab Anfang der 1980er-Jahre zur heimlichen Hauptstadt der Friedensbewegung. Prominente jeder Couleur ließen Cannes und Venedig links liegen und tauchten in Mutlangen auf, um ihren Protest gegen die Nachrüstung vor Ort zu manifestieren.
Verhindern konnte die Friedensbewegung im Prinzip nichts, außer dass das Einsatzprinzip der Pershings, nämlich möglichst lautlos und unerkannt von einer Stellung in die nächste zu wechseln und sich damit der Entdeckung des Feindes zu entziehen, damit ad absurdum geführt wurde. Mit Blaulicht und Sirene ins Manöver zu fahren oder eine taktische Überprüfung (Tactical Evaluation) zu absolvieren, erregte die Aufmerksamkeit von Freund und Feind.
Reale Existenzängste bei den Pershing- und Cruise-Missile-Einheiten verursachten jedoch Entwicklungen an ganz anderer Stelle. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan mutierte zum Ende seiner ersten Amtszeit vom geharnischten Krieger gegen den Kommunismus zum verkannten Friedensfürsten und in Moskau wurde die Riege der dahinsiechenden Gerontokraten als Generalsekretäre vom jungen und dynamischen Michail Gorbatschow abgelöst.
Der INF-Vertrag
Diese Entwicklungen führten zum Ende der Sprachlosigkeit der beiden Supermächte und zur Wiederaufnahme der Genfer Abrüstungsgespräche ab Anfang 1985. Und dann ging alles ganz schnell. Ein Gipfeltreffen jagte das nächste und schon Mitte 1987 war der Vertrag zur weltweiten Abrüstung und Vernichtung aller Mittelstreckensysteme der USA und der Sowjetunion im Prinzip fertig. Die Episode des NATO-Doppelbeschlusses wurde abgelöst durch die Episode der doppelten Nulllösung. Alle Raketen und Cruise-Missiles mit einer Reichweite zwischen 500 und 5000 Kilometern sollten verschwinden.
Im Sommer 1987 knirschte es noch einmal kurz vor dem Ziel kräftig bei den Abrüstungsgesprächen. Es ging um die 72 Raketen Pershing Ia der Bundeswehr, die die sowjetische Seite ebenfalls weg haben wollte. Eine einflussreiche Gruppe innerhalb der Regierungskoalition unter Helmut Kohl beharrte jedoch trotzig auf der deutschen Raketenstreitmacht, wohl wissend, dass es sich bei der Pershing Ia ohnehin um ein Auslaufmodell handelte, das spätestens 1991 zur Ausmusterung anstand.
Ein Nachfolgemodell aus den USA war wegen der Restriktionen aus dem INF-Vertrag nicht lieferbar. Das Risiko, für ein Scheitern der Genfer Abrüstungsverhandlungen verantwortlich zu sein, wollte in Bonn letztlich jedoch niemand eingehen, und ein Machtwort des Bundeskanzlers im August 1987 beendete die Debatte. Nach dem Vollzug des INF-Vertrags würde sich auch die Bundesrepublik von ihren Pershing-Raketen trennen.
Das Ende des INF-Vertrags
Mit der gleichen Präzision, mit der beide Seiten ihre Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen vollzogen hatten, erfolgte jetzt deren Abbau. Unter den Augen der Inspektoren der jeweils anderen Seite leerten sich die MSAs der Pershing II-Raketen und die GLCM Alert and Maintenance Areas (GAMA) der Cruise-Missile-Geschwader. Im Jahr 1991 war das Thema abgehakt und zumindest der Einflussbereich von NATO und Warschauer Pakt war frei von Boden-Boden-Flugkörpern mit einer Reichweite zwischen 500 und 5000 Kilometern. Nicht ganz: Frankreich und Großbritannien beharrten auf ihren Raketen.
Die Zeit der gegenseitigen Raketenabstinenz währte gerade mal etwas mehr als ein Vierteljahrhundert. Um den INF-Vertrag zustande zu bringen, benötigten Reagan und Gorbatschow ein paar Jahre, um ihn zu Grabe zu tragen, genügten ein paar Tage. Am 2. August 2019 kam die Kündigung vom US-Präsidenten Donald Trump, einen Tag später die von seinem russischen Widerpart Wladimir Putin.
Der »historische Schritt vorwärts in unseren Bemühungen, die Bedrohung durch nukleare Waffen zu verringern und die Sicherheit für alle Nationen zu erhöhen« (so Ronald Reagan nach Unterzeichnung des Vertrags) war Geschichte. Selbstredend führten beiden Seiten schwerwiegende Vertragsverletzungen der jeweiligen anderen Seite zur Begründung an. Mit etwas gutem Willen hätte man solche Probleme aus der Welt schaffen können.
Wahrscheinlicher wollten die Mächte mit den größten Nukleararsenalen nicht in einer Welt leben, in der zwar jede dahergelaufene Minimacht mit Mittelstreckenraketen auftrumpfen konnte, sie jedoch mit am INF-Vertrag gefesselten leeren Händen da standen. Im Zeichen des aufkommenden neuen kalten Krieges erwies sich das Fehlen eines so wichtigen Segments im Waffenspektrum als Handicap, das es schnell zu beseitigen galt.
Neue Raketen
Und die Amerikaner setzten noch eins drauf: In einer Zeremonie in der Lucius D. Clay-Kaserne in Wiesbaden wurde am 8. November 2021 das 56th Artillery Command reaktiviert, jener Verband, der über rund 30 Jahre die Pershing-Raketen der US-Army in Europa kommandierte.
Das von einem General befehligte Kommando, stationiert in einer reaktivierten Kaserne in Mainz-Kastel, wird zwar keine Pershing-Raketen erhalten, jedoch ab 2026 andere Mittelstreckensysteme der neuesten Generation – vermutlich neuerlich Raketen für den Frieden.
Von Nordhausen nach Fort Bliss
Die USA starteten 1945 die Operation Paperclip, um deutsche Experten – insbesondere Raketeningenieure wie Wernher von Braun und Arthur Rudolph für sich zu gewinnen. Diese hatten zuvor im NS-Regime an der V2-Rakete gearbeitet, oft unter Ausbeutung von KZ-Häftlingen. Trotz ihrer NS-Vergangenheit durften sie in die USA an Projekten wie der Redstone-, Pershing- und später der Saturn-V-Rakete mitwirken.
Von Remagen am Rhein, wo sie am 7. März 1945 die einzige noch intakte Rheinbrücke unter Kontrolle gebracht hatten, kämpften sich die Einheiten der 1st US Army in den folgenden Tagen und Wochen über Kassel in Richtung Berlin vor. Am 11. April 1945 erreichte die 104th US Infantry Division Nordhausen im Südharz, ein Ort nicht weniger geschichtsträchtig als die berühmte Brücke von Remagen.
Nach der Bombardierung von Peenemünde hatten die Nazis ab August 1943 unter großem Aufwand die Produktion ihrer Flugkörper V1 und V2 in eine Untertageanlage in den Südharz verlegt. Häftlinge des nahegelegenen KZ Mittelbau-Dora, eines Außenlagers von Buchenwald, mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen die Produktion der deutschen Vergeltungswaffen aufrechterhalten.
Überarbeitung, Hunger, Krankheiten und SS-Terror führten zum Tod von schätzungsweise 20 000 bis 30 000 Gefangenen (von insgesamt etwa 60 000 Inhaftierten). Ein alliierter Bombenangriff am 10. April 1945 führte zur Auflösung des Lagers und der Produktionsstätte unter Tage.
Operation Paperclip
Im Rahmen der Operation Paperclip brachten die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, insbesondere solche, die an der Entwicklung von Raketen und anderen fortschrittlichen Technologien beteiligt waren, in die USA. Die Operation begann im Jahr 1945 und wurde vom Joint Intelligence Objectives Agency (JIOA) durchgeführt. Ziel war es, das wissenschaftliche und technologische Wissen der Deutschen zu nutzen, um die USA im Wettlauf um technologische Überlegenheit gegen die Sowjetunion zu unterstützen.
Einige der bekanntesten Wissenschaftler, die im Rahmen der Operation Paperclip in die USA gebracht wurden, waren Wernher von Braun und Arthur Rudolph, die beide maßgeblich an der Entwicklung der V2-Rakete in Deutschland beteiligt waren. In den USA arbeiteten sie an Projekten wie der Redstone- und Pershing-Rakete sowie dem Apollo-Programm, das die erste bemannte Mondlandung ermöglichte.
Die Operation Paperclip war jedoch auch umstritten, da viele der beteiligten Wissenschaftler während des Zweiten Weltkriegs an Kriegsverbrechen beteiligt waren oder zumindest von ihnen profitiert hatten.
Die SS begann das Lager zu räumen und schickte rund 40 000 Häftlinge auf Todesmärsche in Richtung anderer Lager wie zum Beispiel Bergen-Belsen, was viele Gefangene nicht überlebten. Wer als Kranker nicht mitkommen konnte, wurde seinem Schicksal überlassen. Am 11. April erreichten US-Truppen das Lager und befreiten es. [1]
Die Befreier waren einerseits über die Gräuel erschüttert, andererseits fasziniert von den hunderten V2-Raketen in den Fertigungsanlagen. Kaum waren die geschundenen Häftlinge fürs Erste versorgt, tauchten britische und amerikanische Spezialeinheiten auf, um das vorgefundene Material in Sicherheit zu bringen. Zum Beutegut gehörten auch rund 100 Exemplare der V1- und V2-Flugkörper.
Die Beute wurde von Spezialeinheiten der US-Army per Bahn in der zweiten Maihälfte von Nordhausen nach Antwerpen transportiert. Von dort ging es weiter per Schiff nach New Orleans und von dort weiter nach New Mexico. Eile war geboten, denn gemäß den Beschlüssen von Jalta sollte das Gebiet ab dem 1. Juni 1945 an die Sowjetunion fallen.
Grundstein der amerikanischen Raketenentwicklung
Die von Nordhausen abtransportierte Hardware bildete den Grundstein der amerikanischen Raketenentwicklung in der Nachkriegszeit. Aber nicht nur am Material waren die Amerikaner interessiert, mehr noch trachteten sie danach, der Träger des Know-hows habhaft zu werden.
Die Elite der deutschen Raketenwissenschaft – allen voran Wernher von Braun – hatte sich vor den heranrückenden Alliierten nach Süddeutschland in Sicherheit gebracht. Über die Stationen Oberammergau und Weilheim landete die Gruppe schließlich in dem Wintersportort Oberjoch, wo sie in einem Sporthotel, bewacht von SS-Einheiten, das Kriegende abwarteten.
Sie ahnten vermutlich nicht, dass die Amerikaner sie bereits erwarteten. In der Operation Overcast – später Paperclip – wollte man deutsche Wissenschaftler ausfindig machen und deren Know-how für eigene Zwecke nutzbringend einsetzen. Die meisten deutschen Raketenspezialisten wurden von den Amerikanern fürs erste in Garmisch-Partenkirchen interniert und dort ausführlich verhört. Wernher von Braun wurde am 12. September 1945 zusammen mit sieben Kollegen nach Paris gebracht und von dort in das texanische Fort Bliss ausgeflogen.
Bis Anfang 1946 folgten noch über 100 Fachleute aus dem V2/Peenemünde-Komplex nach Texas. Fort Bliss war und ist einer der größten Militärkomplexe in den USA. Er liegt am Rande der Grenzstadt El Paso und erstreckt sich über eine Fläche von 4500 Quadratkilometer über die Bundesstaaten Texas und New Mexico. Auf dem weitläufigen Areal wurden während des Kalten Krieges auch regelmäßig Testabschüsse mit Pershing-Raketen durchgeführt. In Fort Bliss war auch die Bundeswehr stark präsent, unter anderem mit der Raketenschule der Luftwaffe.
Die Ausbildung der Pershing-Soldaten an dem Waffensystem wurde allerdings nicht in Fort Bliss, sondern am Standort Fort Sill in Oklahoma durchgeführt.
Neben den Wissenschaftlern und der Hardware waren die Amerikaner natürlich auch an den Dokumenten und Auswertungen zum Thema Raketen interessiert, die die Deutschen angelegt hatten. In kluger Voraussicht hatte von Braun und seine Leute wichtige Dokumente an einen sicheren Ort gebracht, nämlich in einen Tunnel in der Nähe der Stadt Dorten am Nordrand des Harzes. Am 21. Mai 1945 bargen die US-Truppen dort rund 14 t Akten und Dokumente. Auch diese wurden umgehend in die USA verfrachtet. [2]
Die Raketenentwicklung in den USA verlief in den ersten Nachkriegsjahren nicht gerade rasant. Diverse Institutionen vor allem aus dem militärischen Bereich waren mit dem Thema befasst. Die allgemeine Demobilisierung und Abrüstung in den USA der frühen Nachkriegsjahre bremsten auch die Aktivitäten der Raketenleute in Fort Bliss.
Man startete eine Reihe der erbeuteten V1 und V2 in der White Sands Proving Ground (WSPG) in New Mexico, um weitere Erkenntnisse in Sachen Raketentechnik zu gewinnen. Zwischen 1946 und 1951 starteten die Amerikaner mit deutscher Hilfe 66 V2-Raketen in New Mexico.
Das Schicksal Arthur Rudolphs
Im Übrigen wurde erst 1946 die Anwesenheit und die Funktion der deutschen Wissenschaftler in den USA allgemein bekannt, was nicht überall in der Öffentlichkeit Begeisterung hervorrief. Die eigentliche Aufarbeitung dieses eigenartigen Verständnisses einer Entnazifizierung Deutschlands begann jedoch erst 30 Jahre später und traf in aller Härte vor allem einen Mann, der eng mit der Entwicklung der Pershing-Rakete verbunden war – Arthur Rudolph.
Arthur Rudolph spielte neben Wernher von Braun in der US-Raumfahrt eine Schlüsselrolle. 1950 wurde er ins Redstone Arsenal (Alabama) versetzt und 1956 zum Technischen Direktor des Redstone-Raketenprojektes sowie zum Projektmanager des MGM-31 Pershing-Missile-Projektes ernannt.
Am 23. Februar 1959 erhielt er die Ehrendoktorwürde des Rollins College in Winter Park (Florida). Später erhielt er den Exceptional Civilian Service Award, die höchste Auszeichnung der US-Armee für Zivilisten. 1961 wechselte er zur NASA, wo er am Saturn-V-Programm beteiligt war und maßgeblich am Erfolg der Apollo-11-Mondlandung 1969 beteiligt war. Vor seiner Pensionierung 1969 wurde er mit hochrangigen NASA-Auszeichnungen geehrt.
Alle Ehrungen und Auszeichnungen nützten Rudolph jedoch wenig, als 1982 das Office of Special Investigations (OSI) aufgrund seiner NSDAP-Vergangenheit und mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Mittelbau-Dora Untersuchungen gegen Rudolph einleitete. Das Justizorgan OSI war 1979 vom US-Justizministerium gegründet worden, um nach nationalsozialistischer Kriegsverbrecher zu fahnden, die in die Vereinigten Staaten eingewandert waren.
Von den OSI-Ermittlern unter Druck gesetzt, verzichtete Rudolph 1983 auf seine US-Staatsbürgerschaft und emigrierte 1984 als Staatenloser nach Deutschland. Deutsche Behörden ermittelten im Jahr 1987 zwar gegen ihn, stellten jedoch keine Straftaten fest und erkannten ihm die deutsche Staatsbürgerschaft zu.
In den USA löste der Fall Debatten aus: Unterstützer zweifelten die OSI-Ermittlungen an, während Kritiker seine Auszeichnungen aberkennen wollten. Rudolphs Versuche, in die USA zurückzukehren, scheiterten. Er starb 1996 in Hamburg. Es war ein tiefer Sturz, den der ehemalige Star der amerikanischen Weltraum-Community erlebte. Sein Fall bleibt ein umstrittenes Kapitel der Geschichte, das seine Verdienste in der Raumfahrt mit seiner NS-Vergangenheit kontrastiert. [3]
Auch die Operation Paperclip selbst wurde in den 1980er-Jahren noch einmal aufgearbeitet. Wissenschaftler und Journalisten schauten vierzig Jahre später noch einmal genauer hin, werteten bis dahin geheim gehaltene Dokumente aus und kamen zu dem Ergebnis: Die amerikanischen Militärs seien so versessen auf das Know-how der deutschen Wissenschaftler gewesen, dass sie sich weder um Proteste anderer Stellen noch um amerikanisches Recht scherten. [4]
Eine eigene Geheimdienstgruppe hätte sich um nichts anderes gekümmert, als sich um die Vertuschung der braunen Vergangenheit belasteter Wissenschaftler zu kümmern. Dafür wurden belastende Dossiers entweder zurückgehalten oder überarbeitet. [5]
Wernher von Braun
Wernher von Braun wurde am 23. März 1912 in Wirsitz, Provinz Posen, geboren. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Naturwissenschaften, Astronomie und Raketentechnik. Mit 13 Jahren schoss er im Berliner Tiergarten die ersten Feuerwerksraketen in den Himmel. Im April 1930 legte er die Abiturprüfung ab, wurde Mitglied des Vereins für Raumschifffahrt, der auf dem Raketenflugplatz Berlin in Reinickendorf mit Raketen mit Flüssigkeitstriebwerken experimentierte.
Von Braun studierte ab 1930 an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. 1934 promovierte er an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin mit einer Arbeit über »Konstruktive, theoretische und experimentelle Beiträge zu dem Problem der Flüssigkeitsrakete«.
Auch im praktischen Bereich waren seine Arbeiten in diesem Jahr erfolgreich. Das von ihm konzipierte Aggregat 2 legte von der Nordseeinsel Borkum einen erfolgreichen Start hin. Damit stand einer erfolgreichen Karriere im aufkommenden deutschen Raketenprogramm nichts mehr im Wege.
V2-Produktion in Mittelbau-Dora
Dessen erste Station war die auf der Insel Usedom von Luftwaffe und Heer errichtete Heeresversuchsanstalt Peenemünde, deren technischer Direktor von Braun 1937 wurde. Bis zum alliierten Bombenangriff auf Peenemünde im August 1943 konnte von Braun hier das Aggregat 4, von den Nazis in V2 umbenannt, entwickeln, testen und produzieren. Wie bei allen großen Rüstungsprojekten jener Zeit wurden auch in Peenemünde großzügig KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter eingesetzt.
Der Bombenangriff am 18. August 1943 ließ den Plan reifen, die Produktion unter die Erde zu verlegen. Das Ergebnis der Überlegungen war die Anlage Mittelbau-Dora, in der bis Kriegsende die Fertigung der A4/V2 lief. Als US-Truppen die Untertageanlage eroberten, befand sich Wernher von Braun auf Befehl von Hans Kammler auf dem Weg nach Süddeutschland.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von Braun im Rahmen der Operation Paperclip in die USA gebracht und arbeitete an der Entwicklung von diversen Raketen mit. 1955 erhielt er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ab 1960 war er für die NASA tätig und spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Saturn-V-Rakete, die die Astronauten im Apollo-Programm zum Mond brachte.
Von Braun war ein gefeierter Forscher, dessen Beiträge zur Raumfahrt unbestritten sind. Gleichzeitig bleibt seine Vergangenheit im Dritten Reich umstritten. Das Schicksal seines Kollegen Arthur Rudolphs blieb ihm jedoch erspart. Er starb am 16. Juni 1977 in Alexandria, Virginia.
Zusammenfassend kann man sagen: Die Operation Paperclip ermöglichte den USA einen technologischen Vorsprung im Kalten Krieg, war aber ethisch höchst umstritten. Während deutsche Wissenschaftler die US-Raumfahrt prägten, wurden Kriegsverbrechen lange ignoriert. Erst Jahrzehnte später kam es zu einer kritischen Aufarbeitung.
Anmerkungen
1. Seit 1966 existiert die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die an die Opfer erinnert und über die Verstrickung von Wissenschaft und Industrie in NS-Verbrechen aufklärt. Eine eigene Website bietet unter https://www.dora.de online Informationen zur Geschichte des KZs Mittelbau-Dora.
2. Eine detaillierte Zusammenstellung der US-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Operation Paperclip bietet Lethbridge, Cliff im Kapitel 6 seiner Online-Präsentation unter https://www.spaceline.org/.
3. »Zerlumpte Gestalten«, in: Der Spiegel 44/1984
4. Jacobsen, Annie: »Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America«, Little, Brown and Company, 2014
5. »Hoher Preis«, in: Der Spiegel 12/1985
Raketen für die US-Army und die NATO
Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief die US-Raketenentwicklung zunächst schleppend, gewann jedoch mit dem Korea-Krieg und der NATO-Gründung an Dynamik. 1950 wurde Wernher von Brauns Team ins Redstone Arsenal (Alabama) verlegt, wo es an militärischen Kurzstreckenraketen arbeitete.
Die Raketenentwicklung in den USA dümpelte in den ersten Nachkriegsjahren ohne nennenswerte Fortschritte vor sich hin. Mit dem Korea-Krieg und der Gründung der NATO nahmen die Programme etwas Fahrt auf.
Schon im Oktober 1948 hatte die US-Army in Huntsville in Alabama ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Raketen errichtet - das Redstone Arsenal. Dorthin wurde im April 1950 auch das Team um Wernher von Braun verlegt. Ihre künftige Aufgabe: Die Entwicklung von militärisch nutzbaren Kurzstreckenraketen. Das erste Projekt war die Rakete Honest John, die zusammen mit der Douglas Aircraft Company entwickelt wurde und von der fast 15 000 Stück produziert wurden. [1]
Kurzstreckenrakete Honest John
Die Honest John war die erste nuklearfähige Kurzstreckenrakete der US-Army. Sie wurde 1953 in Dienst gestellt und blieb bis in die 1980er Jahre im Einsatz. Sie erreichte Ziele in einer Entfernung zwischen 24 bis 48 km mit einer Geschwindigkeit von bis zu Mach 2,3. Die Rakete war etwa 8,3 m lang und das Startgewicht betrug rund 2,7 t.
Sie konnte sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe mit einer Sprengkraft von bis zu 40 Kilotonnen TNT (W31) tragen. Die Rakete hatte den Nachteil, dass sie über keine aktive Steuerung oder Zielkorrektur nach dem Abschuss verfügte. Sie folgte einer vorher berechneten Flugbahn, ähnlich wie ein Artilleriegeschoss. Die Steuerung beschränkte sich auf die Ausrichtung der Abschussrampe vor dem Start, was naturgemäß zu einem hohen Circular Error Probable (CEP) führte.
Das Waffensystem Honest John wurde als taktische Rakete überwiegend auf Divisionsebene eingesetzt, um feindliche Truppenkonzentrationen, Panzerverbände und andere strategische Ziele zu bekämpfen. Die Rakete war auf einem mobilen Startfahrzeug montiert, was ihr eine hohe Flexibilität verlieh.
Die erste Version M31 wurde 1960 durch die verbesserte Version M50 mit größerer Reichweite und verbesserter Treffgenauigkeit ersetzt. Ab den 1980er Jahren wurde die Honest John bei den meisten NATO-Armeen von der moderneren und zielgenaueren MGM-52 Lance abgelöst. [2]
Ab Ende der 1950er-Jahre wurden nach und nach auch die Streitkräfte anderer NATO-Staaten mit diesem Waffensystem beliefert. Die Planungen der NATO im Rahmen von MC 70 sahen vor, die europäischen Armeen bis 1961 mit 72 Batterien mit insgesamt 144 Honest John-Launchern auszurüsten. Dazu kamen noch 20 Batterien der Amerikaner.
Eine veritable Atomstreitmacht, die die Mannschaft von Wernher von Brauns da in kurzer Zeit aus dem Boden stampfte. Jedenfalls war dies über lange Jahre der Standard-Atom-Hammer, den die internationalen NATO-Armeen zwischen Flensburg und dem Bodensee in ihren Arsenalen hatten. Auch in Südkorea war die Rakete stationiert.
Eine weitere Kurzstreckenrakete aus dem Redstone-Arsenal war die Corporal, die auf deutschen Raketentechnologien aus dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere der V2-Rakete, basierte. Der erste erfolgreiche Testflug fand 1952 statt. Die Rakete wurde 1955 bei der US-Army eingeführt und blieb bis in die 1960er Jahre im Einsatz. Sie übertraf die Reichweite der Honest John mit 75 bis 150 km um einiges, weshalb sie vor allem auf Korpsebene eingesetzt wurde.
Sie konnte einen nuklearen Sprengkopf mit einer Sprengkraft von 20 kt TNT (W7) tragen. Die Rakete wurde von einem Flüssigtreibstoffmotor angetrieben, der eine Mischung aus Anilin und roter rauchender Salpetersäure verwendete. Das Lenksystem bestand aus einer Kombination aus inertialem Navigationssystem und Funksteuerung.
Ersetzt wurde die Corporal durch die Sergeant, die vom Jet Propulsion Laboratory entwickelt und von Sperry Utah hergestellt wurde. Sie hatte eine Länge von 10,52 m und die Startmasse betrug etwas mehr als 4,5 t. Die Rakete konnte ihren 200 kt-Sprengkopf (W52) maximal 140 km weit schießen. Die Sergeant kam auch bei der Bundeswehr auf Korpsebene zum Einsatz, wo sie bis in die 1980er-Jahre die stärkste Atomwaffe im Heer der Bundeswehr darstellte, bevor sie von der Lance abgelöst wurde. [3]
Allerdings gab es auch eine Fraktion in der amerikanischen Raketen-Community, bei der die friedliche Erforschung des Weltraums im Mittelpunkt stand. Immerhin stand das geophysikalische Jahr 1957/1958 vor der Tür, eine internationale wissenschaftliche Initiative, die sich auf die Erforschung der Erde und ihrer physikalischen Eigenschaften konzentrierte und die von der Internationalen Geophysikalischen Union (IGY) organisiert wurde. [4]
Während dieses Zeitraums führten Wissenschaftler aus der ganzen Welt Beobachtungen und Experimente durch, um mehr über Phänomene wie Erdmagnetismus, Zusammensetzung der Atmosphäre, kosmische Strahlung und andere geophysikalische Prozesse zu erfahren. In Sachen Weltraum wollten die Amerikaner mit ihrem Satelliten Explorer I aus diesem Anlass einen spektakulären Coup landen – dieser blieb jedoch aus.
Anmerkungen
1. Gibson, James N.: »History of the Army's Nuclear Capable Rocket Program«, in: Field Artillery, August 1987, S. 20
2. Brents, Helen: »History of the Basic (M31) Honest John Rocket System (U) 1950- 1964«, URL: http://www.redstone.army.mil/history/pdf/honestj/honestjn.pdf (abgerufen am 8. April 2025)
3. Die Entwicklungsgeschichte der Sergeant-Rakete ist dargestellt im Kapitel 24 »The Army’s Second Generation Offensive Tactical Nuclear Weapons« des E-Books »A Technical History of America’s Nuclear Weapons: Their Design, Operation, Delivery, and Deployment« von Goetz, Peter A., September 2020.
4. Glennan, Thomas Keith: »The Birth of NASA«, Washington (DC) 1993
Redstone - der Vorläufer der Pershing
Die Redstone-Rakete war ein Produkt des Kalten Krieges, das die nukleare Abschreckungsstrategie der USA in Europa maßgeblich prägte.
Ihre Entwicklung, basierend auf der Technologie der V2-Rakete, spiegelte die rasante Aufrüstung in den 1950er Jahren wider. Trotz ihrer beeindruckenden Sprengkraft und der strategischen Bedeutung, die ihr zugemessen wurde, war die Redstone-Rakete in ihrer praktischen Anwendung komplex und mit Risiken verbunden. Deshalb blieb sie auch nicht lange im Einsatz und wurde von der Pershing-Rakete abgelöst.
Die Anfänge der Redstone-Rakete gehen zurück auf das Jahr 1944, als die US-Army die Firma General Electric mit einer Studie zu einem Raketenprojekt unter dem Namen Hermes (Raketenbezeichnung: SSM-A-16, Hermes A-3B) beauftragte. Verlangt wurde eine Reichweite von rund 800 km. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs zeigte niemand mehr größeres Interesse an dem Projekt bis zum Jahr 1950, als der Korea-Krieg begann und die Zeichen plötzlich wieder auf Aufrüstung standen. Die Voraussetzungen hatten sich jedoch geändert.
Gefragt war jetzt ein Träger für die seit 1945 verfügbaren Atomwaffen. Deren erste Generation brachte jedoch ein erhebliches Gewicht auf die Waage, das die Raketen der ersten Generation vor einige Probleme stellte. Die erste Atombombe Little Boy, die über Hiroshima zum Einsatz kam, wog über 4 t. Der erste Sprengkopf für Cruise-Missiles wie die Matador, der ab 1954 in Produktion ging, hatte ein Gewicht von immerhin noch 1,2 t.
Diese Gewichtsdimensionen führten zu Abstrichen bei der geforderten Reichweite auf nun nur noch rund 400 km. Die von Wernher von Braun und Walter Dornberger entwickelte Redstone-Rakete wies viele Gemeinsamkeiten mit der A4/V2 auf, angefangen vom Flüssigkeitsantrieb über das Treibstoffgemisch (Alkohol/flüssiger Sauerstoff) bis hin zur Reichweite von rund 400 km. Der wesentliche Unterschied bestand in der Zerstörungskraft. Für die Redstone wurden zwei unterschiedliche Atomsprengköpfe entwickelt: Der W39 Y1 hatte ein Zerstörungspotenzial von 3,8 Mt, während der W39 Y2 immerhin noch 500 kt auf die Waage brachte.
Die Entwicklung der Rakete begann 1950. Da das Team Dornberger/von Braun auf die Technik und die Erfahrung mit der V2 zurückgreifen konnte, verlief die Entwicklung sehr schnell. Schon im Oktober 1952 konnten die Raketenspezialisten aus Peenemünde Vollzug melden. Der amerikanische Rüstungs- und Autokonzern Chrysler erhielt den Auftrag, die Rakete zu produzieren.
Am 20. August 1953 erhob sich zum ersten Mal eine Redstone in den Himmel. Zahlreiche weitere Testflüge folgten. Von den insgesamt 37 Probeflügen waren immerhin 27 erfolgreich. Jedenfalls erhielt Chrysler 1955 das Go für die Serienproduktion. Parallel zu den umfangreichen Tests und der Schulung des Personals wurden auch Überlegungen über Einsatz und Gliederung von Redstone-Einheiten angestellt. Auf einer Konferenz im Februar 1956 wurden dazu erste Entscheidungen getroffen. [1]
Eine Redstone-Gruppe sollte möglichst autark operieren können, also über alle notwendigen Unterstützungseinheiten verfügen. Dies führte beispielsweise dazu, dass zur Gruppe auch eine Einheit gehören sollte, die flüssigen Sauerstoff unter Einsatzbedingungen produzieren konnte. Im Juni 1957 war der erste Verband mit Redstone-Raketen, die 40th Field Artillery Missile Group, aufgestellt. Das weitere Programm sah insgesamt vier Raketen-Gruppen vor. Für den europäischen Einsatzbereich waren drei Gruppen vorgesehen, eine sollte in den USA verbleiben. 1958 reduzierte die US-Army das Programm auf insgesamt drei Verbände.
Verlegung nach Europa
Die 40th und 46th Field Artillery Missile Group sollten zur 7th US Army nach Europa verlegt werden und die 209th in Fort Sill verbleiben. Die primäre Aufgabe dieser Gruppe war das Training von Personal und die Assistenz bei Testabschüssen, die prinzipiell nur in den USA erfolgten. Im Mai 1958 absolvierte die 40th Field Artillery Missile Group ihren ersten Testabschuss in Cape Canaveral. Der verlief erfolgreich, und einer Verlegung zur 7th US Army in Europa stand damit nichts mehr im Wege.
Im Juni 1958 verlegte die erste Redstone-Einheit in die Bundesrepublik Deutschland. Am 18. Juni 1958 schiffte der Verband mit dem Ziel Saint-Nazaire in Frankreich ein. Von dort ging es per Landmarsch quer durch Frankreich zum Bestimmungsort Wackernheim bei Mainz. Mit im Gepäck: eine von insgesamt vier Raketen, die als Grundausstattung für den Verband vorgesehen war. Die restlichen drei Raketen kamen erst im November 1958 in Deutschland an.
Es war eine merkwürdige Streitmacht, die da im Raum Wackernheim/Bad Kreuznach und Neckarsulm/Heilbronn auftauchte. Trotz ihrer enormen Sprengkraft von vier Megatonnen war der militärische Nutzen fraglich. Jedes Redstone-Bataillon hatte zwar nur zwei Raketen, für deren Fahrt zum Startplatz war jedoch ein Konvoi aus 20 teils überschweren Fahrzeugen nötig. Dort angekommen musste das Personal zuerst die exakte Position ermitteln, dann konnten sie die Rakete auf ihrer genau nivellierten Startplattform zusammenbauen. Wenn die Mannschaften dies in acht Stunden schafften, war das eine gute Zeit. [2]
Allerdings war die Rakete dann noch nicht startbereit. Kam der Startbefehl, erfolgte zuerst die Betankung mit flüssigem Sauerstoff und Ethanol, was noch einmal mindestens 15 Minuten in Anspruch nahm. Und ungefährlich war dieser letzte Schritt auch nicht. Bilder von Fehlstarts zeigten eindrucksvoll, welches Inferno außer Kontrolle geratene Treibstoffmischungen wie Sauerstoff und Ethanol anzurichten vermochten.
Ein noch größeres Inferno erwartete das Zielgebiet, in dem die Rakete nach wenigen Minuten Flug ihren 4-Mt-Sprengkopf zur Detonation brachte. Bei einer Reichweite von rund 400 km hätte es überwiegend Deutsche getroffen. Am Rand eines Kreises mit einem Radius von 400 km lagen Städte wie Bremen, Hannover, Magdeburg, Leipzig, Pilsen, Nürnberg und München.
Weiter wäre ein Abschuss aus dem Raum Wackernheim nicht gegangen. Aber das war ja auch die damals gültige Strategie der NATO: Rückzug zum Rhein und dabei den russischen Vormarsch mit allen Mitteln verhindern. Atomsprengköpfe im Megatonnenbereich wurden als adäquates Mittel zur Erreichung dieses Zwecks angesehen. Dass der Rückzug der alliierten Truppen mit der weitgehenden Zerstörung des Rückzugsgebiets einherging, wurde als Kollateralschaden von den Atomkriegsplanern der NATO billigend in Kauf genommen.
Die 46th Field Artillery Missile Group kam ein Jahr später nach Deutschland. Diesmal ging es per Schiff nach Bremerhaven, wo sie im April 1959 ankam. Von dort ging es weiter in die Artilleriekaserne nach Neckarsulm, dem endgültigen Bestimmungsort, im Gepäck vier Redstone-Raketen. Den scharfen Schuss übten die beiden in Deutschland stationierten Artillerieeinheiten in den USA, wo mit der White Sands Missile Range ein Übungsgelände mit den passenden Dimensionen zur Verfügung stand. Ansonsten waren die Einheiten mit Nachschubproblemen und angeordneten Umrüstungen beschäftigt und bemüht, durch Übungen und Manöver Technik und Personal auf einem hohen Einsatzniveau zu halten. Dazu kamen noch einige Show-Auftritte, beispielsweise in Mainz und in Murnau, auf denen der Presse und den NATO-Partnern die neuen Raketen präsentiert wurden. Roter Rauch, den die Rakete umwehte, simulierte am Ende der Demonstration einen erfolgreichen Abschuss. [3]
Nur noch eine Übergangslösung
Wenn es jedoch um die Sprengköpfe und deren Lagerung ging, wurden die Amerikaner eher einsilbig. Der Grundsatz »neither confirm nor deny« in Sachen Atomwaffen wurde schon damals eisern praktiziert. Erst in späteren Jahren gab es begründete Vermutungen, dass sich die entsprechenden Lager im Ober-Olmer Wald bei Mainz beziehungsweise in Wilfensee bei Neckarsulm befanden. Im Herbst 1958 wurde die Redstone-Entwicklung überarbeitet. Das System sollte ab sofort nur noch eine Übergangslösung darstellen, solange bis die neu konzipierte Pershing-Rakete einsatzfähig war. Die Army Ballistic Missile Agency entschied, die Produktion auf 62 Raketen zusammenzustreichen.
Um diese Raketenstationierung richtig beurteilen zu können, darf man den politischen Hintergrund jener Zeit nicht außer Acht lassen. Im Oktober 1957 hatte die Sowjetunion mit Sputnik 1 den ersten Satelliten ins All geschossen. Der piepsende Satellit, der die Erde umkreiste, traf die USA ins Mark. Vom Sputnik-Schock war die Rede und die Administration in Washington tat alles, um diese Schmach zu tilgen. Es war schließlich eine modifizierte Redstone, die – nach zahlreichen Fehlversuchen - den ersten amerikanischen Satelliten namens Explorer am 1. Februar 1958 erfolgreich ins All schoss. Dass die US-Army ihr bestes Stück auch gleich an die Front bringen wollte, war zu verstehen – ungeachtet der Nachteile und Risiken, die damit verbunden waren.
Und auch die Reichweite von gerade einmal 330 km war zumindest im Hinblick auf die damalige NATO-Strategie kein Problem. Die wenigen NATO-Truppen, die damals an der Frontlinie in Deutschland stationiert waren, sollten sich kämpfend zum Rhein zurückziehen (notfalls sogar bis zu den Pyrenäen) und so lange durchhalten, bis das nukleare Bombardement der strategischen Luftwaffe der USA den Feind in die Knie gezwungen hätte. Dass beim Rückzug zum Rhein das Gebiet der Bundesrepublik vermutlich als atomare Wüste zurückgeblieben wäre, wurde als unvermeidbarer Kollateralschaden in Kauf genommen.
In diesem Frontgebiet ging es zu jener Zeit ohnehin hoch her. Am 27. November 1958 avisierte Nikita S. Chruschtschow den übrigen Besatzungsmächten in einer Note, dass er der DDR die Kontrolle über die Verbindungswege zwischen Westdeutschland und West-Berlin zu übertragen gedächte – die zweite Berlin-Krise nach 1948 war da. Militärisch erschwerend kam noch hinzu, dass die Sowjetunion ab Mai 1959 in der DDR bei Vogelsang und Fürstenberg/Havel ihre R-5-Rakete stationierte. [4]
Das Werk von Wernher von Brauns östlichem Widerpart Sergei Pawlowitsch Koroljow hatte eine Reichweite von bis zu 1200 km und einen Sprengkopf von 30 beziehungsweise 80 kt. [5]
Anmerkungen
1. Bullard,John W.: »History of the Redstone Missile System«, URL: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA434109.pdf (abgerufen am 8. April 2025)
2. Zum Redstone-Waffensystem hat die US-Army diverse Field Manuals herausgegeben, so zum Beispiel FM 6-25 »Field Artillery Missile Group (Redstone)«, oder FM 6-35 »Field Artillery Missile Redstone«. Diese und weitere Dokumente sind abrufbar von der Webseite http://www.myarmyredstonedays.com/page12.html von Jim Ryan, der als Soldat bei einer Redstone-Einheit gedient hat (abgerufen am 8. April 2025).
3. Die Redstone-Verbände durchliefen während ihrer Präsenz in Deutschland einige organisatorische Veränderungen. Siehe dazu: Rodgers, George M.: »From group to battalion—Redstone Reorganized« in Artillery Trends, Februar 1962, S. 32, URL: https://tradocfcoeccafcoepfwprod.blob.core.usgovcloudapi.net/fires-bulletin-archive/1962/FEB_1962/FEB_1962_FULL_EDITION.pdf (abgerufen am 9. April 2025)
4. Hintergründe zur zweiten Berlin-Krise liefert Wettig, Gerhard: »Chruschtschows Berlin-Krise 1958 bis 1963: Drohpolitik und Mauerbau«, Berlin 2006
5. Bayer, Wolfgang: »Geheimoperation Fürstenberg«, in: Der Spiegel 3/2000
Von der Redstone zur Pershing I
Die Pershing-Rakete wurde entwickelt, um die Redstone-Rakete abzulösen und dabei sowohl die Reichweite als auch die Treffgenauigkeit erheblich zu steigern. Die Entwicklung erhielt durch den Sputnik-Schock neuen Auftrieb.
Die Firma Martin Marietta erhielt den Hauptauftrag für die Entwicklung und Produktion der Rakete. Für die Herstellung des Leitsystems und der Feststoffmotoren waren die Firmen Eclipse Pioneer Division und Thiokol verantwortlich. Das Los Alamos Scientific Laboratory entwickelte den Atomsprengkopf W50.
Am 31. Oktober 1956 forderte der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des United States Army Ordnance Corps auf, eine Machbarkeitsstudie für eine ballistische Rakete mit einer Reichweite von rund 322 km zu erstellen. Die zuständige Behörde leitete die Anfrage an die Army Ballistic Missile Agency (ABMA) weiter. Bevor das Projekt richtig starten konnte, erlitt es einen Monat später einen herben Rückschlag.
Zuständigkeit der Army wird beschnitten
Am 26. November 1956 veröffentlichte der damalige Verteidigungsminister Charles E. Wilson ein nach ihm benanntes Memorandum, das der US-Armee die Zuständigkeit für alle Raketen mit einer Reichweite von rund 322 km oder mehr entzog. Darunter fiel natürlich auch die geplante Pershing-Rakete. Das Wilson-Memorandum erwies sich jedoch als kurzlebig. Der Sputnik-Schock, ausgelöst durch den Start des ersten sowjetischen Satelliten, führte zu einer grundlegenden Neuausrichtung der US-Raketenprogramme.
Das Wilson-Memorandum wurde zurückgezogen und Anfang Januar 1958 empfahlen die vereinigten Stabschefs, mit der Entwicklung einer Feststoffrakete als Ersatz für die Redstone-Rakete fortzufahren. Der Verteidigungsminister gab seine Zustimmung und die ABMA konnte mit der Entwicklung des Nachfolgesystems für die Redstone fortfahren.
Zunächst trug das Projekt den Arbeitstitel Redstone-S. Erst am 16. Januar 1958 verkündete das Department of Defense (DOD) offiziell, dass die neue Feststoffrakete der US-Army den Namen des legendären US-Generals John J. (Black Jack) Pershing tragen sollte, der im Ersten Weltkrieg das US-Expeditionskorps in Europa zum Sieg geführt hatte. [1]
Am 19. Februar 1958 übertrug der Heeresminister die Verantwortung für die Gesamtleitung des Pershing-Programms dem Army Ballistic Missiles Committee. Gleichzeitig ging die Verantwortung für das Systemmanagement und die technische Planung der Pershing I an die ABMA, die für die Entwicklung der neuen Rakete von sieben Unternehmen Angebote einholte. Mit Chrysler, Lockheed, Douglas, Convair, Firestone, Sperry-Rand und Martin beteiligte sich die damalige Crème der amerikanischen Rüstungsindustrie an dieser Ausschreibung.
Martin Marietta wird beauftragt
General John Medaris und Arthur Rudolph leiteten das Auswahlverfahren der ABMA, aus der die Firma Glenn L. Martin Company (nach einer Fusion im Jahr 1961 Martin Marietta genannt) als Sieger hervorging. Sie erhielt einen Vertrag für Forschung, Entwicklung und die Produktion von Vorserienmodellen der geplanten Rakete. [2]
Positiv auf die Entscheidung zugunsten von Martin wirkte sich sicher aus, dass die Firma gerade eine neue Raketenfabrik in Sand Lake, Florida, errichtet hatte. Die lag in unmittelbarer Nähe zur Atlantic Missile Range (auch als Eastern Test Range bekannt), wo später dann die Flugtests mit der neuen Rakete durchgeführt werden konnten.
Neben Martin als Hauptauftragnehmer kamen auch noch die Eclipse Pioneer Division von Bendix Aviation für die Herstellung des Leitsystems der Rakete und Thiokol für die Entwicklung der Feststoffmotoren bei der Auftragsvergabe zum Zuge.
Die Eclipse Pioneer Division hatte schon einige Erfahrung bei der Realisierung von Steuerungskomponenten für Flugzeuge und Raketen, darunter den Pioneer Bubble Sextant ST-90 für die Rakete Jupiter und den ST-80 für die PGM-11 Redstone. Für die Pershing-Rakete steuerte die Firma das neu entwickelte Trägheitsnavigationssystem ST-120 bei.
Das ST-120 (Stable Table-120) war ein Trägheitsnavigationssystem (englisch: Inertial Guidance System), das von Eclipse-Pioneer hergestellt wurde. Es bestand aus Beschleunigungssensoren (Accelerometern) und Gyroskopen, die Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung der Rakete ermittelten und an den Bordcomputer übertrugen.
Vor dem Start wurde das ST-120 mithilfe eines horizontalen Theodoliten und einer Steuerbox nach Norden ausgerichtet und diese Nordausrichtung wurde dann in den Computer eingegeben. Die Zielgenauigkeit der Rakete, die damit erreicht wurde, betrug etwa 400 Meter.
In Verbindung mit dem analogen Bordcomputer bildete das ST-120 das Steuerungssystem der Rakete. Als rein mechanisch-elektronisches System war es unempfindlich gegenüber Störungen wie elektronischer Kriegsführung oder Wetterbedingungen.
Das 1929 gegründete Unternehmen Thiokol stellte ursprünglich synthetisches Gummi und verwandte Chemikalien her. Erst später spezialisierte sich die Firma auf die Herstellung von Feststoff-Raketentriebwerken. Auf diesem Gebiet erreichte sie in den USA eine marktbeherrschende Stellung.