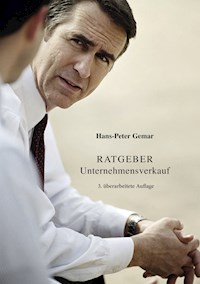
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wenn Sie vor der Frage stehen: wie verkaufe ich mein Unternehmen?, dann liefert Ihnen dieses Buch einen praktischen Leitfaden für eine erfolgreiche Umsetzung. Es werden steuerliche Gesichtspunkte behandelt, Fragen zur Unternehmensbewertung beantwortet, aber auch insbesondere auf methodische Gesichtspunkte hingewiesen, wie auch auf psychologische Barrieren, Verhaltungsmuster und Erwartungshaltungen Ihrer Zielgruppe. Unternehmensverkauf ist ein Thema mit interdisziplinärem Charakter. Verschiedene Teilaspekte, Abfolgen von Ereignissen müssen systematisch in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden und nur die richtige Kombination sämtlicher Mosaiksteine wird den gewünschten Erfolg zeitigen. Wenn Sie es bisher gewohnt waren, schwer verständliche, wissenschaftliche oder theoretische Beiträge zu einzelnen Teilaspekten zu lesen, so finden Sie hier einen praktischen Ratgeber, einen Aktionsfahrplan, der den gesamten Prozess Schritt für Schritt auf 220 Seiten in leicht verständlicher Sprache beschreibt und die notwendigen Muster-Dokumente und Checklisten liefert. Dieser Ratgeber erschien erstmals 2008 und zwischenzeitlich wurde der Inhalt mehrfach aktualisiert und erweitert, zuletzt im Februar 2015. Der Ratgeber befindet sich zudem auf den Empfehlungslisten verschiedener Handelskammern. Der Autor ist seit über 16 Jahren einer der Geschäftsstellenleiter der bundesweiten Concess M+A Partner, einem Unternehmen, das seit Gründung viele hundert Transaktionen erfolgreich initiiert und durchgeführt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich danke insbesondere auch meiner Kollegin und meinen Kollegen, die mit ihren Erfahrungen und Beiträgen zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben:
Frau Christiane Nöthen
Herrn Ronald Franke
Herrn Detlef Golombiewski
Herrn Herbert Gottlieb
Herrn Gunter Klippel
Herrn Klaus Kunz
Herrn Timo Lang
Herrn Lutz Lehmann
Herrn Bernd Mümmler
Herrn Reinhard Scheiba
Herrn Helmut Schwab
INHALT
Vorwort zum Kapitel 1
Kapitel 1
Drehbuch eines gescheiterten Unternehmensverkaufs
Erste Ideen
Der Plan A
Die Geister, die man rief
Der Plan B
Die lieben Kaufinteressenten
Einsichten
Erneut ins Gefecht
Vom Ungemach schriftlicher Abmachungen
Blattschuss
Gefährliches Spiel
Das Finale
Resumé
Häufige Verkäuferfloskeln
Vorwort zum Kapitel
Kapitel
Unternehmensverkauf in Deutschland - die Ausgangssituation
Einleitung
Wettbewerbssituation der zum Verkauf stehenden Unternehmen
Die Notwendigkeit eines adäquaten Angebots
Zur Einmaligkeit des eigenen Angebots
Käuferverhalten und Erwartungen
Finanzinvestoren und Beteiligungsgesellschaften
Andere Marktteilnehmer und Wettbewerber
Existenzgründer
Verkäuferverhalten und Erwartungen
Die richtige Prozessabfolge beachten
Das Gesetz der großen Zahl
Aufgabe der Verkaufsabsicht
Verkauf: Selbstversuch oder Einschaltung fachkundiger Dritter
Der Zeitbedarf
Know-How und sonstige Anforderungen
Kaufinteressentenakquisition
Anforderungen an einen Unternehmensvermittler
Der Selbstversuch
Einbindung von Vertrauenspersonen
Printmedien
Internet-Datenbanken
Vertraulichkeit sicherstellen / Machbarkeit prüfen
Der Prozessablauf - Überblick
Bestandsaufnahme
Kundenstrukturen
Inhaberbezogenheit
Entwicklungskontinuität
Betriebsimmobilie
Bilanzstrukturen
Das Verkaufsangebot
Unternehmensbewertung und Kaufpreis
Ertrags-und Substanzwert
Nicht betriebsnotwendiges Anlagevermögen
Der Ertragswert
Besondere Bewertungsproblematiken für Inhaber geführte KMU
Der Diskontierungsfaktor / Kapitalisierungszinssatz
Kontrollrechnung Refinanzierbarkeit
Fachkundige Unternehmensbewerter auswählen
Der gefühlte Unternehmenswert
Beispielrechnung
Die Strukturierung des Angebots und Übergabemodalitäten
Asset-deal oder Share deal
Gesamtverkauf / Teilverkauf
Nachvertragliche Kaufpreiszahlungen
Unternehmensbeteiligung
Nachvertragliche Begleitung durch den Veräußerer
Steuerliche Aspekte
Veräußerungsgewinn
Steuerliche Situation bei dem Erwerber
Exkurs Betriebsimmobilie bei Betriebsaufspaltung
Rechtliche Aspekte
Haftungsausschluss
Kunden- und Lieferantenrechte
Mitarbeiter
Der ideale Erwerber
Die Akquisitionsphase
Das Erstgespräch
Die Verhandlungen
Letter of Intent
Due Diligence 201
Der Kaufvertrag
Garantien und Gewährleistungen
Aufschiebende Bedingungen
Typische Fehler
Der Verkaufszeitpunkt
Beibehalt einer aussichtslosen Vermarktungsstrategie
Singuläre Verhandlungen
Mauertaktik und Zeitfaktor
Das Bauchgefühl
Nachträgliche Kaufpreiserhöhung
Unternehmen in Sondersituationen
Notwendige Assets
Forderungsverzicht
Potentiale
Keine (geldwerte Leistung) ohne real existierende Gegenleistung
Sichere Potentiale
Synergien
Die zeitliche Dimension
Die Rolle der Berater
Finanzierung
Schlusswort
Aktuelle EBIT-Faktoren 2014 und 2008
Vertraulichkeitserklärung
Letter of Intent
Unternehmensexposé
Unternehmensportrait
Standardisierte Zusammenstellung der Unterlagen und Informationen für eine Due Diligence
Kaufvertrag
Nützliche Tipps
Vorwort zum Kapitel 1
Der Autor, Dipl. Betriebswirt Hans-Peter Gemar, Jahrgang 1950 ist seit vielen Jahren selbstständiger M&A Berater und Geschäftsstellenbetreiber einer bundesweit aufgestellten Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft, die sich auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert hat.
Die Erfahrungen von hunderten vermittelten und an Nachfolger übergebene Unternehmen, Tausende von Gesprächen mit Verkäufern und Käufern haben zu einem profunden Know-How auf diesem Gebiet geführt und die Weitergabe dieser Erfahrungen sollen dem betroffenen Personenkreis dazu verhelfen, immer wieder vorzufindende Fehlerquellen, Gründe für das Scheitern dieses einmaligen Projektes, zu vermeiden.
Kapitel 1 schildert anekdotenhaft den Ablauf eines gescheiterten Verkaufsversuchs und soll veranschaulichen, wie man den Verkaufsprozess auf keinen Fall angehen darf. Zwar ist die Geschichte erfunden, doch spiegeln die aufgezeigten Verhaltensmuster die Realität jedes Jahr in Deutschland tausendfach wieder. So oder ähnlich laufen Verkaufsbemühungen gescheiterter Versuche tatsächlich ab. Das wissen wir aus eigener Anschauung und den zahllosen Erfahrungsberichten von Kaufinteressenten, die einen oder mehrere Versuche mit unbetreuten Unternehmensverkäufern hinter sich haben oder auch mit deren Beratern, die ihrerseits analog vorgehen.
Im Kapitel 2 folgt eine Schritt-für-Schritt Anleitung für einen erfolgversprechenden Ansatz, das eigene Unternehmen zu veräußern. Gleichzeitig wird auf zu berücksichtigende Sachzwänge hingewiesen und auch darauf, wie Kaufinteressenten „ticken“, und worin deren Motivation besteht.
Beiträge von oder über den Autor sind in Dutzenden Printmedien veröffentlicht worden. Sie können ggf. Fragen und Anregungen an [email protected] übermitteln.
KAPITEL 1
Drehbuch eines gescheiterten Unternehmensverkaufs
Erste Ideen
Herr M. hat viele Jahre erfolgreich ein Produktionsunternehmen geführt, ist mittlerweile jedoch in die Jahre gekommen und sinniert über seine und die Zukunft seines Unternehmens. Die eigenen Kinder hält er für unfähig, wobei er nicht zur Kenntnis genommen hat oder zur Kenntnis nehmen will, dass diese ihrerseits kein Interesse an dem elterlichen Betrieb haben. Dieser erscheint den Abkömmlingen nicht mehr en Voque, das Unternehmen der Old Economy ginge am Zeitgeist vorbei und überhaupt findet man das vorgelebte Arbeitsleben mit wenig Freizeit, dafür umso mehr Belastungen nicht attraktiv, geschweige denn nachahmenswert.
Was also tun? Den Schlüssel einfach umdrehen wäre eine Option. Andererseits besitzt das Unternehmen mit Sicherheit einen irgendwie gearteten Wert und außerdem gibt es Mitarbeiter, die versorgt bleiben wollen und über die Straße möchte man auch noch gehen können, ohne dass auf den im örtlichen Umfeld bekannten Unternehmer mit dem Finger gezeigt wird, weil es an der erwarteten Fürsorge gemangelt hat.
Herr M. beginnt mit seinen internen Ermittlungen und begibt sich auf eine Fact-Finding-Mission. Fündig zu werden ist kein größeres Problem. In Printmedien, im Internet, auch bei Verbänden und Kammern sowie auf Veranstaltungen erfährt man über das anstehende Thema Erstaunliches, wobei hier das Phänomen der selektiven Wahrnehmung eindrucksvoll funktioniert. Was man nicht hören möchte wird ausgeblendet und die zu den eigenen Vorstellungen passenden Informationen werden begierig aufgesogen. Gelegentlich (eher selten) finden sich gesprächsbereite Unternehmensverkäufer, manchmal Vortragende bei einer Podiumsveranstaltung, die über Ihre eigene Verkaufssituation berichten, auch davon, dass Sie bombige Verkaufserlöse erzielt hätten. Es geht demnach. Man kann einen externen Nachfolger finden, der dazu offensichtlich noch bereit ist, einen Haufen Geld für sein Unternehmen zu bezahlen. Die Frage ist nur, wie das Projekt „ Unternehmensverkauf“ anzugehen ist. Man könnte den eigenen Steuerberater fragen und ins Boot ziehen. Es scheint allerdings zielführender, diesen erst einmal nicht ins Bild zu setzen, weil er dem Unternehmer den Verkauf vielleicht ausreden würde (er verlöre wahrscheinlich sein Beratungsmandat).
Die eigenen Recherchen haben ergeben, dass es für diese Fälle zu Hauf offensichtlich Experten, sogenannte Merger & Akquisition-Berater gibt, sehr viele Einzelkämpfer, auch mittelständische Beratungsgesellschaften und solche mit Hochglanzprospekten oder vornehme Kreditinstitute. Aber diese Experten sind teuer, jedenfalls in den Augen eines Auftraggebers, der sein Geld jeden Tag mühselig erstreiten muss und überhaupt – woher soll Herr M. wissen, wer der Richtige ist. Eine Gewähr für deren Gelingen gibt es ohnehin nicht. Außerdem, was sollen diese Experten können, was Herr M. nicht selbst auch könnte. Schließlich ist er gestandener Unternehmer und hat so manche Schlacht geschlagen und kitzelige Situation überstanden. Es resultiert draus die Überzeugung, dass selbst der Mann ist und so geht Herr M. sein Projekt mehr oder weniger planvoll an. Herr M. lebt in der Überzeugung, dass er ein einzigartiges Unternehmen besitzt, das ihm sozusagen aus den Händen gerissen werden müsste. Ihm ist dabei nicht bewusst, dass er jedes Jahr aufs Neue mit 22.000 anderen Unternehmern im Wettbewerb steht, die alle dasselbe Gedankengut haben.
Der Plan A
Herr M. macht sich ans Werk und seine Strategie besteht darin, eine Art Kurzinformation an den Markt zu geben, die mehr Fragen als Antworten aufweist und das Vorstellungsvermögen möglicher Kaufinteressenten dahingehend deutlich überfordert, dass sich einem Solchen nicht erschließt, worum es eigentlich geht. Es ist aber immerhin von noch nicht ausgeschöpften Potentialen die Rede mit enormen Wachstumsmöglichkeiten. Umsatz oder Kaufpreis findet man in der Kurzinformation nicht. Diese Kurzinformation hat einen Umfang von bestenfalls einer viertel DIN-A4-Seite und Herr M. meint, mehr Input könne anfänglich auf gar keinen Fall herausgegeben werden, weil sonst jeder wüsste, dass es um sein Unternehmen geht, was in 99 % aller Fälle eine völlige Fehleinschätzung ist.
Herr M. beschließt, Inserate in kostenlosen Internet-Portalen zu schalten, was grundsätzlich nicht zu kritisieren ist. Je nachdem, welches Internet-Portal gewählt wird, erhält man – eine gute Qualität der Anzeige vorausgesetzt – mehrere Dutzend Zuschriften täglich, jedenfalls solange eine Anzeige neu ist. Danach ebbt der Zustrom ab. Ist der Text der Anzeige nebulös, gibt es keine Zuschriften. Ist er latent vielversprechend, gibt es haufenweise Zuschriften mit Nachfragen, etwa nach der Region, der Mitarbeiteranzahl, Umsatz und Kaufpreis und so manches mehr. Einige Kaufinteressenten schießen auch über das Ziel hinaus, indem Sie – ohne sich ausreichend vorgestellt zu haben- gleich um Zusendung der letzten Bilanzen bitten.
Die Geister, die man rief
Und nun befindet sich Herr M. gleich in einem mehrfachen Dilemma. Erstens weiß er nicht, mit wem er es zu tun hat und welcher Kontakt zielführend sein könnte. Zweitens muss er nun seine Anonymität aufgeben. Drittens stellt er fest, dass die Aktion Zeit kosten wird, weil es viele Fragen zu beantworten gibt und viertens wird ein Kaufpreis abgefragt, ein Thema, mit dem Herr M. sich noch gar nicht befasst hat, weil er auch nicht weiß, was marktfähig ist. In dieser Situation entscheiden sich viele inserierende Unternehmer abzutauchen und gar nicht zu antworten. Ein Umstand, der dafür sorgt, dass viele Kaufinteressenten Ihre Bemühungen frustriert einstellen oder harsche Mitteilungen an den Inserenten schreiben oder sich gar bei dem Börsenbetreiber beschweren.
Herr M. entwickelt nun wie viele seiner Verkäufer-Mitstreiter die Idee, einem Kaufinteressenten sein Unternehmen in einem persönlichen Gespräch erklären zu wollen verbunden mit der Taktik, vom speziellen Einzelfall ins Ungefähre abzudriften. Es gibt tatsächlich Kaufinteressenten, die sich auf so einen Vorschlag einlassen. Es handelt sich hierbei immer um Anfänger auf dem Gebiet, die Ihre ersten Versuche unternehmen. Ein erfahrener Kaufinteressent mit klaren Zielvorstellungen würde sich auf einen solchen Vorschlag nicht einlassen. Die Gespräche mit dem Anfänger-Verkäufer und dem Anfänger-Käufer verlaufen oft sogar in guter Atmosphäre und vermitteln den Gesprächsbeteiligten das zufriedene Gefühl, einen guten Dialog geführt zu haben. Tatsächlich sind beide Seiten aber keinen Schritt weitergekommen, weil die wesentlichen Themen umschifft wurden und keine Seite einen Plan hat. Typische Aussage ist der oft gehörte Satz „ ich bin für alles offen“.
Herr M. entscheidet sich, noch 1-2-mal aus seiner Sicht gute Gespräche führen zu wollen und wiederholt die Aktion mit 2 weiteren Kandidaten. Ablauf wie gehabt. Es gibt die Bekenntnisse, weitermachen zu wollen, am Ende bleiben jedoch auf beiden Seiten die relevanten Fragen offen. Nun entwickelt sich ein endloser Ballabtausch. Die Parteien bombardieren sich mit endlosen Fragen, von denen die zur Antwort aufgeforderte Seite nicht versteht, was die eine oder andere Frage soll. Der Ball verliert an Luft. Das Interesse beider Seiten erlahmt, nachdem einiges an Zeit und Energie investiert wurde.
Nach diesen und vielleicht weiteren Fehlversuchen, gibt Herr M. frustriert auf und steht vor dem kritischen Punkt, die Aktion komplett abzubrechen. Er hat den Mut und das Zutrauen in ein Gelingen verloren. Andererseits empfindet er eine gewisse Amtsmüdigkeit und sein Bankier drängt ihn dazu, die Nachfolgeregelung anzugehen. Nach einer gewissen Auszeit kann er sich aufraffen, einen neuen Anlauf zu starten. Es dämmert ihm allerdings, was er bei einem nächsten Versuch anders machen müsste. Aus den Gesprächen mit den Kaufinteressenten hat er gelernt, dass diese sich keine langen Monologe anhören möchten, sondern eine Unternehmensbeschreibung in Form eines Exposé-s erwarten.
Der Plan B
Herr M. ist Verfechter der Idee, dass das Unternehmen so verkauft werden soll wie es ist, ohne Optimierungen vorzunehmen und macht sich an sein Werk einer Beschreibung. Aus unzähligen Unternehmens- und Produktpräsentationen ist er in der Erstellung derartiger Unterlagen geübt. Diese sind zwar bestens dafür geeignet, neue Kunden oder Lieferanten zu gewinnen, nicht aber Investoren oder Kaufinteressenten. Diese haben weiterreichende Anforderungen an ein Exposé und möchten herausfinden, warum sie sein Unternehmen für einen Erwerb in Betracht ziehen sollten. Zum Glück erinnert sich Herr M. an diesbezügliche Fragenstellungen aus dem vorherigen Versuch und fügt unbereinigtes Zahlenmaterial ein, erstellt ein Organigramm, eine Personalliste, eine Übersicht zur Kundenverteilung, zur eigenen Marktstellung, zu den Vertriebsaktivitäten. Großen Raum nimmt dabei die Beschreibung der Betriebsimmobilie, des Maschinen- und Fuhrparksparks ein, so als ob es darum ginge, einen Substanzwert zu begründen, der in den allerwenigsten Fällen irrelevant ist. Und natürlich ist an vielen Stellen von nicht ausgeschöpften Potentialen die Rede, sei es in Bezug auf nicht ausgeschöpfte Marktchancen, leicht erreichbare höhere Marktanteile oder die erweiterbare Immobilie.
Das Exposé hat jetzt einen Umfang von 6 Seiten und rundherum zufrieden mit seinem Werk startet Herr M. den nächsten Versuch. Um das Thema Angebotspreis macht Herr M. weiterhin einen großen Bogen, um Interessenten nicht abzuschrecken. Er hat zwar eine vage Vorstellung von der erwünschten Kaufpreishöhe. Diese ist allerdings durch keine Fakten begründet und so hält er sich in diesem Punkt erst einmal bedeckt und formuliert: Preis ist Verhandlungssache. Ebenso offen bleibt die Frage nach der Deal-Struktur und nach seiner Rolle nach einem Verkauf. Notwendige Anforderungen an einen Kaufinteressenten bleiben ebenfalls sein offenes Geheimnis. Herr M. hat einen Vertrauten gefunden, der eingehende Zuschriften erst einmal in dessen Namen beantworten soll und zusätzlich hat er sich überlegt, seine Anzeige in einer anderen Internetbörse zu schalten in der Hoffnung, vorherige Interessenten würden seine Anzeige nicht wiedererkennen. Ein Trugschluss, denn Kaufinteressenten haben die Eigenschaft, alle Ihnen zugänglichen Börsen zu nutzen. Da zwischen Erst-und Zweitversuch allerdings einige Zeit verstrichen ist – die Vorbereitung hat mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen – und Kaufinteressenten jährlich Hunderte von Angeboten lesen, ist hier kein größeres Problem gegeben. Einige Wiedererkenner ignorieren das Angebot einfach. Tatsächlich gibt es nach Veröffentlichung auch bald Zuschriften, die der Vertraute bereitwillig mit dem anonymen Exposé beantwortet. Im späteren Verlauf zeigt sich allerdings, dass an Kaufinteressenten bestimmte Maßstäbe anzulegen sind hinsichtlich deren Eignung und Bonität, was hier versäumt wurde, so dass unnötig viele Parteien in den Besitz der Unterlage kommen. Auch gibt es Zuschriften von Beteiligungsgesellschaften, die allerdings im Vorwege derartig viele Unterlagen verlangen, insbesondere Business-Pläne, was Herr M. alleine schon aus zeitlichen Gründen nicht zu leisten vermag. Diese Gesellschaften werden daher aussortiert. Es gibt auch Zuschriften von Wettbewerbern. Herr M. fürchtet jedoch Werksspionage und schließt auch diesen Kreis aus, nicht wissend, dass Wettbewerber aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen oft Premiumpreise zahlen.
Die lieben Kaufinteressenten
Übrig bleiben in erster Linie Existenzgründer. Das ist nicht abwertend zu sehen, denn oft genug handelt es sich um hochqualifizierte Personen, die über Führungserfahrung verfügen und teilweise in ihren alten Managerfunktionen mehr Bezüge erhielten, als Herr M. je als Gewinn erzielen konnte. Herr M. macht im laufenden Prozess die Erfahrung, dass es in vielen Fällen keine Reaktion auf sein Exposé gibt und so fragt er mehrmals vergeblich nach. Erst im weiteren Verlauf der Aktion wird er erkennen, dass diese Strategie nicht zielführend ist. Eine Antwort gibt es auf Nachfragen selten, die Kandidaten befassen sich längst mit anderen Angeboten. Umgekehrt reagieren ernsthaft Interessierte stets recht zügig, ohne dass es Nachfragen bedarf, denn auch sie haben ein Interesse am Gelingen.
Herr M. sortiert seine Rückmeldungen und entscheidet sich für einen Kandidaten, der nach Aktenlage einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Dieser wird zu einem Gespräch eingeladen. Halbwegs gut mit Informationen ausgestattet entwickelt sich ein Frage- und Antwort-Spiel, bei dem insbesondere Verkäufer gerne abschweifende Monologe halten. Das ist nicht jedermanns Sache, so dass der Käuferkandidat mehrfach unterbricht, um sein Informationsbedürfnis befriedigen zu können. Damit sammelt er keine Pluspunkte und als er auch noch kritisch hinterfragt, warum die angegebenen Potentiale nicht in klingende Münze umgesetzt wurden, wenn es doch so leicht sei, macht der Verkäufer zu und hat den Kandidaten innerlich abgehakt. Er wird sich daran gewöhnen müssen, dass hinter den Fragen keine Boshaftigkeit steckt, sondern der erklärte Versuch, Chancen und Risiko des Unternehmens zu erkennen, teilweise geschickt oder weniger geschickt vorgetragen.
Kandidat 2 kommt ins Spiel und auch dieser wird zum Gespräch eingeladen. Herr M. ist nun vorgewarnt und hat seine Frustrationsgrenze erweitert. Das Gespräch verläuft ähnlich wie das erste mit dem Unterschied, dass Herr M. auch bei kritischen Fragen noch wohlwollend bleibt, so dass es zwangsläufig zu dem Punkt Kaufpreis und der Rolle des Verkäufers nach dem Verkauf kommt. Herr M. reagiert zögerlich und ringt sich schließlich zu dem Statement durch, den Kaufinteressenten um ein Angebot zu bitten. Dieser willigt ein, bittet jedoch noch um weiterführende Informationen insbesondere zu den Finanzahlen. Es wird eine zeitliche Deadline vereinbart und in dem Bewusstsein, sich weitgehend einig zu sein, geht man auseinander. Das Kaufangebot kommt tatsächlich zum vereinbarten Zeitpunkt herein. Herr M. fällt allerdings aus allen Wolken, als er am Ende das Ergebnis realisiert. Selbst hat er zwar keine klaren Vorstellungen, allenfalls ein Bauchgefühl. Doch dieses ist so verheerend abweichend von dem Angebot – dass er entrüstet ablehnt. Er hatte vermutet, dass ein Angebot vielleicht um 10- 20 % niedrigerer als seine Wunschvorstellung ausfallen könnte, nicht aber, dass nur ein Bruchteil dessen angesagt ist.
Zum Glück gibt es einen weiteren Interessenten, so dass ein drittes Gespräch angesetzt wurde. Die Vereinbarung dieses Gesprächs war schon schwieriger als zuvor. Herr M. begeht wie viele seiner Mitversucher den Fehler, nicht parallel zu verhandeln und hat sich für die Taktik entschieden, die Kandidaten zeitlich nacheinander abhandeln zu wollen. Das hat Warteschleifen für die Interessenten zur Folge und bei manchen erlahmt das Interesse im Zeitablauf. Außerdem beschäftigen sich diese immer parallel mit anderen Angeboten, so dass bei manchen schlichtweg der Zug abgefahren ist. Oder aber, sie sind verärgert über ihre Rolle als zweite oder dritte Wahl.
Gespräch 3 verläuft wie Gespräch 2 und auch hier steht am Ende die Vereinbarung über ein herauszulegendes Kaufangebot des Interessenten. Herr M. liest viel über Risiken und Unabwägbarkeiten, es ist von Earn-Out und Verkäuferdarlehen die Rede. Ohne sich über die Begrifflichkeiten und Auswirkungen vollständig klar zu sein, addiert Herr M. die einzelnen Summen auf und kommt in der Gesamtheit auf einen Betrag in einer ähnlichen Größenordnung wie zuvor. Wieder ein jäher Schlag, wobei hier noch negativ für den Verkäufer hinzukommt, dass er den Kaufpreis nicht nur nicht in einer Summe, sondern auch noch gekoppelt an zukünftige Erträge erhalten soll.
Einsichten
Herr M. kommt zu der Erkenntnis, dass an den Angeboten vielleicht insofern etwas dran sein könnte, als es so etwas wie Marktpreise für Unternehmen geben könnte, so dass alle Interessenten mehr oder ähnliche Angebote herauslegen würden und entschließt sich in seiner Not, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er entscheidet sich aus dem eingangs geschilderten Grund gegen seinen eigenen Steuerberater, was nicht zwangsläufig ein Fehler sein muss. Allerdings hätte dieser ihn vielleicht unaufgefordert darauf hingewiesen und auch vorgerechnet, wie viel Netto vom Brutto übrig bleibt. Soll heißen, dass ein möglicher Veräußerungsgewinn zu versteuern ist. Von diesem Umstand erlangt Herr M. erst sehr viel später schmerzlich Kenntnis.
Herr M. entschließt sich, einen wirklichen Experten zu Rate zu ziehen und wird über Verbände letztendlich auch fündig. Zu dem Erstgespräch legt Herr B. die letzten 3 Bilanzen mit GuV bereit, Planungsrechnungen gibt es nicht, gab es noch nie und er ist der Meinung, genügend Informationen zur Bestimmung eines Unternehmenswertes herausgegeben zu haben. Als der Experte eine lange Liste mit sehr vielen Fragen auf den Tisch liegt, dämmert es Herrn W., dass eine Unternehmensbewertung eine aufwendigere Sache ist, als er sich vorgestellt hat. Jede einzelne Position und GuV wird hinterfragt und es ist in diesem Zusammenhang von vorzunehmenden Bereinigungen die Rede. Im Ergebnis stellt sich die Sachlage so dar, dass die Bemessungsgrunde für eine Bewertung nicht mehr viel mit den Ergebnissen der Gewinn-und Verlustrechnungen gemeinsam hat. Zusätzlich ist auf Basis dieser bereinigten Ergebnisse eine Planungsrechnung aufzubereiten als Resultat zeitaufwendiger Erörterungen und Klärungen auf Berater- und Verkäuferseite. Das gleiche Prozedere wiederholt sich in Zusammenhang mit den Bilanzpositionen. Und es kommt noch ärger als es um die Fragen geht, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind bzw. zustande kommen. Es geht hierbei um Kunden- und Lieferantenbeziehungen, insbesondere um Kundenabhängigkeiten, vorhandenem Know-How, Vertriebsorganisation, Alleinstellungsmerkmale – alles Faktoren, die als sogenannte weiche Faktoren bezeichnet werden. Auch ist zu klären, wie vorzufindende Abweichungen in den Vorjahren erklärbar sind und ob es Aufwendungen und Erträge mit Einmalcharakter gab.
Es wird dabei festgestellt, dass sich die mangelhafte Verkaufsvorbereitung rächt. Der Gesellschafter hält die selbst entwickelten Patente als Privatperson. Diese müssen nun steuerpflichtig in die Gesellschaft eingebracht werden. Es stellt sich heraus, dass die Geschäftsführervergütung im Drittvergleich zu niedrig ist, wodurch in Höhe der Differenz eine Ergebnisminderung anzusetzen ist und der Vertrieb hängt überwiegend von dem geschäftsführenden Gesellschafter selber ab, der nie wirklich delegiert hat.
Zusammen mit vielen anderen kleineren Bereinigungen ergibt sich eine stattliche Summe, um die die ausgewiesenen Ergebnisse korrigiert werden müssen. Am Ende ergibt sich eine Zahlenreihe mit bereinigten Ergebnissen, die die Grundlage für den Rechenteil der Bewertung bilden. Vereinfacht ausgedrückt werden die bereinigten zukünftigen Ergebnisse auf den Bewertungsstichtag abgezinst, so dass am Ende ein Unternehmenswert dokumentiert wird, der sich in der Größenordnung von ein paar Jahresgewinnen bewegt, je nach Branche üblicherweise bei einem gedanklichen Multiplikator zwischen 3 und 6, jedenfalls meilenweit entfernt von dem „gefühlten“ Unternehmenswert. Da ein Kaufinteressent sich nicht um gefühlte Werte schert sondern sich an nüchternen Zahlen orientieren muss, der Rendite, gibt es wenig Spielraum für Bewertungsverhandlungen.
Erneut ins Gefecht
Derart ins Bild gesetzt und nach Tagen des Zweifels ob der Sinnhaftigkeit des“ Projektes Unternehmensverkauf “ möchte Herr M. den Gesprächsfaden mit Kandidat 2 wieder aufnehmen, denn dieser hatte zumindest noch einen Einmalbetrag als Kaufpreis angeboten. Es rächt sich nun allerdings ein vorschnell ausgesprochenes Nein und so widmet sich Herr W. dem 3. Kandidaten zu und bietet eine Verhandlungsrunde an.
In dieser Verhandlungsrunde stellt sich schnell heraus, dass an der Bewertungsschraube tatsächlich nicht gedreht werden kann und so geht es folgerichtig um die Frage, worin der Gegenwert für den gebotenen Preis bestehen soll, sprich, was erworben werden soll. Unternehmenswert und Kaufpreis wird oft verwechselt. Bei dem Anlagevermögen ist man sich schnell einig, schwieriger wird es beim Umlaufvermögen. Da wären zunächst die Forderungen und Vorräte, über die sich trefflich hinsichtlich der Werthaltigkeit streiten lässt. Üblicherweise ein Thema für die anstehende Due Diligence. Da man sich nicht über Abschläge oder Zuschläge (z.B. bei steigenden Rohstoffpreisen) einigen können wird, wird dieser Punkt ausgeklammert und bei den vertraglichen Garantien berücksichtigt. Noch schwieriger wird es beim Thema Eigenkapital. Damit ist nicht der bei einer GmbH als Stammkapital ausgewiesene Wert gemeint, sondern das wirtschaftliche Eigenkapital als Summe des Stammkapitals und Gewinnvorträgen. Die Unternehmen werden oft mit der Minimalausstattung von 25.000 Euro gegründet und im Laufe der Jahre hat sich das nominale Eigenkapital zwangsläufig durch stehen gelassene Gewinne vervielfacht. Ohne diese Vervielfachung wäre die Finanzierung des aktuellen Geschäftsbetriebs nicht mehr möglich und so besteht das Bestreben des Kaufinteressenten darin, möglichst bzw. zumindest das ausgewiesene wirtschaftliche Eigenkapital übertragen zu bekommen.
In diesem Punkt reizen gewiefte Kaufinteressenten Ihre Verhandlungsmacht komplett aus und Herr W. wäre gut beraten gewesen, sich einen M & A- Berater zur Seite zu nehmen, der aus den Erfahrungen vieler Verhandlungen den Gegenpol zu dem Kaufinteressenten hätte bilden können. Die Eigenkapital - Forderung hätte beispielsweise gut mit der Frage des Earn-Outs verknüpft werden können. Die Forderung nach einem Earn-Out wird immer von Kaufinteressenten vorgetragen, ist aber eine vergleichsweise stumpfe Waffe, weil die meisten Verkäufer einen Solchen mehrheitlich immer noch ablehnen. Diesbezüglich sind potentielle Käufer eine Ablehnung in dieser Frage gewohnt. Herr M. ist jedoch mittlerweile mürbe vom Verhandlungsmarathon, auch weil er keine Alternative hat. Leider hat er keinen Parallelkandidaten aufgebaut bzw. zugelassen. Die Parteien einigen sich schließlich auf die Rahmenbedingungen einschließlich Übergabezeitpunkt und die befristete beratende Rolle des Gesellschafters nach dessen Verkauf. Am Ende wird vereinbart, dass der Kaufinteressent wie üblich einen sogenannten Letter of Intent (Absichtserklärung) erstellt, in dem all die besprochenen Punkte schriftlich in einer Vereinbarung festgehalten werden. Herr M. ist vorsichtig ausgedrückt unzufrieden mit dem Verhandlungsergebnis, auch mit sich selbst, ahnt zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, was ansonsten noch auf ihn zukommen wird.
Vom Ungemach schriftlicher Abmachungen
Der Letter of Intent hinterlässt auf den ersten Blick einen recht offiziellen Eindruck und ist bereits von Juristen in Juristendeutsch abgefasst. Er bekundet die Absicht beider Parteien, beschreibt den Kaufgegenstand, Voraussetzungen, die Übernahmebedingungen und den Kaufpreis, ebenso den zeitlichen Rahmen, den Prüfungsgegenstand und Umfang, beteiligte Personen. Daneben wird eine Vereinbarung zur Vertraulichkeit, Exklusivität, Schutzmaßnahmen, Abwerbeverbot und Kundenschutz, Offenlegungspflichten, Kostenfragen und Schadenersatzansprüchen getroffen. Außerdem gibt es einen Finanzierungsvorbehalt und natürlich jede Menge Fristen. Herr M. ist zunächst entsetzt und glaubt, diesen Letter of Intent unter gar keinen Umständen unterzeichnen zu können.
Sein erster Gedanke ist, dass bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit seiner Unterschrift alles rechtskräftig vereinbart wird. Nach einem beschwichtigenden Telefonat mit dem Kaufinteressenten holt Herr M. sich erneut Expertenrat ein, dieses Mal von einem Rechtsanwalt. Herr M. ist Gesellschafter einer GmbH und so belehrt ihn der Rechtsanwalt, dass alle für einen Kaufvertrag bestimmten Vereinbarungen unwirksam sind, solange nicht notariell





























